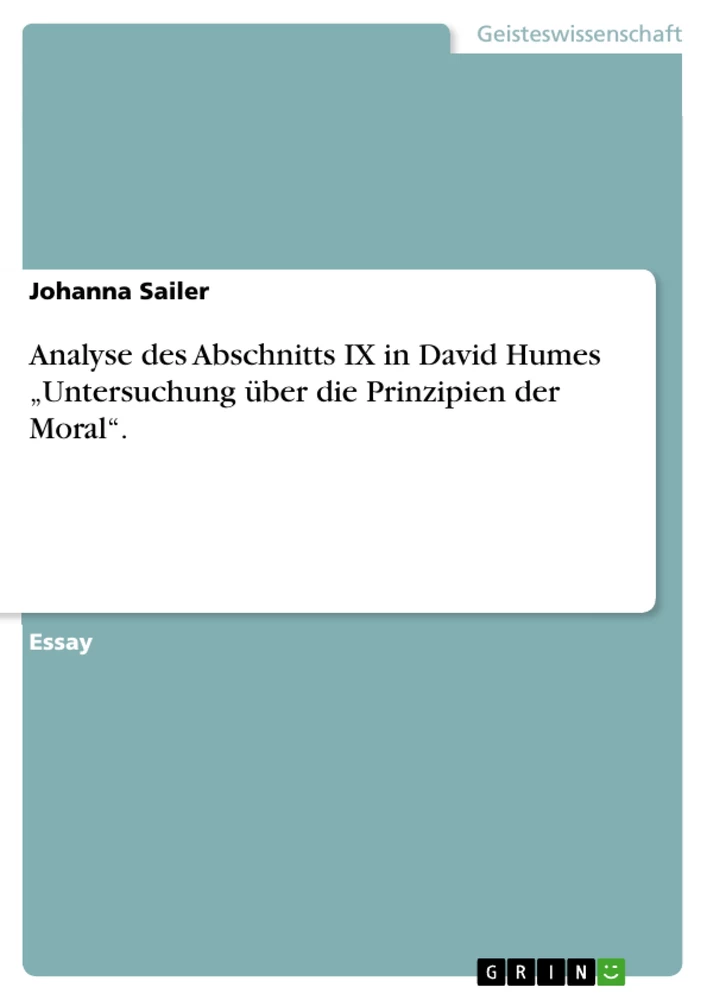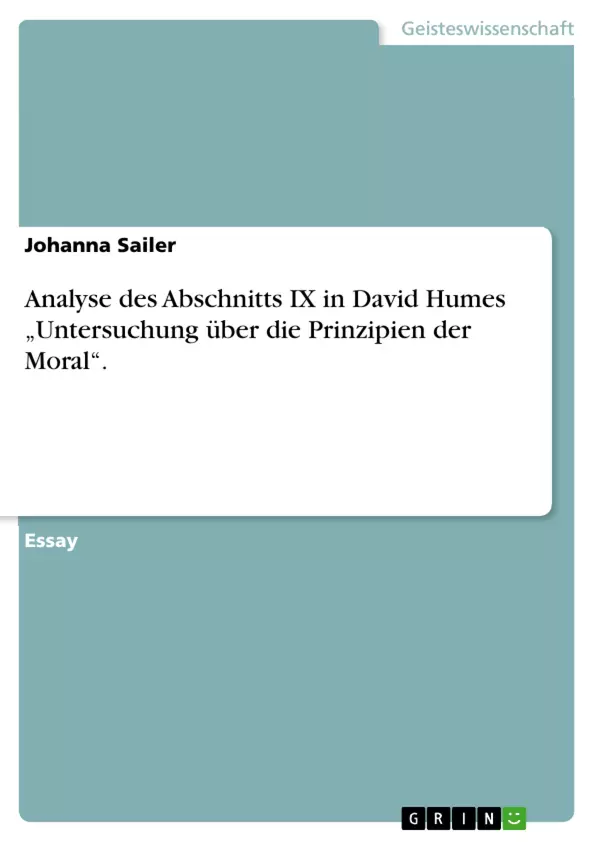David Hume ist einer der bedeutendsten Vertreter der britischen Aufklärung. Er vertritt allgemeine Ziele dieser Epoche und sucht nach “einer angemessenen Form des menschlichen Zusammenlebens in einer Gesellschaft“ unabhängig von den Glaubenssätzen der Kirche. Unter dem Einfluss des veränderten wissenschaftlichen Denkens durch Bacon, Galilei, Descartes und Newton, forschen die Aufklärer nach den Ursachen von Entitäten, um ihre Gesellschaftstheorien empirisch zu stützen.
Humes Argumentation besteht aus der Beobachtung von “menschliche[m] Handeln oder Verhalten“3 ”im täglichen Leben“4. Hierzu gibt der Empirist Beispiele für Alltagssituationen menschlichen Zusammenlebens, die durch ihre Selbstverständlichkeit eine Aussage über die grundlegenden Prinzipien moralischen Handelns treffen sollen.
Im Vergleich zu anderen Aufklärern Großbritanniens wie beispielsweise Hutcheson und Shaftesbury, spricht David Hume dem Gefühl eine besonders große Bedeutung für das moralische Handeln zu. Seine Gefühlsethik beinhaltet die These, dass nicht der Verstand, sondern das Gefühl der Ursprung menschlicher Verhaltensweisen ist.
Weiterhin geht er davon aus, dass der Mensch neben egoistischen Gefühlen auch ein altruistisches Gefühl – das Gefühl der Menschlichkeit – besitzt. Die Menschlichkeit hat nach Hume eine größere Bedeutung als die Selbstliebe.
Mit diesen Hauptthesen distanziert sich David Hume bewusst vom Rationalismus und vom ethischen Egoismus.
Das Gefühl der Menschlichkeit, so Hume, ist in jedem Menschen verankert. Doch wie äußert es sich? Wie ist zu beweisen, dass solch ein allgemeines Gefühl tatsächlich existiert?
Im Folgenden wird Humes Untersuchung der Menschenliebe thematisiert und die Allgemeingültigkeit seiner Thesen diskutiert.
David Hume ist einer der bedeutendsten Vertreter der britischen Aufklärung. Er vertritt allgemeine Ziele dieser Epoche und sucht nach “einer angemessenen Form des menschlichen Zusammenlebens in einer Gesellschaft“[1] unabhängig von den Glaubenssätzen der Kirche. Unter dem Einfluss des veränderten wissenschaftlichen Denkens durch Bacon, Galilei, Descartes und Newton[2], forschen die Aufklärer nach den Ursachen von Entitäten, um ihre Gesellschaftstheorien empirisch zu stützen.
Humes Argumentation besteht aus der Beobachtung von “menschliche[m] Handeln oder Verhalten“[3] ”im täglichen Leben“[4]. Hierzu gibt der Empirist Beispiele für Alltagssituationen menschlichen Zusammenlebens, die durch ihre Selbstverständlichkeit eine Aussage über die grundlegenden Prinzipien moralischen Handelns treffen sollen.
Im Vergleich zu anderen Aufklärern Großbritanniens wie beispielsweise Hutcheson und Shaftesbury, spricht David Hume dem Gefühl eine besonders große Bedeutung für das moralische Handeln zu. Seine Gefühlsethik beinhaltet die These, dass nicht der Verstand, sondern das Gefühl der Ursprung menschlicher Verhaltensweisen ist. Weiterhin geht er davon aus, dass der Mensch neben egoistischen Gefühlen auch ein altruistisches Gefühl - das Gefühl der Menschlichkeit - besitzt. Die Menschlichkeit hat nach Hume eine größere Bedeutung als die Selbstliebe.
Mit diesen Hauptthesen distanziert sich David Hume bewusst vom Rationalismus und vom ethischen Egoismus.
Das Gefühl der Menschlichkeit, so Hume, ist injedem Menschen verankert. Doch wie äußert es sich? Wie ist zu beweisen, dass solch ein allgemeines Gefühl tatsächlich existiert?
Im Folgenden wird Humes Untersuchung der Menschenliebe thematisiert und die Allgemeingültigkeit seiner Thesen diskutiert.
Nachdem David Hume in seiner Untersuchung zusammengefasst hat, dass Charaktereigenschaften entweder für den Besitzer oder für andere nützlich oder unmittelbar angenehm sein müssen, damit persönliche Anerkennung entsteht, widmet er sich im 9.Kapitel der Menschlichkeit.
Die Menschlichkeit ist ein soziales Gefühl, dass dazu führt, dass die Menschen Charaktereigenschaften von Natur aus gleich werten.
Auf die Liste der allgemeinen Tugenden setzt Hume Anstand, Freundlichkeit, Fleiß, Menschenkenntnis, gutes Benehmen und “Gelassenheit der Seele”[5].
Wer möchte bezweifeln, dass diese Eigenschaften ein allgemeines Wohlwollen auslösen?
Bei der Beschreibung der Laster kritisiert David Hume die Kirche mit ihrem “Aberglauben und der falschen Religion”[6]: “Zölibat, Fasten, Buße, Kasteiung, Selbstverleugnung, Scham, Schweigen, Einsamkeit und das ganze Verzeichnis mönchischer Tugenden”[7] kritisiert er als unmenschliche Eigenschaften, die gegen Herz und Verstand des Individuums arbeiten.
Wir wissen aus Humes vorangehender Untersuchung, dass es von ihrem Zweck nützlich oder angenehm für sich oder andere zu sein abhängt, ob diese Eigenschaften als tugendhaft undjene als lasterhaft gewertet werden.
Die Frage stellt sich nun, warum es für den Einzelnen überhaupt von Bedeutung ist, dass sein Charakter “das Glück in der Welt förder[t]” und “ihn zu einem wertvolleren Mitglied der Gesellschaft mach[t]”[8].
Anhänger des ethischen Egoismus wie Thomas Hobbes und später Friedrich Nietzsche würden bezweifeln, dass es einem Menschen Freude bereitet, für die Gesellschaft zu arbeiten, sondern nach ihnen täte er es einzig aus Eigennutz. Vertreter des Rationalismus wie Immanuel Kant würden in erster Linie den Verstand für altruistisches Handeln verantwortlich machen.
David Hume vertritt die Meinung, dass Moral aus einem Gefühl entsteht, “das allen Menschen gemeinsam ist”[9] und welches “sich auf die ganze Menschheit erstreckt und die Handlungen und Verhalten auch der fern stehendsten Personen zu einem Gegenstand von Beifall und Missbilligung macht [...]”.[10]
Den Beweis für die Allgemeingültigkeit dieser Gefühle findet der Philosoph in der Sprache, die als menschliches Allgemeingut aufgespalten ist in “die Sprache der Selbstliebe”, die ein persönliches Gefühl ausdrückt und in “eine andere Sprache [...],
[...]
[1] Hume, David: Eine Untersuchung der Grundlagen der Moral. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2002. (Sammlung Philosophie), Bd.2, S.18.
[2] Vergl. Ebd., S.16.
[3] Hume, David: Eine Untersuchung über die Prinzipien der Moral. Stuttgart: Reclam 2002. (Reclams Universalbibliothek, Bd.8231, S.197.
[4] Ebd.
[5] Hume, S. 197.
[6] Ebd., S.198.
[7] Ebd.
[8] Ebd.
[9] Ebd, S.199.
[10] Ebd.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Hauptthese von David Humes Gefühlsethik?
Hume vertritt die These, dass nicht der Verstand, sondern das Gefühl der Ursprung moralischen Handelns und menschlicher Verhaltensweisen ist.
Was versteht Hume unter dem „Gefühl der Menschlichkeit“?
Es ist ein altruistisches Gefühl, das in jedem Menschen verankert ist und dazu führt, dass wir Charaktereigenschaften, die nützlich oder angenehm für die Gesellschaft sind, positiv bewerten.
Warum kritisiert Hume die sogenannten „mönchischen Tugenden“?
Eigenschaften wie Zölibat, Fasten oder Selbstverleugnung betrachtet Hume als Laster, da sie weder für den Einzelnen noch für die Gesellschaft nützlich oder angenehm sind und somit gegen das Prinzip der Menschlichkeit verstoßen.
Wie unterscheidet sich Hume von Thomas Hobbes?
Während Hobbes (ethischer Egoismus) davon ausgeht, dass Menschen nur aus Eigennutz handeln, glaubt Hume an ein angeborenes soziales Wohlwollen und das Mitgefühl für andere.
Welchen Beweis führt Hume für die Allgemeingültigkeit der Moral an?
Hume sieht den Beweis in der Sprache: Neben der „Sprache der Selbstliebe“ gibt es eine allgemeine moralische Sprache, die Handlungen unabhängig von persönlichen Interessen als lobenswert oder tadelnswert einstuft.
- Citation du texte
- Johanna Sailer (Auteur), 2010, Analyse des Abschnitts IX in David Humes „Untersuchung über die Prinzipien der Moral“., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/210002