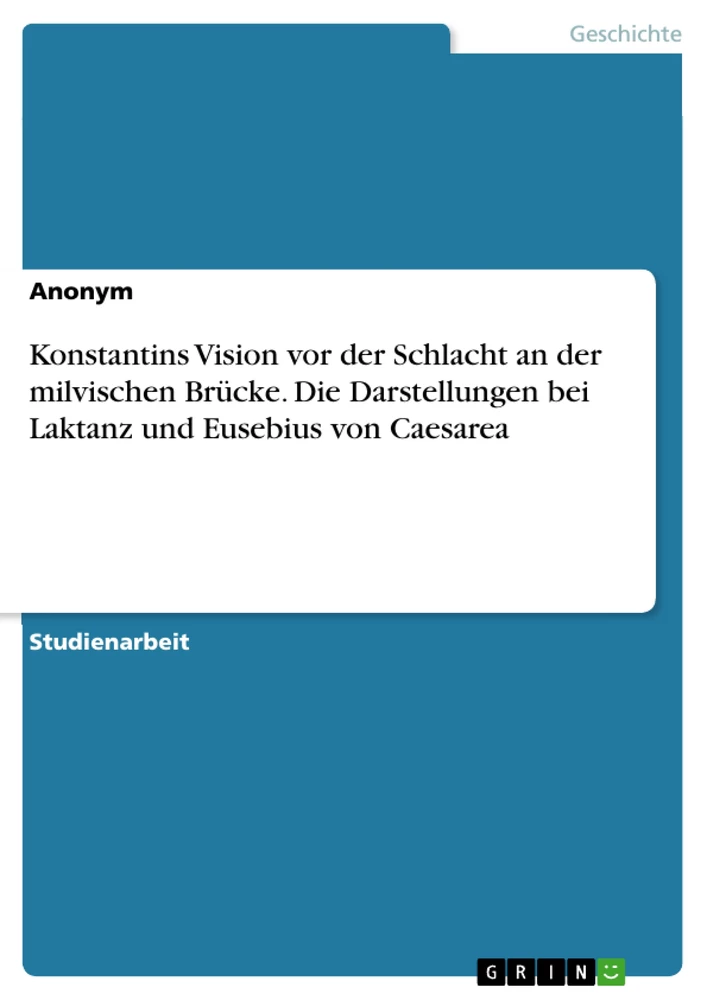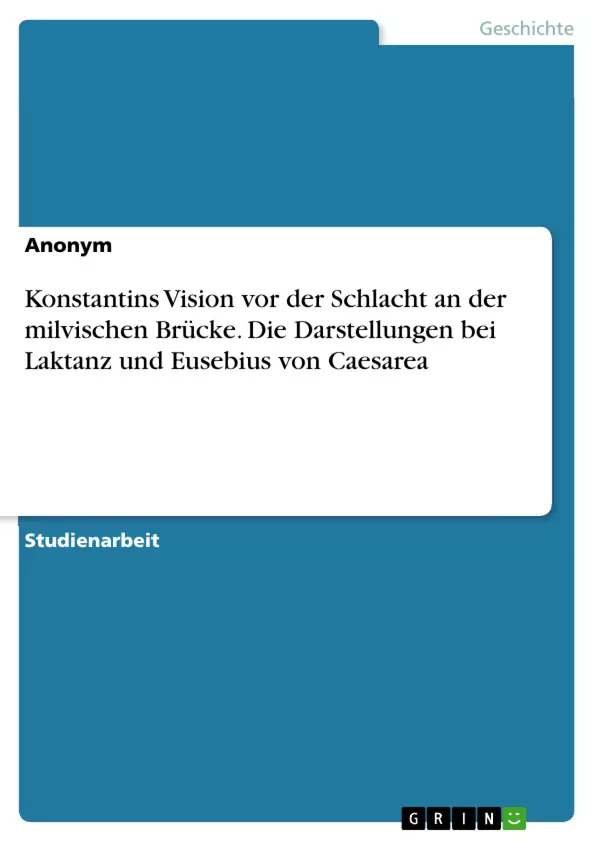Am 28. Oktober des Jahres 312, besiegte Kaiser Konstantin Kaiser Maxentius in der Schlacht an der milvischen Brücke, obwohl er seinem Gegner unterlegen war. Bis heute beschäftigen sich die Forscher kontrovers mit der Frage, ob Konstantin diese Schlacht im Zeichen des Kreuzes geführt hat oder nicht. In engem Zusammenhang damit wird auch diskutiert, ob Konstantin sich unter jenes Zeichen und damit auch unter Christi Schutz, auf Grund einer Vision bzw. eines Traumes stellte. Auch hier gehen die Forschermeinungen weit auseinander. Jeder der Forscher gewichtet bei seinem Antwortversuch die zahlreich vorhandenen Quellen anders.
In den zur Verfügung stehenden literarischen Quellen wird sehr unterschiedlich über das mögliches Visionserlebnis Konstantins vor der Schlacht gegen Maxentius berichtet. In der vorliegenden Hausarbeit soll betrachtet werden, wie die christlichen Autoren Laktanz und Eusebius von Caesarea dieses Ereignis beschreiben. Dazu wird untersucht wie in diesen beiden Darstellungen, die Fragen wann, wo und wie Konstantin die Vision vor der Schlacht an der milvischen Brücke erlebt hat, beantwortet werden. Außerdem wird betrachtet, wie die Autoren das Zeichen, mit dem Konstantin gesiegt hat, darstellen.
Inhaltsverzeichnis
I Einleitung
II Konstantins Vision aus dem Jahre 312
II A) Die Darstellung bei Laktanz
II B) Die Darstellung bei Eusebius von Caesarea
III Zusammenfassung
IV Quellen- und Literaturverzeichnis
IV A) Quellen
IV B) Sekundärliteratur
I Einleitung
Am 28. Oktober des Jahres 312, besiegte Kaiser Konstantin Kaiser Maxentius in der Schlacht an der milvischen Brücke,[1] obwohl er seinem Gegner unterlegen war.[2] Bis heute beschäftigen sich die Forscher kontrovers mit der Frage, ob Konstantin diese Schlacht im Zeichen des Kreuzes geführt hat oder nicht.[3] In engem Zusammenhang damit wird auch diskutiert, ob Konstantin sich unter jenes Zeichen und damit auch unter Christi Schutz, auf Grund einer Vision bzw. eines Traumes stellte. Auch hier gehen die Forschermeinungen weit auseinander.[4] Jeder der Forscher gewichtet bei seinem Antwortversuch die zahlreich vorhandenen Quellen anders.
In den zur Verfügung stehenden literarischen Quellen wird sehr unterschiedlich über das mögliches Visionserlebnis Konstantins vor der Schlacht gegen Maxentius berichtet. In der vorliegenden Hausarbeit soll betrachtet werden, wie die christlichen Autoren Laktanz und Eusebius von Caesarea dieses Ereignis beschreiben.[5] Dazu wird untersucht wie in diesen beiden Darstellungen, die Fragen wann, wo und wie Konstantin die Vision vor der Schlacht an der milvischen Brücke erlebt hat, beantwortet werden. Außerdem wird betrachtet, wie die Autoren das Zeichen, mit dem Konstantin gesiegt hat, darstellen.
II Konstantins Visionen aus dem Jahr 312
II A) Die Darstellung bei Laktanz
Der christliche Apologet Laktanz[6], berichtet über die Schlacht an der milvischen Brücke in seinem Werk: De mortibus persecutorum.
De mortibus persecutorum, wahrscheinlich um 314/ 15 entstanden[7] und an Donatus und die christliche Gemeinde in Bithynien gerichtet[8], ist eine „tendenziöse, polemische Abrechnung mit den Feinden Gottes“[9]. Laktanz versucht mit seinem wahrscheinlich in Trier[10] vollendeten Werk zu verdeutlichen, dass Gottes Gegner noch auf der Erde für ihre Verbrechen bestraft werden.[11]
Er schreibt dort über einen Traum[12] den Konstantin „ a. d. sextum Kalendas Novembres […] in quiete “[13], also in der Nacht vom 27. Auf den 28 Oktober, folglich in der Nacht vor der Schlacht an der milvischen Brücke, hatte. In diesem wird Konstantin aufgefordert ein „caeleste signum dei“[14] auf die Schilde seiner Soldaten anzubringen. Dies macht Konstantin, indem er „transversa X littera“[15] und „summo capite circumflexo“[16].
Konstantin lässt also, laut Laktanz, ein himmlisches Zeichen Gottes an den Schildern seiner Soldaten anbringen.[17] Dieses Zeichen entsteht, indem zuerst der Buchstabe x umgelegt wird. Aus dem x wird so ein +. In einem zweiten Schritt wird seine Spitze umgebogen. Es entsteht das monogrammatische Kreuz Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten, auch Staurogramm genannt.[18]
[...]
[1] Demandt, Geschichte, S. 39.
[2] Barceló, Constantins, S. 55.
[3] So sind beispielsweise Demandt, Giradet und Thümmel der Auffassung, Konstantin habe die Schlacht von 312 im Zeichen des Kreuzes geschlagen. Demandt, Kaiser, S. 50. Giradet, Konstatin, S. 74. Thümmel, Wende, S. 183. Grégoire, Bleicken und Brandt hingegen meinen, dass die Schlacht von 312 nicht im Zeichen des Kreuzes geschlagen wurde. Grégoire,"Bekehrung", S. 201. Bleicken, Constantin, S. 33. Brandt, Konstantin S. 54f.; S. 59.
[4] Barceló und Demandt sind der Ansicht die Visionen sind von Konstantin zu politischen Zwecken erfunden und von ihm persönlich in Umlauf gesetzt worden. Sie standen mit seinen militärischen Siegen, sowie mit der Befestigung und Legitimation seiner Herrschaft in Zusammenhang. Seine Schutzgottheit wandelt sich von Herkules über Sol Invictus zu Christus. Vgl. Barceló, Constantins, S. 59f. und Demandt, Kaiser, S. 59. Giradet und Weiß hingegen erklären die Vision mit Hilfe eines physikalischen Naturphänomens. So habe Konstantin 310 eine Himmelserscheinung, in deren Mittelpunkt die Sonne stand, einen sogenannten „Ringhalo“ gehabt. Diese wurde zunächst als Apollovision von einem heidnischen Panegyriker und dann als Christusvision bei Laktanz gedeutet. Giradet, Konstantin, S. 72f.
[5] Neben den vorgestellten Autoren, gibt es auch eine Darstellung aus dem Jahre 313 im 12. Panegyricus und aus dem Jahre 321 bei Nazarius. Rosen, Cor, S. 256f.
[6] Heck, Laktanz, S. 399.
[7] Ebd., S. 401.
[8] Städele, mortibus, S. 75. Eine weitere Theorie besagt, dass Laktanz diese Schrift als Bewerbungsschreiben an Konstantin verfasst hat. Ebd., S. 76.
[9] Ebd., S. 75.
[10] Demandt, Kaiser, S. 49.
[11] Ebd. S.32f.
[12] Rosen, Cor, S. 258.
[13] Lact., De mort. pers. 44,4f.
[14] Ebd. 44,5.
[15] Ebd. 44,5.
[16] Ebd. 44,5.
[17] Giradet geht davon aus, dass aus praktischen Gründen das Zeichen „nur auf den Schilden der Eliteeinheit angebracht“ wurde. Giradet, Konstantin, S. 74. Auch Demandt ist der Auffassung, dass Konstantin „einigen Soldaten“ das Zeichen auf die Schilde malen ließ. Demandt, Geschichte, S. 40. Rosen behauptet, dass Konstantin den Christen erlaubte ein Zeichen Christi auf ihre Schilde zu malen, es aber nicht zu Pflicht machte. Rosen, Cor, S. 258. Grégoire hingegen ist der Auffassung, dass sich zwar ein X auf den Schilden der Soldaten befunden habe, dieses X allerdings als heidnisches Symbol der vota publica verstanden werden muss, dem Laktanz eine christliche Deutung gibt. Grégoire, „Bekehrung“, S. 206f. Auch Brandt findet es unglaubwürdig, dass Konstantin seinen Soldaten in der Kürze noch ein Zeichen auf die Schilde malen ließ. Brandt, Konstantin, S. 54f.
[18] Vogt, Frage, S. 363 und Thümmel, Wende, S. 158. Einige Forscher vertreten aber auch die Ansicht, dass Laktanz mit dem „caeleste signum dei“ das aus den griechischen Anfangsbuchstaben von Christus, also Chi (X) und Rho (P) bestehende Christogramm meint. Folglich sehe das Zeichen so aus. Giradet, Konstantin, S. 73f. und Demandt, Geschichte, S. 40.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2012, Konstantins Vision vor der Schlacht an der milvischen Brücke. Die Darstellungen bei Laktanz und Eusebius von Caesarea, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/210272