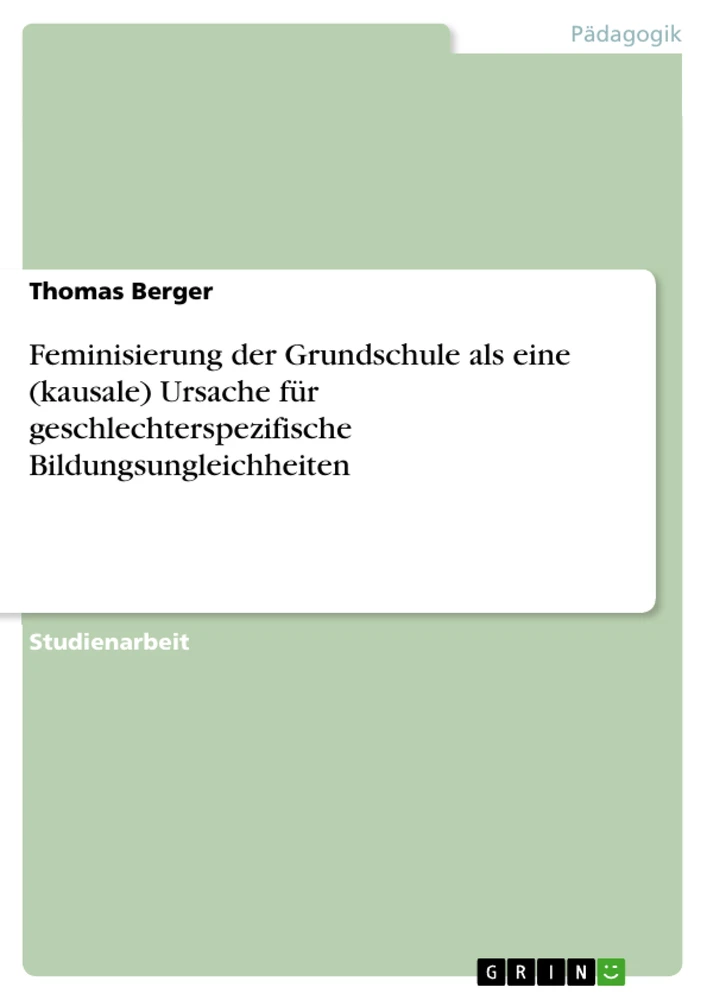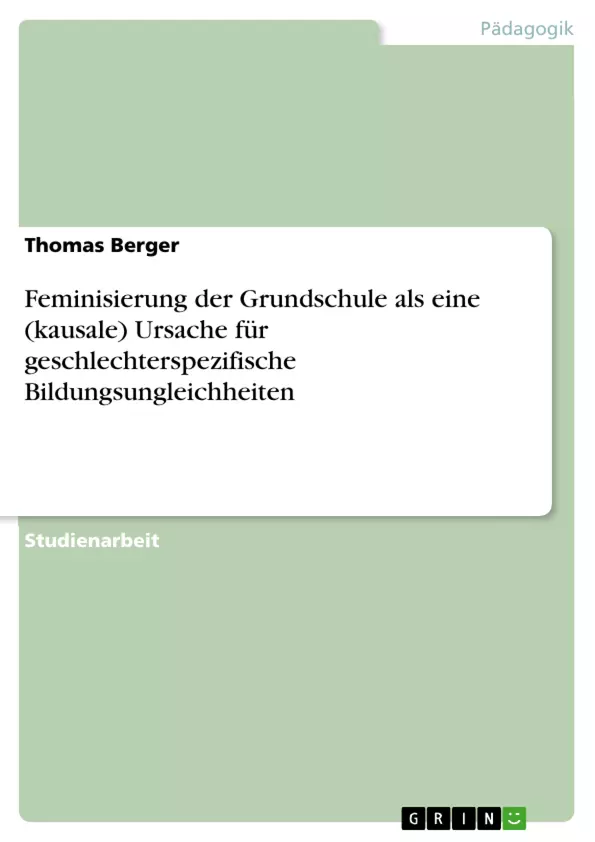Einleitung
Noch bis vor wenigen Jahren galt das katholische Arbeitermädchen vom Land als Inbegriff für Bildungsbenachteiligung (vgl. Boldt 2008, S. 136). 1953 waren in Deutschland nur etwa 30 Prozent der Abiturienten weiblichen Geschlechts. Diverse Trendstatistiken zeigen jedoch, dass es in den letzten Jahren zu einem geschlechtsspezifischen Wandel in Bezug auf den Bildungserfolg gekommen ist, von dem nicht nur das deutsche Bildungssystem betroffen ist. In Deutschland stieg der Anteil der weiblichen Abiturien seit etwa Mitte der 50er Jahre kontinuierlich an, was zur Folge hatte, dass bereits 1980 im bundesdeutschen Durchschnitt ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Jungen und Mädchen an den Gymnasien vorherrschte. Gleiches gilt für den Anteil weiblicher Lehrer an den deutschen Schulen. Lag dieser an allgemeinbildenden Schulen noch vor etwa 60 Jahren bei ca. 35 Prozent, beträgt er heute über 70 Prozent (vgl. Neugebauer 2011, S. 235). Dieser Wandel ist besonders gut an den deutschen Grundschulen zu beobachten. Hier beträgt der Anteil des weiblichen Lehrpersonals inzwischen ca. 86 Prozent (vgl. Preuss-Lausitz 2008, S. 125). Es ist in diesem Zusammenhang bemerkenswert, dass seit Anfang der 90er Jahre mehr Mädchen als Jungen das Gymnasium erfolgreich abschließen. Abbildung 1 bezieht sich auf die bisher beschrieben Entwicklungen und verdeutlicht zudem, dass bereits 2007 56 Prozent aller Abiturienten weiblich waren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Thematik und Erkenntnisinteresse
- Vorgehensweise
- Argumentationslinien der Feminisierungsthese
- „Die Feminisierungsthese“ und ihre theoretischen Aspekte
- Entwicklung und Problemabriss von Jungen im Grundschulalter
- Gegenstimmen zur Feminisierungsthese
- Die Feminisierungsthese auf dem „Prüfstand“
- Aktueller Forschungsstand zur Feminisierungsthese
- Die Grundschulempfehlung als möglicher Indikator für die Widerlegung der Feminisierungsthese
- Die Feminisierung der Schule und deren Auswirkungen auf die Grundschulempfehlung
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, ob die Feminisierung der Grundschule eine (kausale) Ursache für geschlechterspezifische Bildungsungleichheiten darstellt. Im Zentrum der Analyse steht die Hypothese, dass der gestiegene Frauenanteil im Lehrerberuf zu einem schlechteren Abschneiden von Jungen führt.
- Feminisierung der Grundschule als Ursache für Bildungsungleichheiten
- Theoretische Aspekte der Feminisierungsthese
- Entwicklung und Problematik von Jungen im Grundschulalter
- Aktueller Forschungsstand zur Feminisierungsthese
- Die Grundschulempfehlung als Indikator für die Widerlegung der Feminisierungsthese
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung skizziert den aktuellen Stand der geschlechterspezifischen Bildungsungleichheiten in Deutschland. Sie zeigt den Wandel von der Bildungsbenachteiligung von Mädchen hin zu einer scheinbar schlechteren Bildungssituation für Jungen auf.
Kapitel 2 stellt die Feminisierungsthese als mögliche Erklärung für diese Entwicklung vor. Es werden sowohl die theoretischen Aspekte der Theorie als auch die Entwicklung und Problematik von Jungen im Grundschulalter beleuchtet.
Kapitel 3 widmet sich den Gegentheorien zur Feminisierungsthese.
Kapitel 4 setzt die Feminisierungsthese „auf den Prüfstand“ und analysiert den aktuellen Forschungsstand. Es wird der Zusammenhang zwischen der Feminisierung der Schule und der Grundschulempfehlung untersucht.
Die Schlussbetrachtung (ohne Spoiler) zieht eine vorläufige Bilanz der Argumentation.
Schlüsselwörter
Feminisierungsthese, geschlechterspezifische Bildungsungleichheiten, Grundschule, Grundschulempfehlung, Lehrerberuf, Jungen, Mädchen, Bildungsmisserfolg, empirische Forschung, Bildungspolitik.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die zentrale Forschungsfrage dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht, ob die Feminisierung der Grundschule (der hohe Anteil an Lehrerinnen) eine kausale Ursache für den Bildungsmisserfolg von Jungen ist.
Wie hoch ist der Anteil weiblicher Lehrkräfte an deutschen Grundschulen?
Laut der Arbeit beträgt der Anteil des weiblichen Lehrpersonals an Grundschulen inzwischen ca. 86 Prozent.
Was besagt die „Feminisierungsthese“?
Die These postuliert, dass das Überwiegen von Frauen im Lehrberuf zu geschlechtsspezifischen Bildungsungleichheiten führt, von denen Jungen negativ betroffen sind.
Welche Rolle spielt die Grundschulempfehlung in der Untersuchung?
Die Grundschulempfehlung dient als Indikator, um die Feminisierungsthese auf den Prüfstand zu stellen und mögliche Auswirkungen des Lehrergeschlechts zu analysieren.
Wie hat sich der Anteil weiblicher Abiturienten historisch entwickelt?
Lag der Anteil 1953 noch bei 30 Prozent, stieg er bis 2007 auf 56 Prozent an, womit Mädchen Jungen beim Gymnasialabschluss überholt haben.
- Quote paper
- Thomas Berger (Author), 2012, Feminisierung der Grundschule als eine (kausale) Ursache für geschlechterspezifische Bildungsungleichheiten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/210577