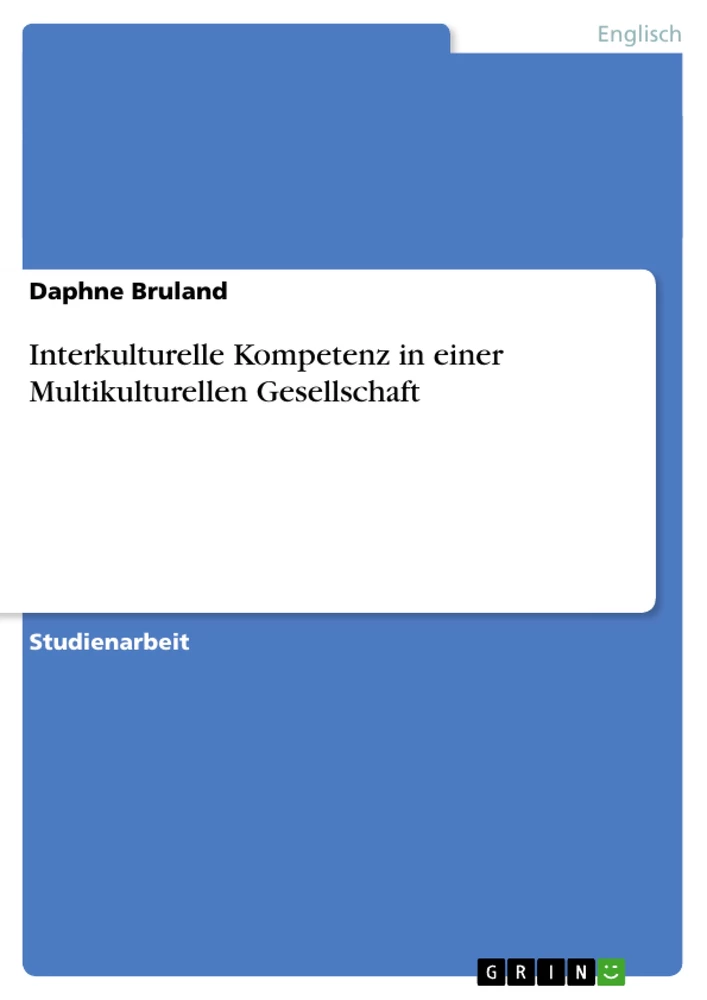Deutschland ist seit Jahrzehnten Zielland von Zuwanderern aus unterschiedlichen Herkunftsländern, „der Fremde“ und die Erfahrung der Fremdheit ist für viele Menschen längst ein Teil ihres Alltags geworden, ob am Arbeitsplatz, im Sportverein, im Krankenhaus oder in der Schule, die in diesem Sinne ein Spiegelbild der Gesellschaft darstellt und neben den Konflikten und Problemen des Zusammenlebens von Menschen unterschiedlicher Herkunft auch neue Chancen eines Miteinander eröffnen kann. Die folgende Arbeit soll sich mit der multikulturellen Zusammensetzung der Gesellschaft mit Schwerpunkt Deutschland beschäftigen und die Notwendigkeit der interkulturellen Erziehung aufzeigen. Es soll gezeigt werden, dass interkulturelles Lernen nicht nur in der Fremdsprachendidaktik, in deren Zusammenhang es meist diskutiert wird, eine Rolle spielt, sondern für die Didaktik generell und für das Funktionieren einer multikulturellen Gesellschaft wichtig ist. Hierzu sollen Zielvorstellungen und Konzepte zum interkulturellen Lernen vorgestellt werden. Außerdem soll anschließend auf die Nutzungsmöglichkeiten von multikulturellen Texten im Fremdsprachenunterricht eingegangen werden. Anhand von Ansgar Nünnings1 Aufsatz „Fremdverstehen durch literarische Texte“ soll gezeigt werden, dass mit Hilfe von multiethnischer Literatur ein lebensweltliches Fremdverstehen gefördert werden kann. Trotz der sehr umfangreichen Literatur zu dieser Thematik und den zahlreichen Konzepten zur interkulturellen Erziehung ist dieser Bereich noch nicht erschöpft, und es bedarf noch mehr Untersuchungen vor allem zur Umsetzung der Zielvorstellungen. Mit anderen Worten ist die theoretische Erforschung der Thematik sehr umfangreich, doch mangelt es an praxisnahen Vorschlägen zur Umsetzung der theoretischen Ansätze. Aus diesem Grunde habe ich mich mit Ansgar Nünnings praxisorientierten Vorschlägen zum interkulturellen Fremdsprachenunterricht beschäftigt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Multikulturalität und multikulturelle Gesellschaft
- Multikulturalität in Deutschland
- Migration in Deutschland – einige Fakten
- Von der Ausländerpädagogik zur interkulturellen Erziehung
- Interkulturelles Lernen und interkulturelle Erziehung
- Zur Begrifflichkeit
- Interkulturelles Lernen als soziales und politisches Lernen
- Aufgaben von interkulturellem Lernen
- Fremdverstehen durch literarische Texte
- Multikulturelle Literatur
- Wie ist Fremdverstehen lehr- und lernbar?
- Perspektivenübernahme und Perspektivenwechsel
- Zur methodischen Umsetzung
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der multikulturellen Zusammensetzung der deutschen Gesellschaft und verdeutlicht die Notwendigkeit der interkulturellen Erziehung. Sie zeigt, dass interkulturelles Lernen nicht nur in der Fremdsprachendidaktik relevant ist, sondern für die Didaktik im Allgemeinen und für das Funktionieren einer multikulturellen Gesellschaft von großer Bedeutung ist. Die Arbeit stellt Zielvorstellungen und Konzepte zum interkulturellen Lernen vor und beleuchtet anschließend die Möglichkeiten der Nutzung multikultureller Texte im Fremdsprachenunterricht.
- Die multikulturelle Zusammensetzung der deutschen Gesellschaft
- Die Notwendigkeit der interkulturellen Erziehung
- Zielvorstellungen und Konzepte zum interkulturellen Lernen
- Die Nutzung multikultureller Texte im Fremdsprachenunterricht
- Fremdverstehen durch literarische Texte
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas „Interkulturelle Kompetenz in einer Multikulturellen Gesellschaft“ dar und erläutert den Fokus der Arbeit auf die Rolle der interkulturellen Erziehung in Deutschland. Sie argumentiert für die Bedeutung des interkulturellen Lernens in der Didaktik und im gesellschaftlichen Zusammenleben.
Multikulturalität und multikulturelle Gesellschaft
Dieses Kapitel definiert den Begriff „Multikulturalität“ und beschreibt die Herausforderungen und Chancen des Zusammenlebens unterschiedlicher Kulturen. Es beleuchtet den historischen und gesellschaftlichen Kontext der Multikulturalität in Deutschland, insbesondere im Hinblick auf die Migration.
Interkulturelles Lernen und interkulturelle Erziehung
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Konzept des interkulturellen Lernens und der interkulturellen Erziehung. Es beleuchtet die Begrifflichkeit und die Bedeutung des interkulturellen Lernens als soziales und politisches Lernen. Darüber hinaus werden wichtige Aufgaben und Ziele des interkulturellen Lernens vorgestellt.
Fremdverstehen durch literarische Texte
Dieses Kapitel untersucht die Möglichkeiten des Fremdverstehens durch literarische Texte im Kontext der interkulturellen Bildung. Es beleuchtet die Rolle der multikulturellen Literatur und stellt didaktische Ansätze für das Fremdverstehen vor. Dazu gehören insbesondere die Perspektivenübernahme und der Perspektivenwechsel.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die zentralen Themen der Multikulturalität, interkulturellen Kompetenz, interkulturellen Erziehung und Fremdverstehen durch literarische Texte. Wichtige Konzepte sind dabei das Zusammenleben verschiedener Kulturen, die Bewältigung von kulturellen Unterschieden, die Förderung von Toleranz und Verständnis sowie die Nutzung von multikulturellen Texten im Bildungsprozess. Des Weiteren werden Aspekte der Migration, der Ausländerpädagogik, der Didaktik und der Fremdsprachendidaktik behandelt.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel interkultureller Erziehung?
Ziel ist die Förderung von Toleranz, Verständnis und der Fähigkeit zum Miteinander in einer multikulturellen Gesellschaft.
Wie kann Literatur beim Fremdverstehen helfen?
Durch literarische Texte können Leser Perspektiven übernehmen und einen Wechsel der Sichtweise vollziehen, was das Verständnis für andere Kulturen schärft.
Was ist der Unterschied zwischen Ausländerpädagogik und interkultureller Erziehung?
Ausländerpädagogik war oft defizitorientiert, während interkulturelle Erziehung die Vielfalt als Chance für alle Lernenden begreift.
Warum ist interkulturelles Lernen auch für die Politik wichtig?
Es wird als Form des sozialen und politischen Lernens verstanden, das für das Funktionieren einer modernen Demokratie unerlässlich ist.
Welche Rolle spielt Ansgar Nünning in dieser Arbeit?
Sein Aufsatz liefert praxisnahe Vorschläge, wie Fremdverstehen durch multiethnischer Literatur im Unterricht gefördert werden kann.
- Citation du texte
- Daphne Bruland (Auteur), 2002, Interkulturelle Kompetenz in einer Multikulturellen Gesellschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/21078