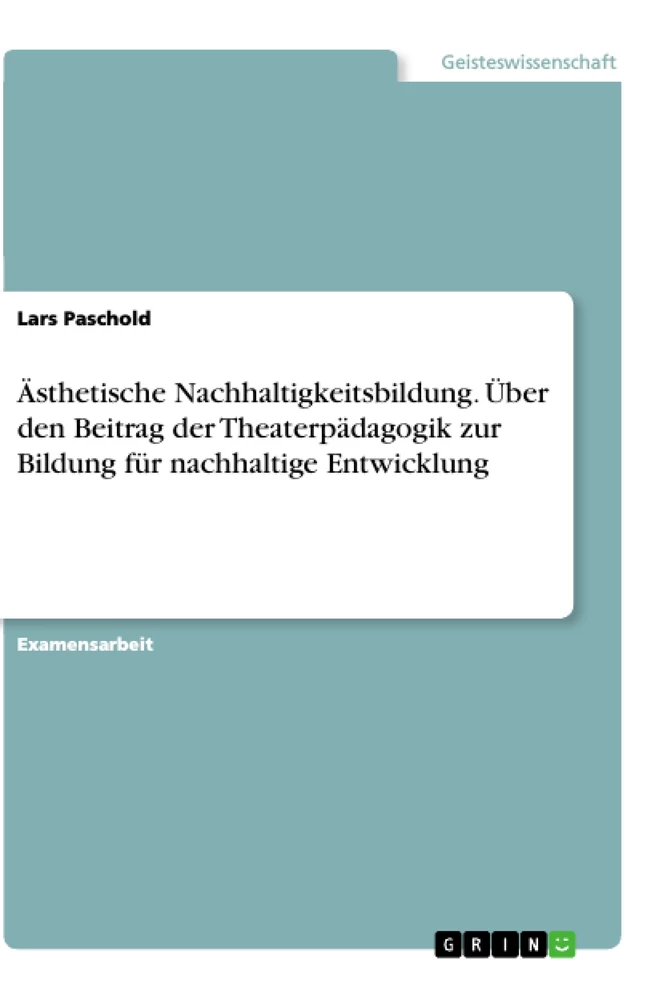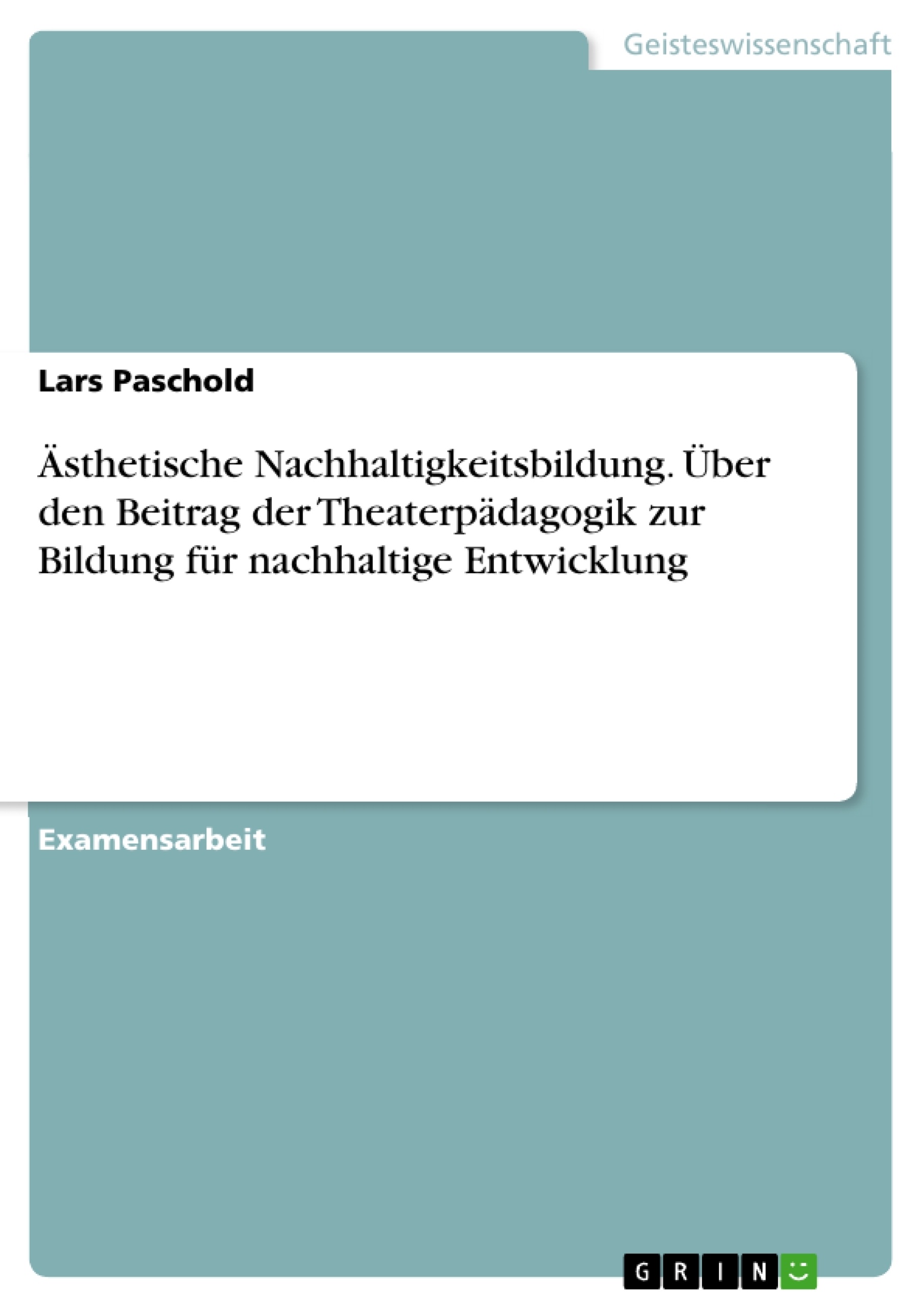Ausgehend von der Erfahrung des Autors, dass das Medium Theater allzu schnell als Heilmittel für alle möglichen außerästhetischen Probleme instrumentalisiert wird, begibt er sich ganz bewusst auf die Suche nach den Bildungschancen und Bildungsprinzipien, die sich aus der zweckfreien und handelnden Auseinandersetzung von Menschen mit der spezifischen Mate-rialität des Theaters ergeben und die zugleich einer „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ zu eigen sind.
Dabei deckt der Autor unter Nutzung einer quantitativen Inhaltsanalyse Bildungschancen und Bildungsprinzipien auf, die sowohl der systemisch-konstruktivistischen Didaktik, der „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ als auch der ästhetischen Bildung inhärent sind. Als zentral für eine gelingende Ästhetische Nachhaltigkeitsbildung erweisen sich dabei die ergebnisoffene Auseinandersetzung der Spieler mit einem für „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ geeigneten Thema innerhalb des ästhetischen Raums, die ästhetische Gestaltung der dabei gemachten Erfahrungen und Erkenntnisse, deren anschließende öffentliche Präsentation sowie die prozessbegleitende Reflexion. Zusammengefasst und konkretisiert werden die Ergebnisse der Arbeit in Empfehlungen für einen Theaterworkshop.
Wird Ästhetische Nachhaltigkeitsbildung damit doch zum Heilmittel für eine postmoderne, nichtnachhaltige Gesellschaft? Nein, in dieser Arbeit werden nur die Möglichkeiten und Chancen, welche sich aus der Ästhetische Nachhaltigkeitsbildung ergeben können, aufgezeigt. Zugleich weist der Autor sehr deutlich darauf hin, dass diese durch pädagogisches Handeln nur ermöglicht, aber nicht erzeugt werden können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemlage
- Ziel, zentrale Fragestellung und Aufbau der Arbeit
- Einflüsse von Postmoderne, Konstruktivismus und neurobiologischer Erkenntnisse auf Bildung
- Postmoderne
- Systemtheoretischer Zugang
- Konstruktivismus
- Neurobiologische Erkenntnisse
- Auswirkungen auf die Bildungsarbeit
- Bildung für nachhaltige Entwicklung
- Nachhaltige Entwicklung im Verhältnis zu Bildung und Kunst
- Didaktische Ausgestaltung der „Bildung für nachhaltige Entwicklung“
- Leitziel Gestaltungskompetenz
- Didaktische Prinzipien
- Themen
- Ästhetische Bildung
- Bildung und Ästhetik
- Bildung
- Aisthetik, Ästhetik, Anästhetik
- Theaterpädagogik als ästhetische Bildung
- Ästhetisch bildende Aspekte theatraler Gestaltung
- Der ästhetische Raum
- Differenzerfahrung zwischen Spieler und Figur
- Differenzerfahrung zwischen Gestalten und Erleben
- Differenzerfahrung zwischen Bühne und Publikum
- Differenzerfahrung zwischen Körper-Haben und Körper-Sein
- Differenzerfahrung zwischen Sinn und Sinnlichkeit
- Das Thema
- Die Inszenierung
- Erfahrungsfähigkeit und Selbstvergessenheit
- Handeln zwischen Vorausgegangenem und Folgendem
- Darstellung des Nicht-Darstellbaren
- Involviertheit, Distanziertheit und Selbstausdruck
- Die Reflektion
- Wirkbereiche ästhetischer Bildung
- Bildung des Ästhetischen
- Selbstbildung
- Soziale Bildung
- Die Bedeutung der Postmoderne und des Konstruktivismus für Bildungsprozesse
- Die Rolle der Systemtheorie in der Analyse sozialer Wirklichkeit
- Die didaktischen Prinzipien der "Bildung für nachhaltige Entwicklung"
- Ästhetische Bildung und das Potenzial des Theaterspielens
- Die Bildungswirksamkeit des ästhetischen Raums
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit zielt darauf ab, Kriterien einer ästhetischen Nachhaltigkeitsbildung auf systemisch-konstruktivistischer Grundlage zu formulieren und daraus Empfehlungen für einen Theaterworkshop abzuleiten. Hierbei werden die Folgen der Postmoderne, des Konstruktivismus und neurobiologischer Erkenntnisse für ein modernes Bildungsverständnis betrachtet, welches auch für die "Bildung für nachhaltige Entwicklung" und die ästhetische Bildung relevant ist. Die Arbeit untersucht, wie das Theaterspielen die Ziele der "Bildung für nachhaltige Entwicklung" unterstützen kann, ohne dabei instrumentalisiert zu werden.
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel zwei erläutert die Auswirkungen von Postmoderne, Systemtheorie, Konstruktivismus und neurobiologischen Erkenntnissen auf die Bildung, insbesondere im Hinblick auf die "Bildung für nachhaltige Entwicklung". Kapitel drei beleuchtet die Inhalte, Methoden und Ziele der "Bildung für nachhaltige Entwicklung" und stellt zentrale didaktische Prinzipien vor. Kapitel vier konzentriert sich auf das ästhetische Potenzial des Theaterspielens, untersucht die Bildungswirksamkeit des ästhetischen Raums und die Rolle von Wahrnehmung und Selbstausdruck im theatralen Prozess. Die Ergebnisse der Kapitel zwei, drei und vier werden in Kapitel fünf zusammengefasst und auf die Fragestellungen der Arbeit rückbezogen.
Schlüsselwörter
Ästhetische Bildung, Bildung für nachhaltige Entwicklung, Theaterpädagogik, Systemisch-konstruktivistische Didaktik, Postmoderne, Konstruktivismus, Neurobiologie, Gestaltungskompetenz, ästhetischer Raum, Differenzerfahrung, Inszenierung, Reflexion, Selbstbildung, Soziale Bildung, nachhaltige Entwicklung, Nachhaltigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Ästhetische Nachhaltigkeitsbildung?
Ein Bildungsansatz, der die Methoden der ästhetischen Bildung (z. B. Theaterpädagogik) nutzt, um die Ziele der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) erfahrbar zu machen.
Wie kann Theaterpädagogik zur Nachhaltigkeit beitragen?
Durch das Einnehmen verschiedener Perspektiven im „ästhetischen Raum“ können Spieler systemische Zusammenhänge und globale Herausforderungen spielerisch reflektieren.
Was bedeutet „systemisch-konstruktivistische Didaktik“?
Dieser Ansatz geht davon aus, dass Wissen nicht einfach übertragen werden kann, sondern dass Lernende ihre Wirklichkeit aktiv selbst konstruieren, was durch kreative Prozesse unterstützt wird.
Was ist das Ziel der Gestaltungskompetenz?
Gestaltungskompetenz ist das Kernziel der BNE. Sie befähigt Menschen dazu, Veränderungen in komplexen Systemen aktiv mitzugestalten und nachhaltige Entscheidungen zu treffen.
Wird Theater hier als bloßes „Heilmittel“ instrumentalisiert?
Nein, die Arbeit betont die Zweckfreiheit der Kunst. Theater bietet Chancen zur Bildung, darf aber nicht rein als Werkzeug für außerästhetische Probleme missbraucht werden.
- Arbeit zitieren
- Lars Paschold (Autor:in), 2012, Ästhetische Nachhaltigkeitsbildung. Über den Beitrag der Theaterpädagogik zur Bildung für nachhaltige Entwicklung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/211539