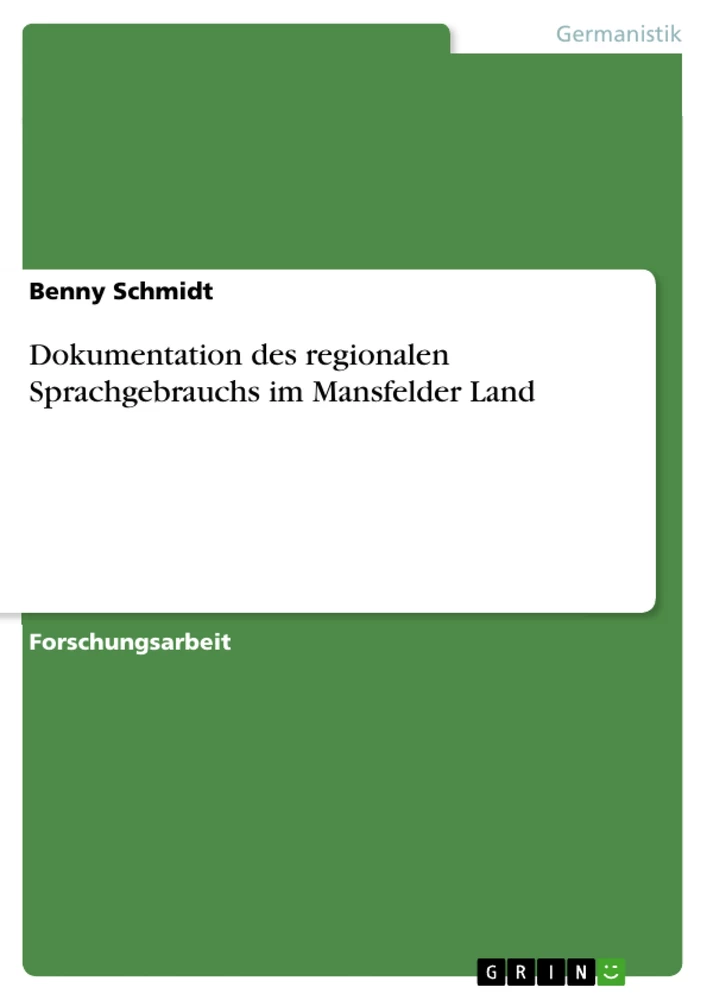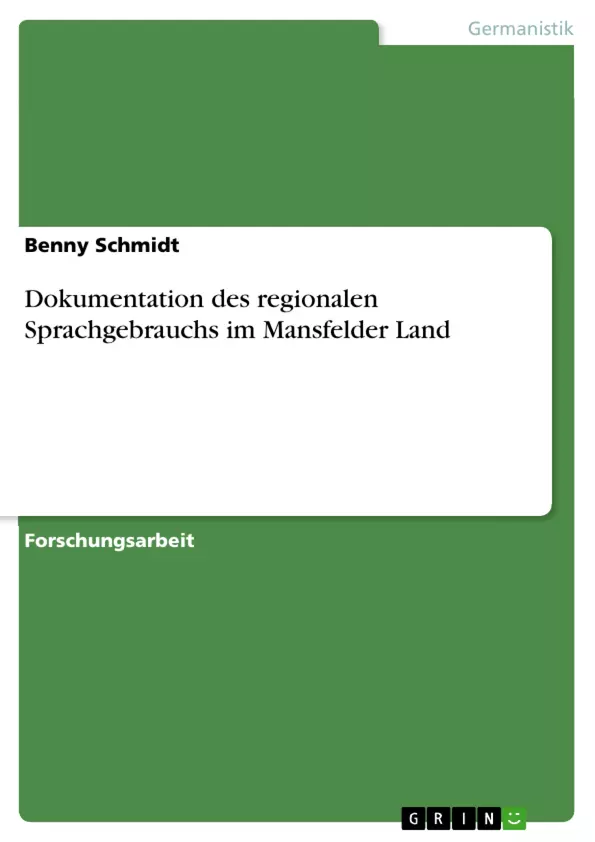Unsere Sprache ist stets im Wandel und verändert sich kontinuierlich. Das wird nicht immer sofort deutlich und zudem geschehen solche Veränderungen meist unbewusst und erfolgen über einen langen Zeitraum, sodass der erfolgte Wandel nicht unmittelbar wahrgenommen wird. Täglich wird man mit ihr, der Sprache, konfrontiert und nicht selten ergeben sich Situationen, in denen nicht immer gleich klar wird, was zum Beispiel in einem Gespräch der Sender beabsichtigte, dem Empfänger mit seiner Nachricht mitzuteilen.
So spricht man vom „Deutschen“ und meint in der Regel damit den überregionalen, kodifizierten und in unterschiedlichsten Werken dokumentierten Standard dieser Sprache der schriftlich und mündlich wiedergegeben wird. Daneben existieren jedoch auch eine große Anzahl an regionalen Varietäten, den Dialekten. Diese sind weit weniger auf dem Papier oder in anderer Form schriftlich festgehalten als das Standarddeutsch. Sie werden viel mehr tradiert, mündlich übertragen und treten im allgemeinen Sprachgebrauch auf. Viele Veränderungen im Vergleich zum Standard zielen dabei zuallererst auf eine Sprachökonomie. Kraft, Aufwand und Energie werden reduziert und dabei dennoch die gewünschten Informationen in der Mitteilung übertragen.
Wie bei den Sprachen gibt es auch beim Vergleich unterschiedlicher Dialekte bestimmte Wörter für beispielsweise einzelne Sachverhalte oder Gegenstände, die in einer anderen Region gänzlich unbekannt sind und demzufolge auch keine Anwendung finden können. So ist die Verständlichkeit innerhalb ein und derselben Region in der Regel ohne große Probleme möglich, außerhalb derselbigen kann es allerdings zu Missverständnissen und Verständigungsproblemen kommen.
Die Verschiedenartigkeit der Dialekte entsteht aufgrund mehrere Faktoren. Wichtig ist dabei unter anderem die historische Entwicklung der Region, durch die sie geprägt wurde. Ferner sind wirtschaftliche Bedingungen ausschlaggebend, die sich ihrerseits auch auf die Arbeit der dort ansässigen Menschen auswirken. Die Tätigkeiten der Bewohner eines Gebietes bestimmen ebenso die Sprache und den Sprachgebrauch. Auch finden sprachliche Entwicklungsprozesse in Abhän-gigkeit vom Bildungsstand statt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Forschungsgebiet
- 3 Forschungsmethode
- 4 Übersicht der Sprecher
- 5 Fragebogen und untersuchte Laute
- 6 Auswertung der Sprachdatenerhebung
- 6.1 Realisierung des g mit darauf folgendem Vokal
- 6.2 Realisierung des ei
- 6.3 Realisierung der Konsonantenverbindung nd/nt im Inlaut
- 6.4 Realisierung des intervokalischen b
- 6.5 Realisierung des ü und ö im Inlaut
- 7 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit dokumentiert den regionalen Sprachgebrauch im Mansfelder Land. Ziel ist es, eine Momentaufnahme des „Mansfeldischen“ Dialekts zu liefern und dessen Besonderheiten im Vergleich zum Standarddeutschen zu untersuchen. Die Untersuchung fokussiert auf ausgewählte Laute und deren Realisierung im regionalen Sprachgebrauch.
- Beschreibung des „Mansfeldischen“ Dialekts
- Untersuchung der sprachlichen Variation im Mansfelder Land
- Vergleich des regionalen Sprachgebrauchs mit dem Standarddeutschen
- Analyse der Faktoren, die die sprachliche Entwicklung im Mansfelder Land beeinflusst haben
- Dokumentation der Forschungsmethode (direkte Enquête)
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beschreibt den ständigen Wandel der Sprache und die Herausbildung von Dialekten als regionale und soziale Varietäten. Sie führt in die Thematik der Sprachvariation ein und erläutert die Heterogenität des Deutschen. Die Arbeit zielt auf die Dokumentation des „Mansfeldischen“ Dialekts als Momentaufnahme des Sprachwandels ab, wobei die Einschränkungen durch den zeitlich begrenzten Untersuchungszeitraum hervorgehoben werden.
2 Forschungsgebiet: Dieses Kapitel beschreibt das Mansfelder Land in Sachsen-Anhalt als Forschungsgebiet. Es betont die geographische Lage, wichtige Städte (Mansfeld, Eisleben), und die historische Entwicklung der Region, insbesondere die Bedeutung des Bergbaus (Kupfer, Braunkohle) und die damit verbundenen Auswirkungen auf den Sprachgebrauch. Die Sonderstellung des „Mansfeldischen“ Dialekts innerhalb des Nordostthüringischen wird herausgestellt.
3 Forschungsmethode: Hier wird die angewandte Forschungsmethode, die direkte Enquête mithilfe eines Fragebogens mit zehn Sätzen, detailliert beschrieben. Die Vorteile dieser Methode, wie die Möglichkeit von Nachfragen, werden hervorgehoben. Die Auswahl der Sätze und die Vorgehensweise bei der Datenerhebung werden erläutert, um die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Untersuchung zu gewährleisten.
Schlüsselwörter
Mansfeldisch, Dialektologie, Sprachvariation, regionale Sprache, Sachsen-Anhalt, Sprachdatenerhebung, direkte Enquête, Nordostthüringisch, Standarddeutsch, Sprachwandel, Bergbauregion.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Studie: "Der Mansfelder Dialekt"
Was ist der Gegenstand dieser Studie?
Diese Arbeit untersucht den regionalen Sprachgebrauch im Mansfelder Land, Sachsen-Anhalt. Ihr Ziel ist die Dokumentation des „Mansfeldischen“ Dialekts und der Vergleich seiner Besonderheiten zum Standarddeutschen. Der Fokus liegt auf der Analyse ausgewählter Laute und ihrer Realisierung im regionalen Sprachgebrauch.
Welche Themen werden in der Studie behandelt?
Die Studie behandelt die Beschreibung des „Mansfeldischen“ Dialekts, die Untersuchung der sprachlichen Variation im Mansfelder Land, den Vergleich des regionalen Sprachgebrauchs mit dem Standarddeutschen, die Analyse der Einflussfaktoren auf die sprachliche Entwicklung der Region und die Dokumentation der angewandten Forschungsmethode (direkte Enquête).
Welche Methode wurde zur Datenerhebung verwendet?
Die Studie verwendet die Methode der direkten Enquête mit einem Fragebogen, der zehn Sätze enthält. Die Vorteile dieser Methode, wie die Möglichkeit von Nachfragen, werden hervorgehoben. Die Auswahl der Sätze und die Vorgehensweise bei der Datenerhebung werden detailliert erläutert.
Welche Aspekte des Mansfelder Dialekts werden untersucht?
Die Auswertung der Sprachdaten konzentriert sich auf die Realisierung folgender Laute: g mit folgendem Vokal, ei, die Konsonantenverbindung nd/nt im Inlaut, intervokalisches b, sowie ü und ö im Inlaut.
Wie ist die Studie strukturiert?
Die Studie ist in sieben Kapitel gegliedert: Einleitung, Forschungsgebiet, Forschungsmethode, Übersicht der Sprecher (nicht detailliert im Preview), Fragebogen und untersuchte Laute, Auswertung der Sprachdatenerhebung (inkl. detaillierter Analyse der oben genannten Laute) und Fazit.
Wo liegt das geographische Forschungsgebiet?
Das Forschungsgebiet ist das Mansfelder Land in Sachsen-Anhalt, inklusive wichtiger Städte wie Mansfeld und Eisleben. Die historische Entwicklung der Region, insbesondere die Bedeutung des Bergbaus, und die damit verbundenen Auswirkungen auf den Sprachgebrauch werden berücksichtigt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Studie am besten?
Schlüsselwörter sind: Mansfeldisch, Dialektologie, Sprachvariation, regionale Sprache, Sachsen-Anhalt, Sprachdatenerhebung, direkte Enquête, Nordostthüringisch, Standarddeutsch, Sprachwandel, Bergbauregion.
Welche Einschränkungen weist die Studie auf?
Die Studie hebt die Einschränkungen hervor, die sich aus dem zeitlich begrenzten Untersuchungszeitraum ergeben und somit nur eine Momentaufnahme des Sprachwandels liefern kann.
Was ist das Fazit der Studie (ohne detaillierte Ergebnisse)?
Das Fazit der Studie wird im siebten Kapitel präsentiert und fasst die Ergebnisse der Untersuchung des Mansfelder Dialekts zusammen (Detaillierte Ergebnisse sind nicht im Preview enthalten).
Wo kann ich die vollständige Studie einsehen?
Die vollständige Studie ist nicht im Rahmen dieses HTML-Previews verfügbar. Weitere Informationen zur vollständigen Studie sind nicht enthalten.
- Quote paper
- Benny Schmidt (Author), 2010, Dokumentation des regionalen Sprachgebrauchs im Mansfelder Land, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/211806