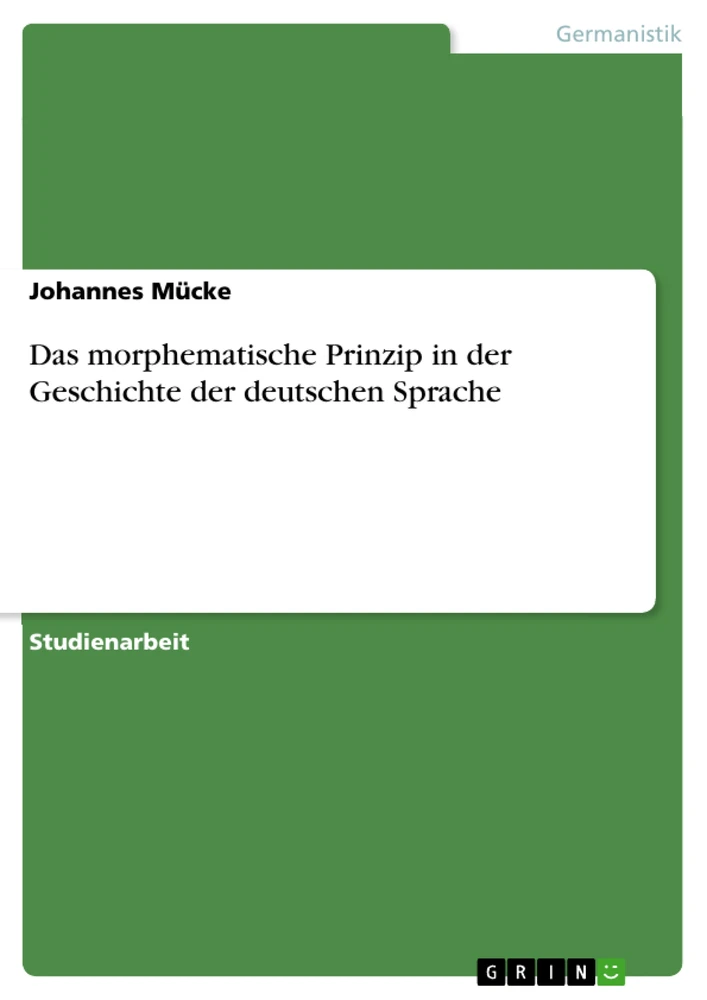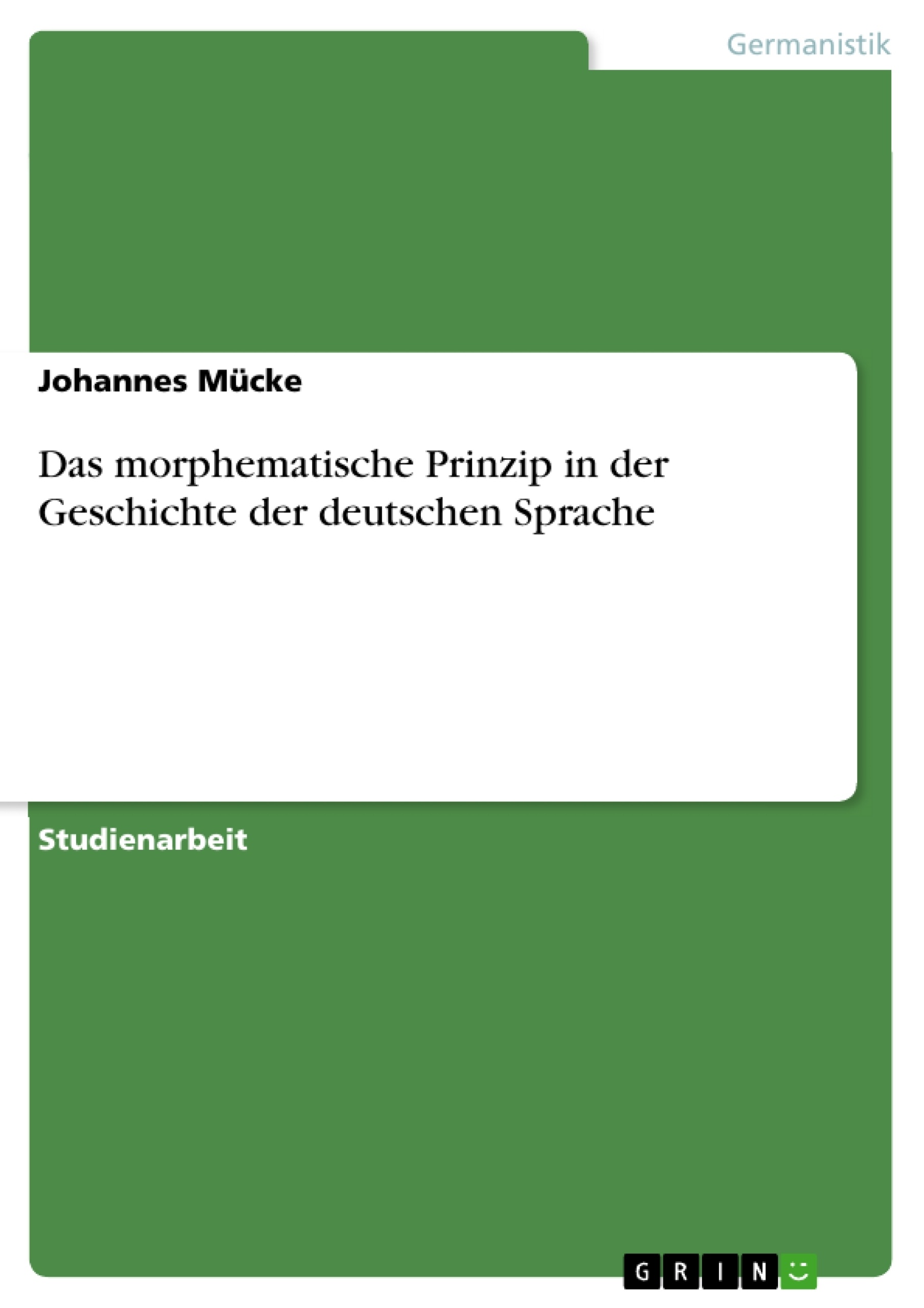„Das morphematische Prinzip dient der graphischen Kennzeichnung der Identität eines Morphems ungeachtet phonologischer Abwandlungen durch Flexion und Wortbildung. Die graphische Konstanz oder graphische Ähnlichkeit (Umlautzeichen) dient der leichteren Sinnerfassung konstanter semantischer Einheiten beim Lesen“. Diese Definition des morphematischen Prinzips formuliert klar, was unter selbigem zu verstehen ist. Die Hauptaufgabe des morphematischen Prinzips ist folglich die morphemidentifizierende Funktion dieses Prinzips. Dies stellt eine immense Erleichterung für die Schreiberinnen und Schreiber dar, weil somit die korrekte Schreibung eines Wortes nicht aus der „Lautung zu ermitteln ist“, sondern im „Allgemeinen auf bereits gespeicherte […], graphische Erinnerungsbilder“ zurückgreift. Neben der morphemidentifizierenden Funktion kann auch eine morphemdifferenzierende Funktion festgestellt werden, mit der die Unterscheidung eines Morphems von homophonen Morphemen vollzogen wird. Beispiele für Homophonie sind Lerche - Lärche, Lied - Lid, Wahl - Wal und Miene - Mine. Diese graphischen Unterscheidungen entstanden entweder durch „Bewahrung historischer Schreibungen oder durch Festlegungen früherer Grammatiker“, insbesondere im 18. Jahrhundert. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass die morphemdifferenzierende Funktion in dieser Arbeit eher sekundär betrachtet wird, vielmehr soll die morphemidentifizierende Funktion im Vordergrund der Untersuchung stehen.
Im Folgenden soll nun untersucht werden, wie sich das morphematische Prinzip seit dem 16. Jahrhundert entwickelt hat. Es wird dabei insbesondere auf die morphematisch motivierte Schreibung der Umlaute a und au, auf die graphische Vernachlässigung der Auslautverhärtung sowie die Schreibung von doppelten Konsonantenbuchstaben in Silbenrandpositionen eingegangen. Ferner soll beleuchtet werden, inwiefern die Grammatiker des 16., 17. und 18. Jahrhunderts diese Entwicklungen unterstützten oder sogar behinderten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die morphematisch motivierte Schreibung der Umlaute a und au
- Das 16. Jahrhundert
- Das 17. Jahrhundert
- Das 18. Jahrhundert
- Die graphische Vernachlässigung der Auslautverhärtung
- Das 16. Jahrhundert
- Das 17. Jahrhundert
- Das 18. Jahrhundert
- Doppelter Konsonantenbuchstabe für die Silbenrandpositionen bei sollen, wollen, können
- Das 16. Jahrhundert
- Das 17. Jahrhundert
- Das 18. Jahrhundert
- Abschließende Betrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung des morphematischen Prinzips in der Geschichte der deutschen Sprache. Sie untersucht, wie das Prinzip seit dem 16. Jahrhundert die Schreibung von Wörtern beeinflusst hat.
- Die morphematisch motivierte Schreibung der Umlaute a und au
- Die graphische Vernachlässigung der Auslautverhärtung
- Die Schreibung von doppelten Konsonantenbuchstaben in Silbenrandpositionen
- Die Rolle der Grammatiker in der Entwicklung des morphematischen Prinzips
- Die geographische Verbreitung des morphematischen Prinzips
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung definiert das morphematische Prinzip und erläutert dessen Funktion in der Schrift. Sie stellt die Hauptaufgaben des Prinzips sowie dessen morphemidentifizierende und morphemdifferenzierende Funktion dar. Die Einleitung führt auch die Schwerpunkte der Arbeit ein und skizziert die Untersuchung der Entwicklung des Prinzips im 16., 17. und 18. Jahrhundert.
Die morphematisch motivierte Schreibung der Umlaute von a und au
Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung der morphematisch motivierten Schreibung der Umlaute von a und au. Es geht auf die geographische Differenzierung der Entwicklung ein und zeigt die Anwendung des Prinzips in der Flexion und Derivation.
Das 16. Jahrhundert
Der Abschnitt behandelt die ersten Prinzipien der morphematischen Umlautkennzeichnung, die im 16. Jahrhundert von Johann Kolross und Fabian Frangk formuliert wurden. Er analysiert die unterschiedlichen Ansätze der beiden Grammatiker und zeigt die Entwicklung der Umlautschreibung in verschiedenen Bibelübersetzungen des 16. Jahrhunderts auf.
Das 17. Jahrhundert
Das Kapitel konzentriert sich auf die Entwicklungen im 17. Jahrhundert, die stark von Justus Georg Schottelius geprägt waren. Es analysiert Schottelius' Ansatz der morphemidentifizierenden Schreibung im Umlautbereich und seine Regeln für die Verwendung des Umlautzeichens.
- Citar trabajo
- Johannes Mücke (Autor), 2012, Das morphematische Prinzip in der Geschichte der deutschen Sprache, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/211901