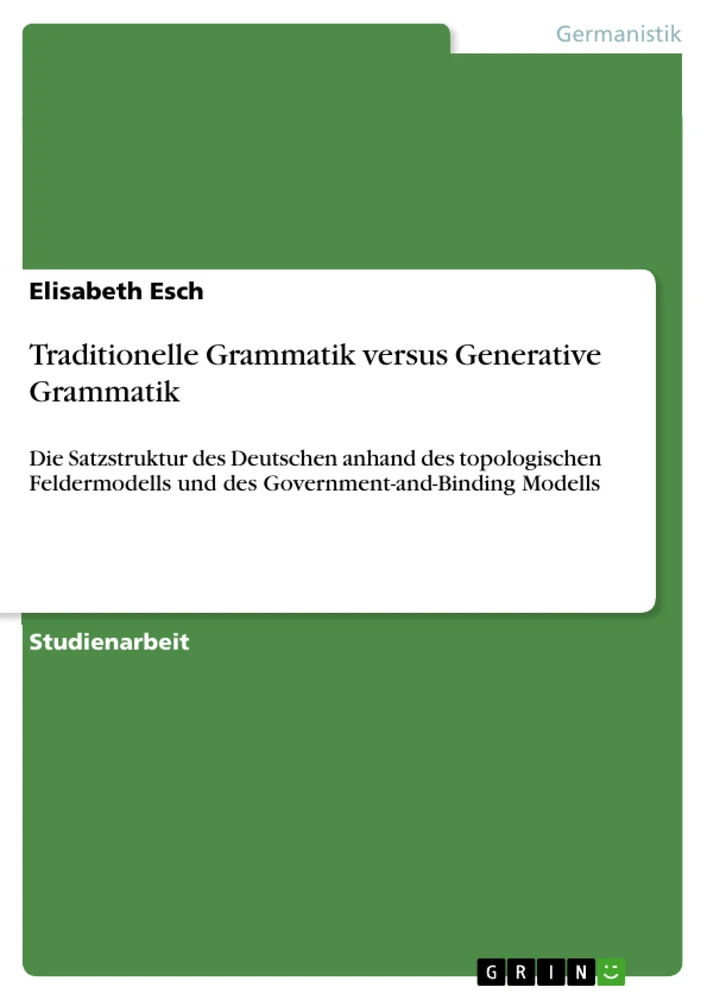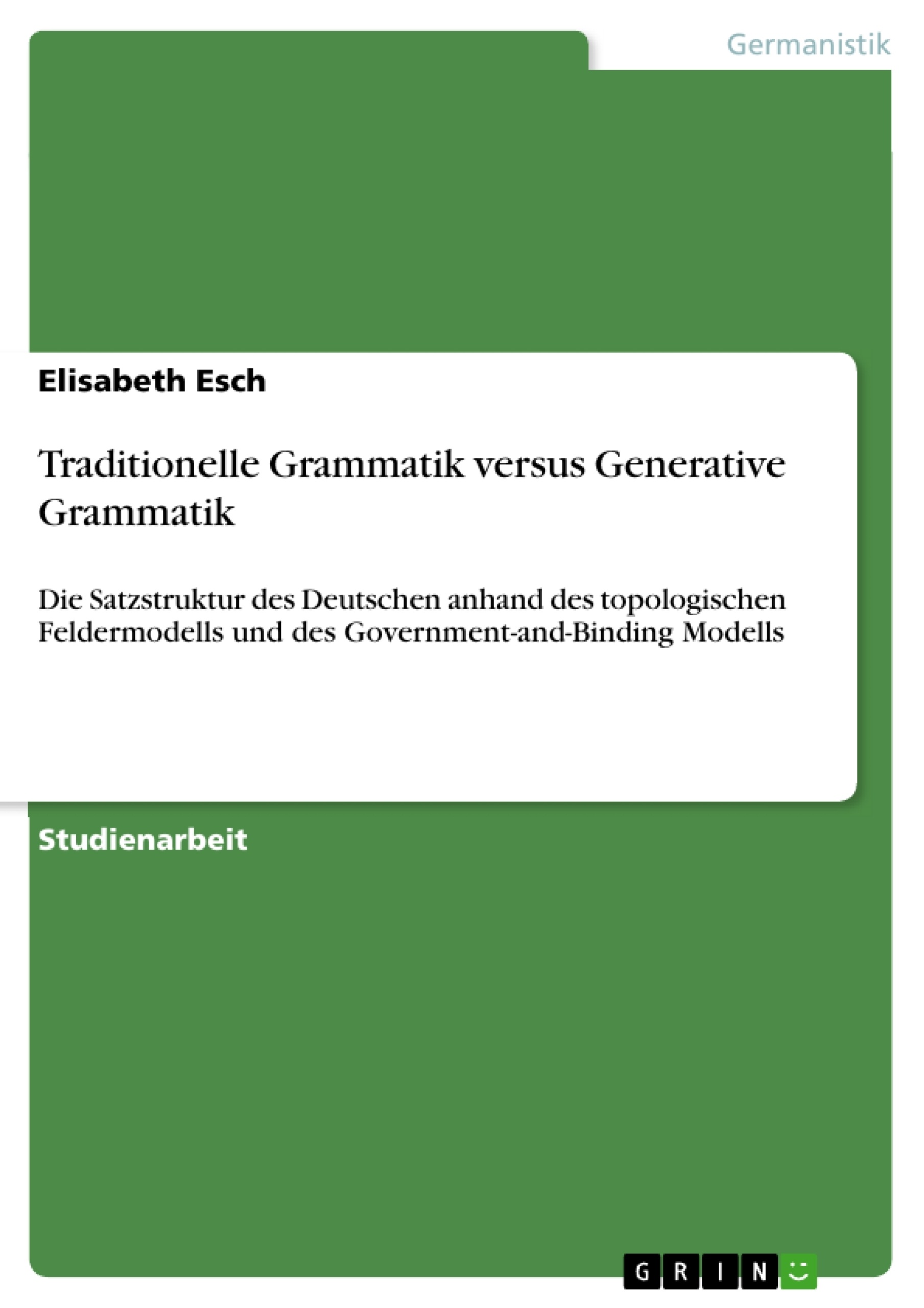Es stellt sich die Frage, wie ein Mensch fähig ist, so viele verschiedene immer komplexer werdende Sätze zu formen und neue Aussagen zu bilden, ohne dass er ungrammatikalisch wird. Haben wir jeden möglichen Satz in unserem Lexikon? Das würde unser mentales Lexikon übersteigen. Es muss demnach Regeln geben, die uns dazu befähigen, jeden Satz zu bilden, der grammatisch korrekt ist, ohne dass wir darüber viel nachdenken müssen. Mit dieser Tatsache haben sich sowohl das topologische Feldermodell als auch das Government-and-Binding-Modell auseinander gesetzt. Die vorliegende Ausarbeitung zeigt diese zwei Modelle zur Beschreibung des Aufbaus von deutschen Sätzen auf.
Zu Anfang wird auf das topologische Feldermodell eingegangen, welches aus der traditionellen Grammatik stammt und von dem der Duden Gebrauch nimmt. Es versucht anhand einer Tabelle die Strukturierung eines Satzes darzustellen, deren jeweilige Elemente ausführlich betrachtet werden. Anschließend findet eine kritische Auseinanderstellung statt. Daneben zeigt sich die Government-and-Binding-Theorie, welche im Zuge der generativen Grammatik entwickelt wurde. Sie geht auf Noam Chomsky zurück, der mithilfe dieses Modells der Konstituentengrammatik die Phrasenstrukturgrammatik weiter entwickelt hat. Zunächst werden kurz die Phasenstrukturregeln erläutert und anschließend die X-Bar-Theorie besprochen, welche die Phasenstrukturgrammatik revidiert und auf die Rektions- und Bindungstheorie zurückgeht. Im Anschluss daran wird explizit das Modell von Chomsky dargestellt. Daraufhin wird versucht das Government-and-Binding-Modell und das topologische Modell in Einklang zu bringen und zu vergleichen. Zum Schluss findet eine kritische Reflexikon über das Government-and-Binding-Modell statt.
Inhaltsverzeichnis
- Gegenstand und Zielsetzung der Arbeit
- Die Satzstruktur des Deutschen anhand des topologischen Feldermodells
- Darstellung
- Vorfeld
- Linke Satzklammer
- Mittelfeld
- Rechte Satzklammer
- Nachfeld
- Kritische Auseinandersetzung
- Die Struktur eines Satzes anhand der Government-and-Binding-Theorie
- Darstellung
- X-Bar-Theorie
- Government-and-Binding-Modell
- Zusammenführung der beiden vorgestellten Modelle
- Kritische Auseinandersetzung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, wie Menschen komplexe Sätze bilden, ohne grammatikalische Fehler zu machen. Sie untersucht zwei Modelle zur Beschreibung der Satzstruktur des Deutschen: das topologische Feldermodell und das Government-and-Binding-Modell. Das Ziel ist es, die beiden Modelle darzustellen, ihre Stärken und Schwächen zu analysieren und sie miteinander zu vergleichen.
- Satzstruktur des Deutschen
- Topologisches Feldermodell
- Government-and-Binding-Theorie
- Traditionelle vs. generative Grammatik
- Analyse von Satzgliedern und ihrer Positionierung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel stellt die Zielsetzung der Arbeit dar und beleuchtet die Frage nach den Regeln, die es Menschen ermöglichen, grammatisch korrekte Sätze zu bilden. Das zweite Kapitel widmet sich dem topologischen Feldermodell, welches die Satzstruktur anhand von Stellungsfeldern wie Vorfeld, linke Satzklammer, Mittelfeld, rechte Satzklammer und Nachfeld beschreibt. Es werden die einzelnen Felder ausführlich erläutert und kritisch beleuchtet. Im dritten Kapitel wird die Government-and-Binding-Theorie vorgestellt, die im Rahmen der generativen Grammatik entstanden ist. Zunächst werden die Phasenstrukturregeln und die X-Bar-Theorie behandelt, bevor das Government-and-Binding-Modell von Noam Chomsky im Detail dargestellt wird. Die beiden Modelle werden anschließend miteinander verglichen und kritisch betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Satzstruktur, topologisches Feldermodell, Government-and-Binding-Theorie, traditionelle Grammatik, generative Grammatik, Konstituentengrammatik, Phrasenstrukturgrammatik, X-Bar-Theorie, Rektions- und Bindungstheorie und Stellungsfelder.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das topologische Feldermodell?
Es ist ein Modell der traditionellen Grammatik, das die Struktur deutscher Sätze in Felder unterteilt (Vorfeld, linke Satzklammer, Mittelfeld, rechte Satzklammer, Nachfeld).
Was besagt die Government-and-Binding-Theorie (GB-Theorie)?
Diese Theorie von Noam Chomsky gehört zur generativen Grammatik. Sie untersucht die Regeln (Rektion und Bindung), nach denen Sätze im mentalen Lexikon gebildet und strukturiert werden.
Was ist die X-Bar-Theorie?
Die X-Bar-Theorie revidiert die einfache Phrasenstrukturgrammatik und bietet ein universelles Schema für den Aufbau von Phrasen in allen Sprachen.
Warum brauchen wir Grammatikmodelle zur Satzbildung?
Da das menschliche Gehirn nicht jeden möglichen Satz auswendig lernen kann, müssen zugrundeliegende Regeln existieren, die uns befähigen, unendlich viele neue, grammatisch korrekte Sätze zu bilden.
Können das Feldermodell und das GB-Modell kombiniert werden?
Die Arbeit versucht, beide Modelle in Einklang zu bringen, um zu zeigen, wie die eher beschreibenden Stellungsfelder der traditionellen Grammatik mit den abstrakten Regeln der generativen Grammatik korrespondieren.
- Quote paper
- Elisabeth Esch (Author), 2013, Traditionelle Grammatik versus Generative Grammatik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/212297