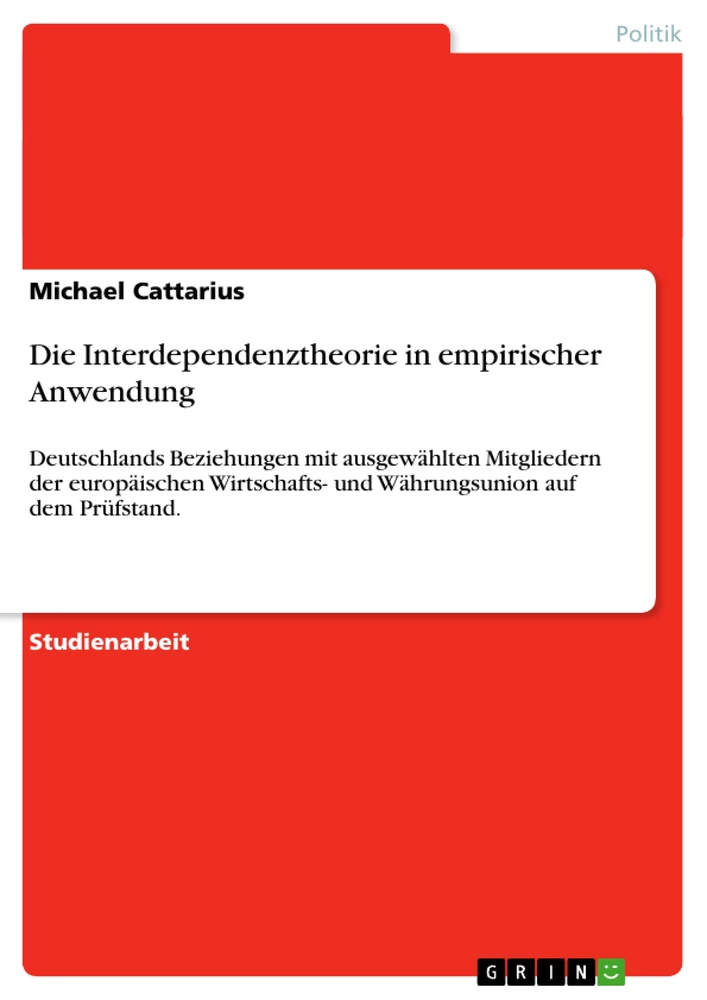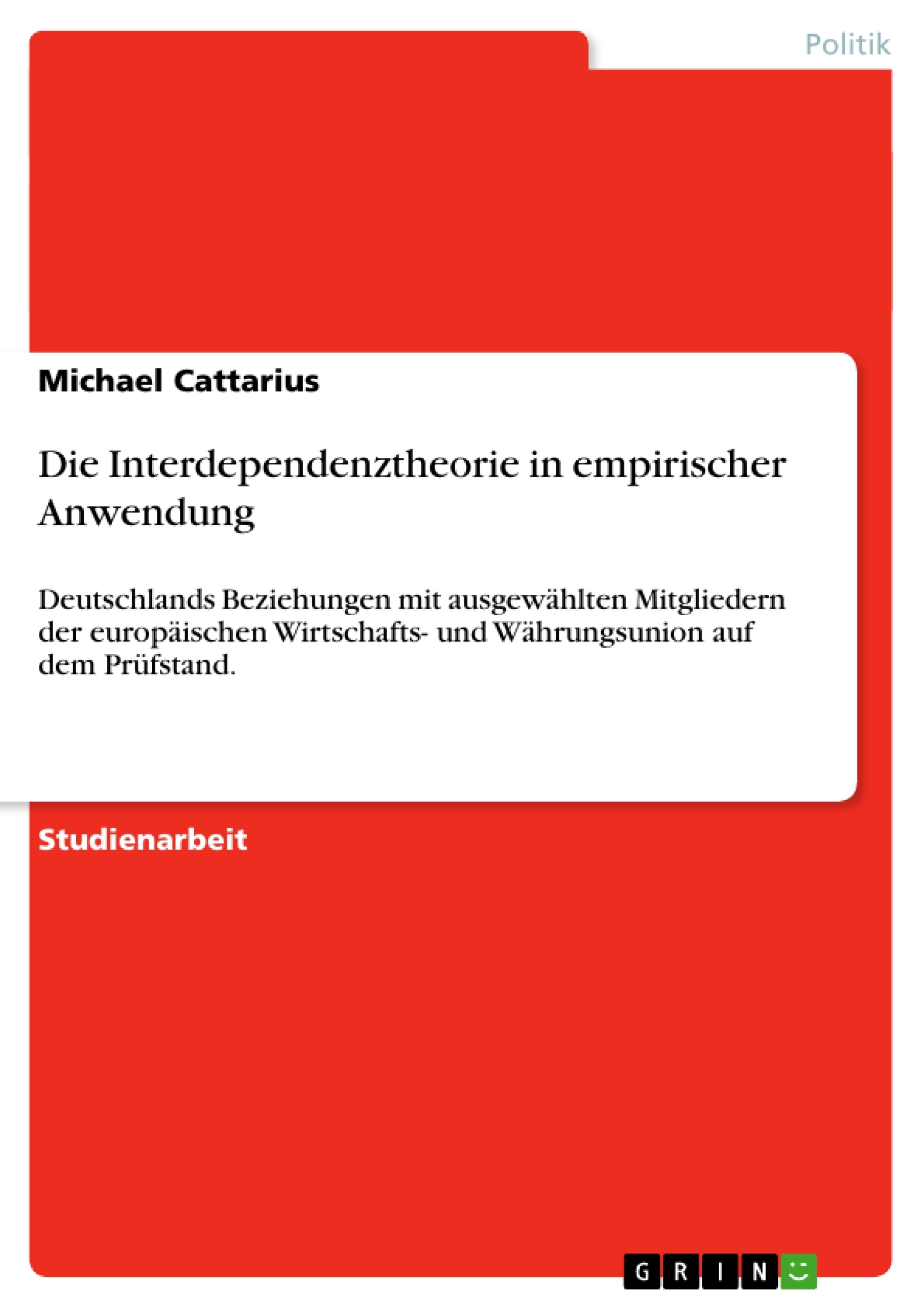Im ersten Schritt wird der interdependenztheoretischer Ansatz von Robert O. Keohane und Joseph S. Nye in überarbeiteter Form aus dem Jahr 2001 erläutert und um einige Anmerkungen durch andere Autoren ergänzt. Um die Relevanz der Fragestellung noch einmal abschließend zu verdeutlichen sollen auch die möglichen Folgen von Interdependenz, die von verschiedenen Autoren aufgezeigt und diskutiert wurden, dargelegt werden.
Im zweiten Schritt soll nun wie oben erwähnt eine empirische Analyse erfolgen. Als beispielhafte Mitglieder der Wirtschafts- und Währungsunion sind hier Frankreich, die Niederlande und Österreich gewählt worden. Die Wahl der Länderbeispiele begründet sich zum einen darin, dass für vollständige Daten vorhanden waren. Zum anderen konnten aus Platz- und auch aus Übersichtsgründen die anderen Mitglieder der Wirtschafts- und Währungsunion nicht mit eingebunden werden.
Die Interdependenz soll durch zwei ökonomische Indikatoren empirisch nachgewiesen werden. Die Export- und Importsummen der einzelnen Länder sowie die ausländisch gehaltenen Unternehmen in Deutschland sollen die Roller der Indikatoren übernehmen. Die Wahl der Indikatoren und deren Relevanz für die Messung von Interdependenz werden im empirischen Teil begründet und erklärt. Es soll nach der Aufarbeitung der beiden Indikatoren möglich sein, jeweils Aussagen treffen zu können, inwiefern Deutschland eine Interdependenzbeziehung mit den Beispielländern aufweist.
Abschließend sollen die Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst werden und es soll eine Einschätzung abgeben werden, welche Ansatzpunkte man noch wählen könnte, um die Interdependenz Deutschlands mit seinen europäischen Nachbarn deutlicher zu charakterisieren.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Interdependenztheoretischer Ansatz
- 2.1 Grundlage der Interdependenztheorie von Keohane und Nye
- 2.2 „Vulnerability“ und „sensitivity“
- 3. Empirische Analyse
- 3.1 Export- und Importsummen
- 3.2 Ausländisch gehaltene Unternehmen in Deutschland
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Abhängigkeitsbeziehung Deutschlands zu ausgewählten Mitgliedern der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (Frankreich, Niederlande, Österreich) anhand des interdependenztheoretischen Ansatzes. Ziel ist es, die Erklärungskraft dieser Theorie empirisch zu überprüfen und mögliche Stärken und Schwächen aufzuzeigen.
- Anwendung der Interdependenztheorie auf die deutsch-europäischen Beziehungen
- Empirische Analyse der Interdependenz mittels ökonomischer Indikatoren
- Bewertung der Abhängigkeitsbeziehung Deutschlands von seinen europäischen Nachbarn
- Analyse der Annahmen und Grundlagen der Interdependenztheorie von Keohane und Nye
- Untersuchung der Relevanz ökonomischer Faktoren für die Interdependenz
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der deutschen Abhängigkeit von europäischen Nachbarn im Kontext der Eurokrise und der europäischen Integration ein. Sie stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Ausmaß der Interdependenz Deutschlands mit Frankreich, den Niederlanden und Österreich. Die Arbeit wird in einen theoretischen und einen empirischen Teil gegliedert, wobei der interdependenztheoretische Ansatz von Keohane und Nye als theoretische Grundlage dient. Die empirische Analyse nutzt ökonomische Indikatoren (Export-/Importsummen und ausländisch gehaltene Unternehmen) zur Überprüfung der Interdependenz. Die Wahl der Länder und Indikatoren wird begründet.
2. Interdependenztheoretischer Ansatz: Dieses Kapitel erläutert den interdependenztheoretischen Ansatz von Keohane und Nye. Es werden die vier grundlegenden Annahmen der Theorie dargestellt, welche die Anarchie des internationalen Systems, die Relevanz verschiedener Akteure (Staaten, internationale Organisationen, innerstaatliche Eliten), die veränderte Bedeutung militärischer Gewalt und die nicht-hierarchische politische Agenda der Staaten beinhalten. Das Kapitel verdeutlicht, wie Keohane und Nye aus diesen Annahmen die Existenz von Interdependenz zwischen Staaten ableiten und unterscheidet dabei zwischen einfacher und komplexer Interdependenz. Es wird auch auf die möglichen Folgen von Interdependenz eingegangen, die von verschiedenen Autoren diskutiert wurden.
Schlüsselwörter
Interdependenztheorie, Keohane & Nye, Europäische Wirtschafts- und Währungsunion, Deutschland, Frankreich, Niederlande, Österreich, Export, Import, Ausländische Direktinvestitionen, Abhängigkeit, empirische Analyse, internationale Beziehungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Abhängigkeitsbeziehung Deutschlands zu ausgewählten EU-Mitgliedern
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Abhängigkeitsbeziehung Deutschlands zu Frankreich, den Niederlanden und Österreich im Kontext der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWU). Sie analysiert diese Beziehung anhand des interdependenztheoretischen Ansatzes von Keohane und Nye und überprüft dessen Erklärungskraft empirisch.
Welche Theorie wird angewendet?
Die Arbeit basiert auf dem interdependenztheoretischen Ansatz von Keohane und Nye. Dieser Ansatz wird detailliert erläutert, inklusive seiner vier grundlegenden Annahmen: Anarchie des internationalen Systems, Relevanz verschiedener Akteure, veränderte Bedeutung militärischer Gewalt und nicht-hierarchische politische Agenda der Staaten. Die Unterscheidung zwischen einfacher und komplexer Interdependenz wird ebenfalls behandelt.
Welche empirischen Methoden werden verwendet?
Die empirische Analyse stützt sich auf ökonomische Indikatoren, konkret auf Export- und Importsummen zwischen Deutschland und den ausgewählten Ländern sowie auf die Anzahl ausländisch gehaltener Unternehmen in Deutschland. Diese Indikatoren sollen das Ausmaß der Interdependenz verdeutlichen.
Welche Länder werden untersucht?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Abhängigkeitsbeziehung Deutschlands zu drei ausgewählten Mitgliedern der EWU: Frankreich, Niederlande und Österreich.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum interdependenztheoretischen Ansatz, ein Kapitel zur empirischen Analyse und ein Fazit. Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und den methodischen Ansatz vor. Das Kapitel zum interdependenztheoretischen Ansatz erläutert die Theorie von Keohane und Nye. Das Kapitel zur empirischen Analyse präsentiert die Ergebnisse der ökonomischen Datenanalyse. Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen und bewertet die Erklärungskraft des interdependenztheoretischen Ansatzes.
Was sind die zentralen Forschungsfragen?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wie stark ist die Interdependenz Deutschlands zu Frankreich, den Niederlanden und Österreich? Die Arbeit untersucht, inwieweit der interdependenztheoretische Ansatz diese Abhängigkeitsbeziehung erklären kann und welche Stärken und Schwächen dieser Ansatz in diesem Kontext aufweist.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Interdependenztheorie, Keohane & Nye, Europäische Wirtschafts- und Währungsunion, Deutschland, Frankreich, Niederlande, Österreich, Export, Import, Ausländische Direktinvestitionen, Abhängigkeit, empirische Analyse, internationale Beziehungen.
Welche Ziele werden verfolgt?
Die Arbeit verfolgt das Ziel, die Erklärungskraft des interdependenztheoretischen Ansatzes von Keohane und Nye anhand der deutsch-europäischen Beziehungen empirisch zu überprüfen und dessen Stärken und Schwächen aufzuzeigen. Sie will die Abhängigkeitsbeziehung Deutschlands zu seinen europäischen Nachbarn bewerten und die Relevanz ökonomischer Faktoren für die Interdependenz untersuchen.
- Arbeit zitieren
- Michael Cattarius (Autor:in), 2013, Die Interdependenztheorie in empirischer Anwendung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/213508