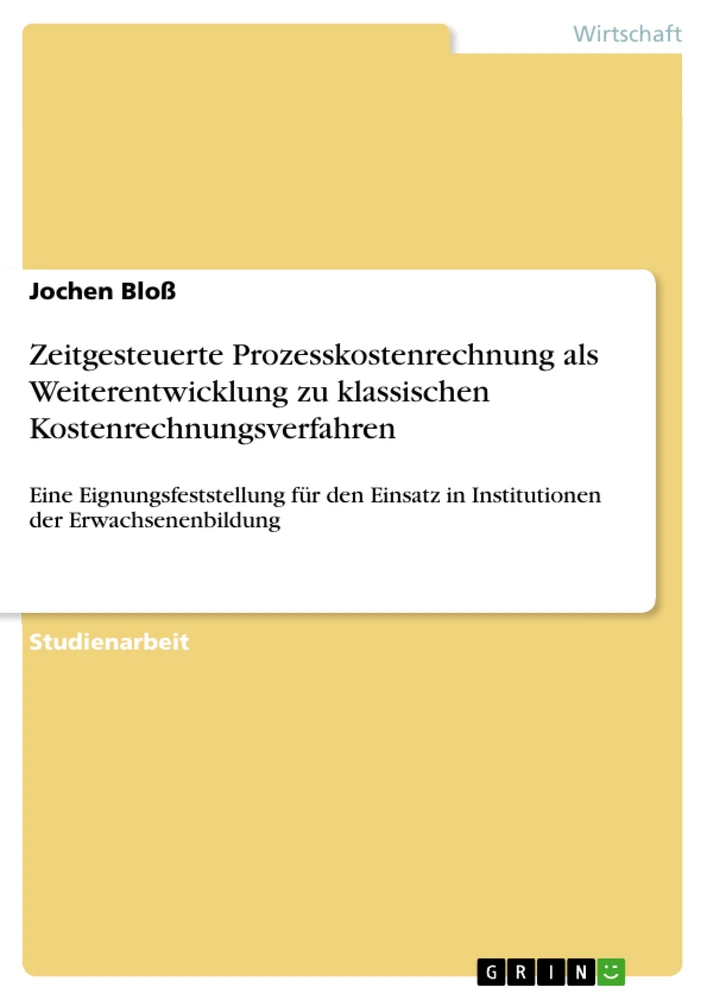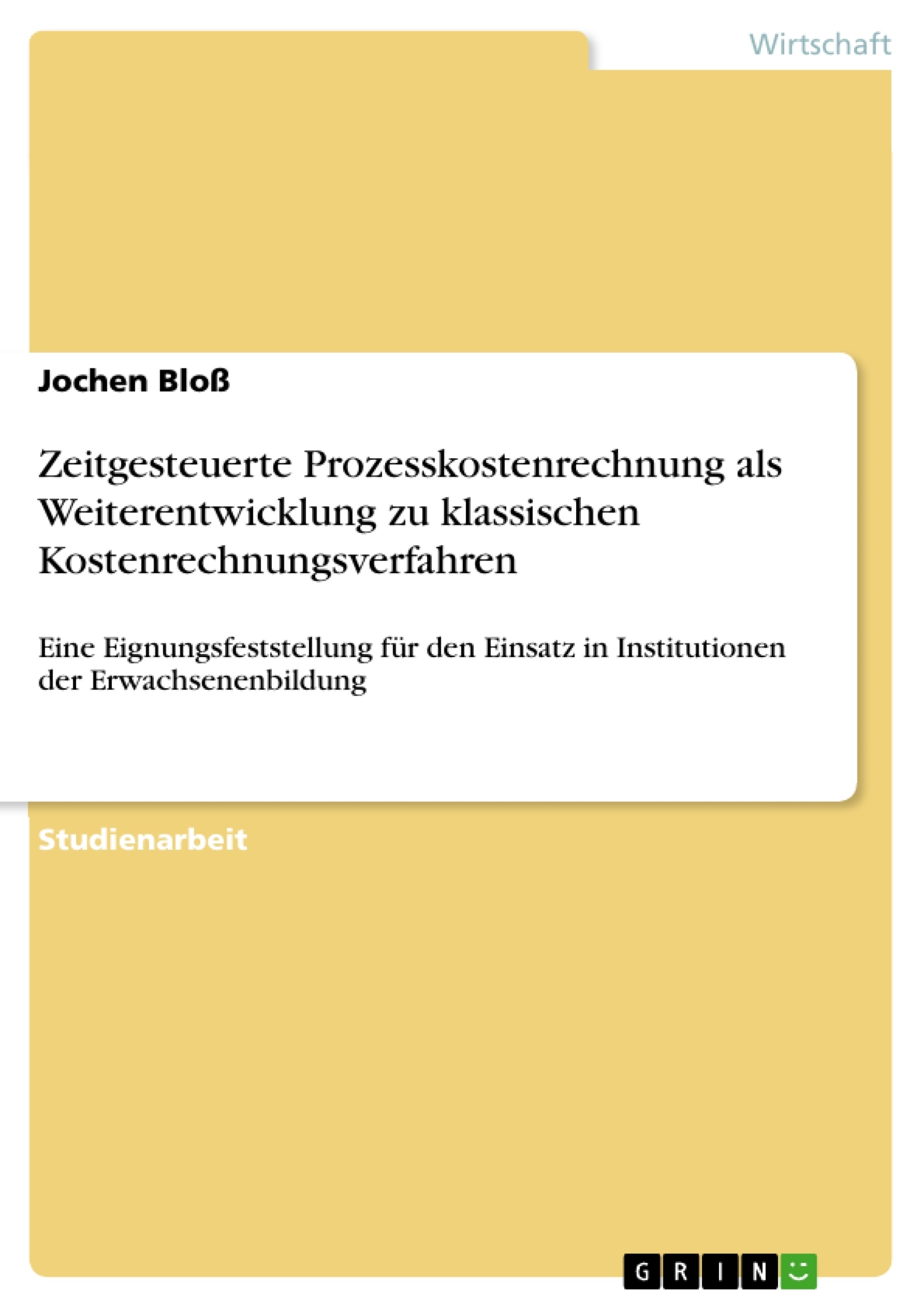Die Frage nach der Notwendigkeit von wirtschaftlichem Handeln stellt sich nicht nur für privatwirtschaftliche Bildungsanbieter, auch im öffentlich finanzierten Weiterbildungssektor werden wirtschaftliche Gesichtspunkte immer wichtiger. Kein Bereich der Gesellschaft kann sich außerhalb ökonomischer Zwänge bewegen. Daher haben betriebswirtschaftliches Denken und Handeln notwendigerweise einen berechtigten Platz im Bildungsbereich.
Wirtschaftliches Handeln wird zu Unrecht gleichgesetzt mit Sparen, billig einkaufen und Haushalten oder auch mit Profit und Rentabilität. Ganz normale Fragen, die sich für zuständige Personen in WBE heutzutage stellen, sind beispielsweise:
• Wie hoch sind die kompletten Kosten, die für die Produktion eines Weiterbildungsproduktes entstehen? Diese Frage bezieht sich nicht nur auf die direkten Kosten der Durchführung eines Kurses, sondern auch auf die damit einhergehenden indirekten Kosten für Vermarktung, Organisation und Administration.
• Welche Auswirkungen haben Qualitätsmerkmale (Einarbeitung und Supervision für Dozenten, Beschwerdemanagement, Qualifizierung der Einrichtungsleitung etc.) auf die Kosten und damit auf den Preis von Weiterbilungsangeboten?
• Wo liegt die Preisuntergrenze (im Sinne einer Schmerzgrenze), bis zu der eine Weiterbildungsmaßnahme – besonders im Konkurrenzkampf bei öffentlichen Ausschreibungen –, geboten werden kann und bei der noch vollständige Kostendeckung gegeben ist?
Um Antworten zu finden, ist der Einsatz professioneller Managementverfahren in der Steuerung von WBE erforderlich. Die in der allgemeinen betriebswirtschaftlichen Praxis und auch bei WBE verbreiteten Kostenrechnungsverfahren stammen ursprünglich aus dem industriellen Sektor. Dieser war, im Gegensatz zum Weiterbildungssektor, lange Zeit gekennzeichnet durch eine hohe Dominanz der direkten Produktfertigung. Im postindustriellen Zeitalter gewinnen aber personal(kosten)intensive Dienstleistungen und eine prozessorientierte Unternehmenssteuerung verstärkt an Bedeutung, was zeitgemäße Systematiken der Kostenrechnung erfordert. Personalintensive Kostenstrukturen sind traditionell im Weiterbildungssektor ausgeprägt. Während der industrielle Sektor sich allerdings schon in Theorie und Praxis der Kostenrechnung auf die stärkere Dominanz von Leistungen in internen Unternehmensbereichen einstellt, ist eine zeitgemäße Systematik der Kostenrechnung im Weiterbildungssektor noch nicht zu erkennen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung und Ausgangslage
- 1.2 Darstellung der Forschungslücke
- 1.3 Zielsetzung der Arbeit
- 1.4 Eingrenzung des Themas
- 2. Begriffsdefinition
- 2.1 Mikro- und Makrodidaktische Prozesse bei WBE
- 2.2 Kosten und Leistungen
- 3. Grundkonzepte klassischer Kostenrechnungsverfahren und deren Eignungsfeststellung für WBE
- 3.1 Vollkostenrechnung (als Zuschlagskalkulation)
- 3.2 Teilkostenrechnung
- 4. Entwicklung der Zeitgesteuerten Prozesskostenrechnung
- 4.1 Die klassische PKR als Ausgangsbasis
- 4.2 Erweiterung der klassischen PKR zur Zeitgesteuerten PKR
- 4.2.1 Funktionsweise der Zeitgesteuerten PKR
- 4.2.2 Implementierung eines TDABC-Systems bei einer WBE
- 4.3 Kritische Würdigung der TDABC
- 5. Schlussfolgerung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Eignung der Zeitgesteuerten Prozesskostenrechnung (TDABC) für Weiterbildungseinrichtungen (WBE). Die Zielsetzung ist es, die Funktionsweise der TDABC im Vergleich zu klassischen Kostenrechnungsverfahren darzustellen und ihre Anwendbarkeit im Kontext der Erwachsenenbildung zu beleuchten.
- Einführung in die Problematik der Kostenrechnung in der Erwachsenenbildung
- Analyse der klassischen Kostenrechnungsverfahren und ihrer Eignung für WBE
- Entwicklung und Funktionsweise der Zeitgesteuerten Prozesskostenrechnung (TDABC)
- Implementierung und kritische Würdigung der TDABC im Kontext der Erwachsenenbildung
- Schlussfolgerungen und Ausblick auf zukünftige Entwicklungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problemstellung und die Forschungslücke im Bereich der Kostenrechnung für Weiterbildungseinrichtungen dar. Sie definiert die Zielsetzung und die Eingrenzung des Themas.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Begriffsdefinition von Mikro- und Makrodidaktischen Prozessen in der Erwachsenenbildung sowie mit den relevanten Kosten und Leistungen.
Das dritte Kapitel analysiert die Grundkonzepte klassischer Kostenrechnungsverfahren, wie die Vollkostenrechnung und die Teilkostenrechnung, und untersucht deren Eignung für Weiterbildungseinrichtungen.
Das vierte Kapitel widmet sich der Entwicklung der Zeitgesteuerten Prozesskostenrechnung. Es zeigt die klassische PKR als Ausgangsbasis und beschreibt die Erweiterung zur Zeitgesteuerten PKR. Die Funktionsweise der Zeitgesteuerten PKR und deren Implementierung in Weiterbildungseinrichtungen werden ebenfalls erläutert. Abschließend wird eine kritische Würdigung der TDABC gegeben.
Schlüsselwörter
Kostenrechnung, Prozesskostenrechnung, Zeitgesteuerte Prozesskostenrechnung, TDABC, Erwachsenenbildung, Weiterbildungseinrichtung, WBE, Mikro- und Makrodidaktik, Kosten und Leistungen, Vollkostenrechnung, Teilkostenrechnung.
Häufig gestellte Fragen
Warum benötigen Weiterbildungseinrichtungen moderne Kostenrechnungsverfahren?
Aufgrund des steigenden wirtschaftlichen Drucks und des Wettbewerbs müssen auch öffentlich finanzierte Einrichtungen ihre Kosten für Marketing, Organisation und Administration präzise kalkulieren.
Was ist die Zeitgesteuerte Prozesskostenrechnung (TDABC)?
TDABC (Time-Driven Activity-Based Costing) ist eine Weiterentwicklung der klassischen Prozesskostenrechnung, die Kosten basierend auf der benötigten Zeit für Prozesse zuordnet.
Was sind die Nachteile klassischer Vollkostenrechnungen für Bildungsanbieter?
Klassische Verfahren stammen aus der Industrie und vernachlässigen oft die personalintensiven indirekten Kostenstrukturen, die für Dienstleistungen in der Weiterbildung typisch sind.
Wie hilft TDABC bei der Preiskalkulation von Kursen?
Es ermöglicht die Ermittlung einer exakten Preisuntergrenze, indem alle direkten und indirekten Kostenanteile prozessorientiert erfasst werden.
Was unterscheidet mikro- von makrodidaktischen Prozessen?
Mikrodidaktik bezieht sich auf die konkrete Unterrichtsgestaltung, während Makrodidaktik die übergeordnete Planung, Organisation und Vermarktung von Bildungsangeboten umfasst.
- Citar trabajo
- Jochen Bloß (Autor), 2013, Zeitgesteuerte Prozesskostenrechnung als Weiterentwicklung zu klassischen Kostenrechnungsverfahren, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/214047