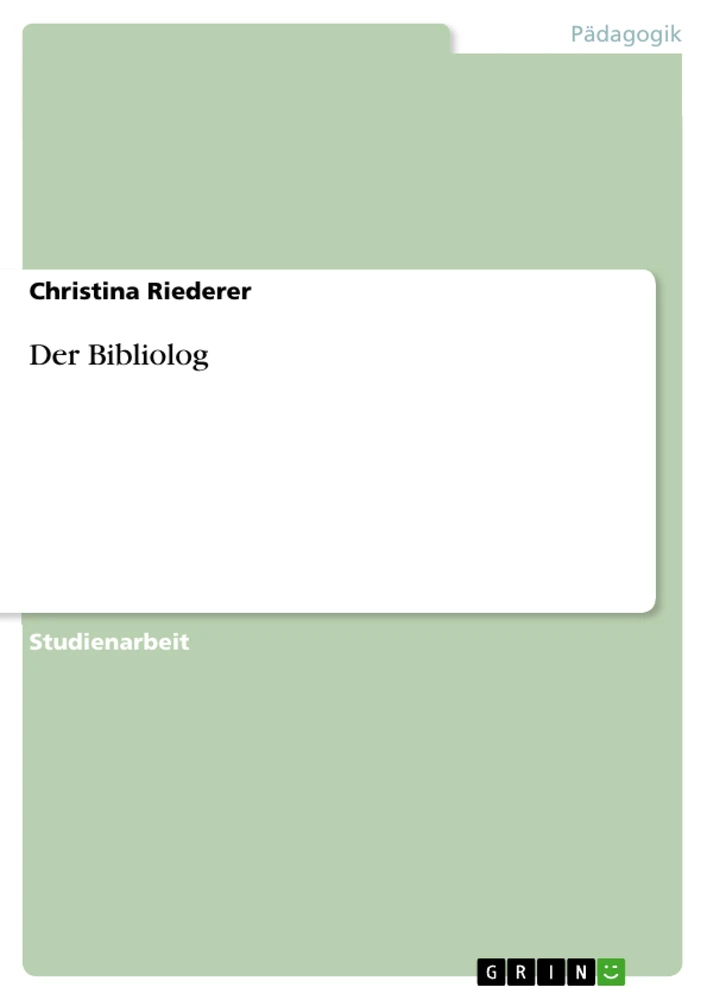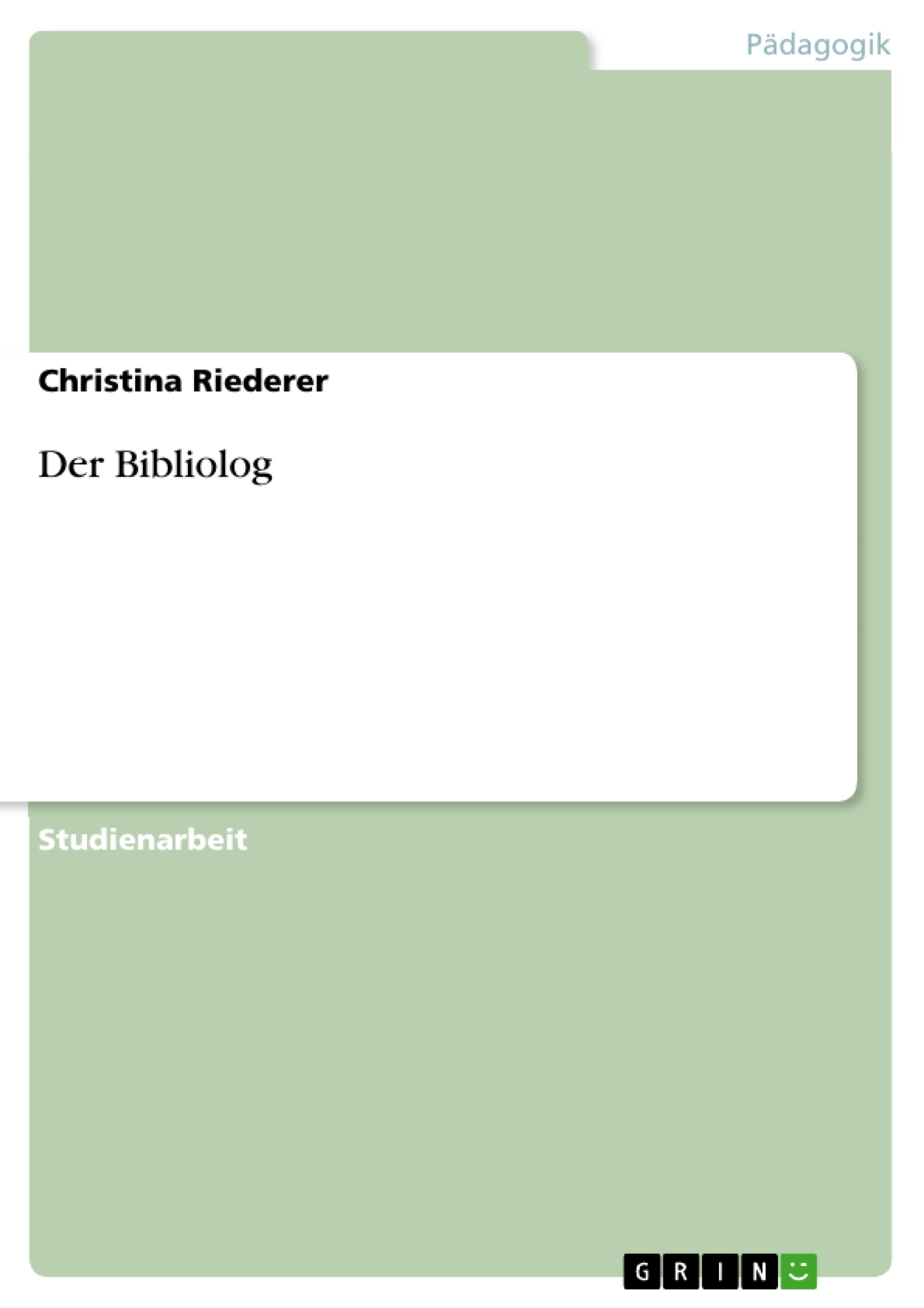Schon seit mehreren Jahren kann ein stetig sinkendes Interesse der Gesellschaft an Kirche und somit den Gottesdienstbesuchen festgestellt werden. Zwar gehen nach einer Studie der Konrad Adenauer Stiftung zweidrittel der Bürger, nach eigener Einschätzung, mindestens einmal im Jahr in die Kirche und immerhin zwanzig Prozent mindestens einmal im Monat, dennoch sind diese Zahlen im Vergleich zu früheren Jahren sehr gering. Dabei muss jedoch zwischen den Generationen unterscheiden werden: Vor allem die jugendliche Bevölkerung geht weitaus weniger häufig in die Kirche, als dies die ältere Generation tut. Diese „Kirchenferne“ bedeutet allerdings nicht, dass die Menschen unreligiös sind. Häufig ist ein Grund des Fernbleibens vom Gottesdienst lediglich die Langeweile. Dabei muss eine Andacht heut zu tage gar nicht trocken und leblos sein. Ein gutes Beispiel für eine interessante Art der Gestaltung eines Gottesdienstes stellt der Bibliolog dar, der nun im Anschluss vorgestellt wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einführung in den Bibliolog
- Was ist ein Bibliolog?
- Die Entstehung des Bibliologs
- Die Leitung des Bibliologs
- Die einzelnen Schritte des Bibliologs
- Die Textauswahl
- Die Vorbereitung des Bibliologs
- Der Prolog
- Die Hinführung
- Die Techniken im Bibliolog
- Das echoing
- Das interviewing
- Der Epilog und das Deroling
- Die Weiterarbeit nach dem Bibliolog
- Die Unterscheidung zwischen Bibliolog und Bibliodrama
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text zielt darauf ab, den Bibliolog als eine innovative und interaktive Methode zur Auseinandersetzung mit biblischen Texten vorzustellen. Der Bibliolog bietet eine Möglichkeit, biblische Geschichten lebendig und persönlich zu erleben und dadurch einen tiefsinnigen Zugang zu den Inhalten der Bibel zu finden.
- Der Bibliolog als hermeneutisch-methodischer Zugang zu biblischen Texten.
- Die Entstehung des Bibliologs und seine Wurzeln im jüdischen Midrasch.
- Die Rolle der Leitung im Bibliolog und die Bedeutung der Vorbereitung.
- Die verschiedenen Schritte des Bibliologs, von der Textauswahl bis zur Durchführung.
- Die Unterscheidung zwischen Bibliolog und Bibliodrama.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den Kontext des Bibliologs vor, indem sie das sinkende Interesse an Kirche und Gottesdienstbesuchen in der Gesellschaft beleuchtet. Sie argumentiert, dass der Bibliolog eine Möglichkeit bietet, Gottesdienste interessanter und lebendiger zu gestalten.
- Einführung in den Bibliolog: Dieses Kapitel definiert den Bibliolog als eine Methode, die auf die Begegnung zwischen Mensch und Bibeltext zielt. Es beschreibt den Unterschied zwischen dem traditionellen Zugang zum Bibeltext und dem hermeneutischen Ansatz des Bibliologs, bei dem der Text als Subjekt und Dialogpartner betrachtet wird.
- Die einzelnen Schritte des Bibliologs: Das Kapitel behandelt die einzelnen Schritte, die bei der Durchführung eines Bibliologs notwendig sind. Es geht auf die Textauswahl, die Vorbereitung des Bibliologs, die Rolle der Leitung und die verschiedenen Techniken ein, die im Bibliolog zum Einsatz kommen.
- Die Weiterarbeit nach dem Bibliolog: Dieses Kapitel befasst sich mit den Möglichkeiten, die sich nach der Durchführung eines Bibliologs eröffnen. Es beschreibt, wie die Erkenntnisse aus dem Bibliolog weiterverarbeitet und in den Alltag integriert werden können.
- Die Unterscheidung zwischen Bibliolog und Bibliodrama: Der Text erläutert die Unterschiede zwischen dem Bibliolog und dem Bibliodrama, einer verwandten Methode, die von Peter Pitzele entwickelt wurde.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Fokusthemen des Textes sind Bibliolog, hermeneutisch-methodischer Zugang, Bibeltext, Begegnung, Dialog, Leitung, Vorbereitung, Textauswahl, Rollenspiel, Trance, Bibliodrama, Midrasch, Kirche, Gottesdienst, Interesse, Gesellschaft, Kircheferne.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Bibliolog?
Ein Bibliolog ist eine interaktive Methode der Bibelauslegung, bei der die Teilnehmer in die Rollen biblischer Figuren schlüpfen und den Text lebendig werden lassen.
Woher stammt die Methode des Bibliologs?
Die Methode hat ihre Wurzeln im jüdischen Midrasch und wurde von Peter Pitzele als zeitgemäße Form der Textbegegnung entwickelt.
Was ist der Unterschied zwischen Bibliolog und Bibliodrama?
Der Bibliolog ist meist kürzer, stärker am Text orientiert und findet im Sitzen statt, während das Bibliodrama oft raumgreifender und prozessorientierter ist.
Welche Techniken werden im Bibliolog angewendet?
Zentrale Techniken sind das „Echoing“ (Wiederholen von Aussagen der Teilnehmer) und das „Interviewing“ durch die Leitung.
Kann der Bibliolog gegen „Kirchenferne“ helfen?
Ja, da er Gottesdienste lebendiger und persönlicher gestaltet, bietet er einen niederschwelligen Zugang für Menschen, die traditionelle Gottesdienstformen als trocken empfinden.
- Citar trabajo
- Christina Riederer (Autor), 2011, Der Bibliolog, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/214643