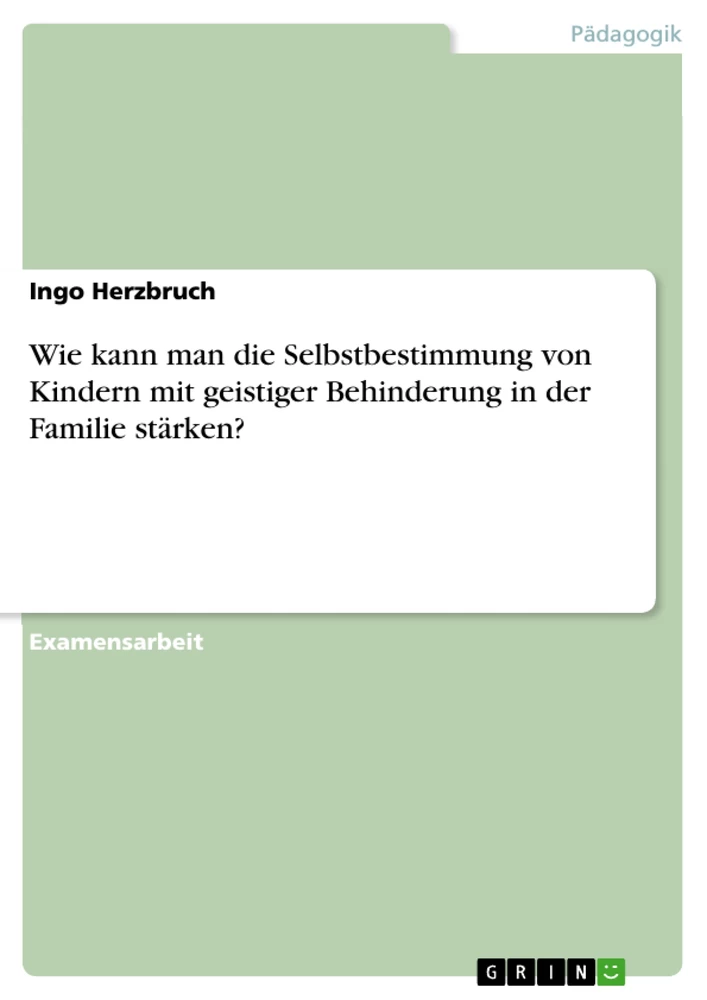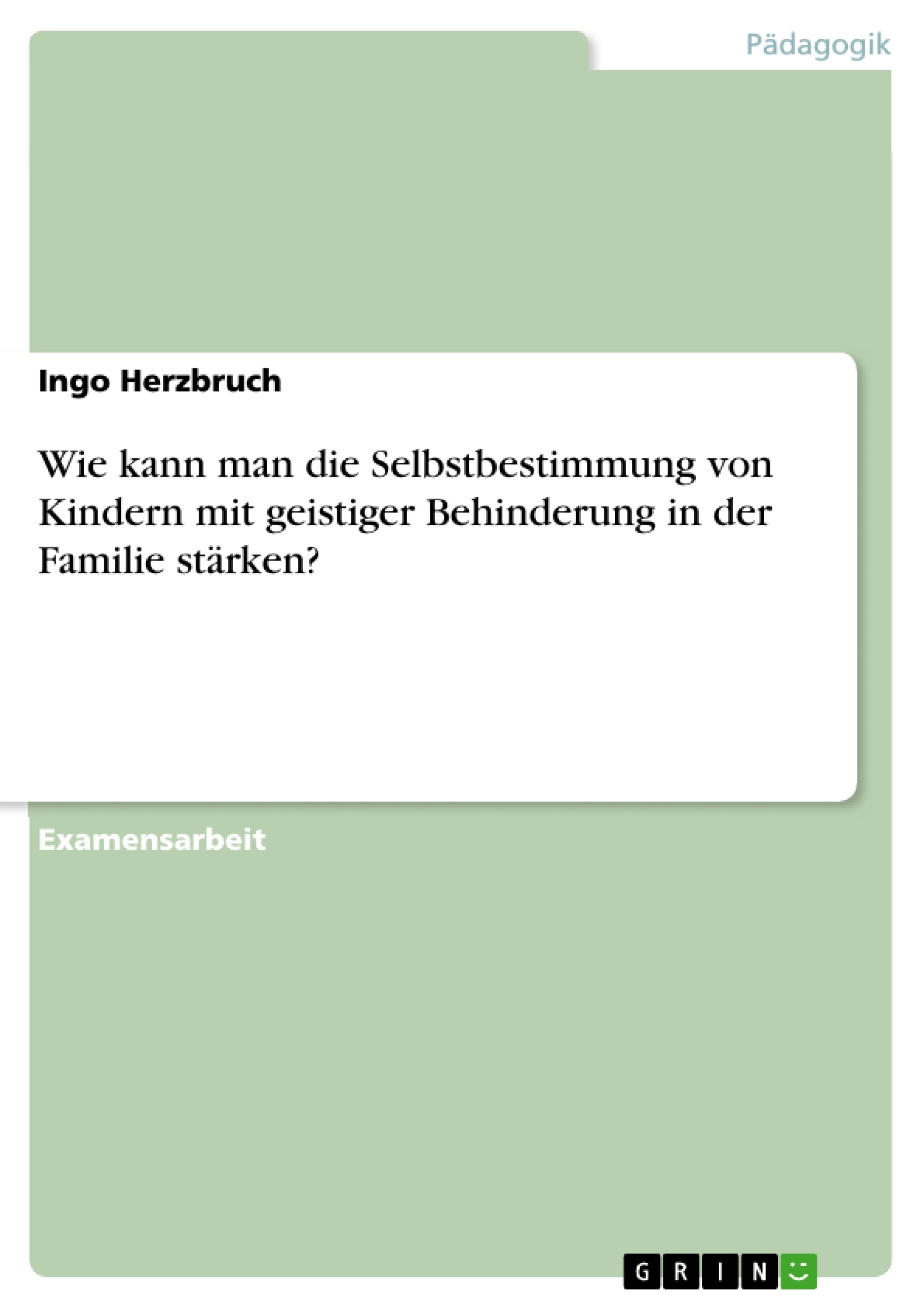In meiner Zivildienstzeit habe ich in einem Sonderkindergarten gearbeitet. Dabei fiel mir auf, dass in der Kindertagesstätte fast ausschließlich die Mütter der Kinder erschienen und sich um das Kind kümmerten. Zunächst sah ich in dieser Tatsache keine große Problematik, doch mit der Zeit fielen mir sehr extreme Ängste und die Tendenz zur Überbehütung bei einigen Müttern auf. Ein Mädchen mit schwerer Behinderung kam nur sehr selten in den Kindergarten, weil sich die Mutter zu Hause um sie kümmern wollte, mehrere Mütter waren von ihren Männern verlassen worden und zum großen Teil waren es die Mütter, die über die Pflege, Betreuung und Entwicklungsstand ihres Kindes genau Bescheid wussten, während die Väter sich nur sehr selten im Kindergarten über ihre Kinder informierten. Im Gespräch mit dem Kollegium des Kindergartens wurde deutlich, dass dies eine Problematik in der Arbeit mit Kindern mit Behinderungen ist. Es sei weitreichend bekannt, dass die Mütter die Hauptlast der Erziehung tragen und das Kind oft der Lebensmittelpunkt der Mütter ist. Dies machte mich zunächst nachdenklich, aber da ich damals der Meinung war, dass ich an dieser Tatsache als Zivildienstleistender nicht viel ändern konnte, nahm ich diese Situation wahr, aber beschäftigte mich nicht näher damit.
Diese Erfahrungen sensibilisierten mich jedoch für die Rollenverteilung in dieser Gesellschaft, so dass ich im alltäglichen Leben immer wieder mit dieser Thematik konfrontiert wurde, sei es im Supermarkt, in den Medien, in der Politik, in den Gesprächen mit Bekannten, Verwandten und Freunden etc.. Durch aufmerksames Beobachten und das „Lesen zwischen den Zeilen“ findet man tagtäglich neben den eindeutigen Aussagen auch sogenannte normative Implikationen über die Frauen und Männer, die Mädchen und junge Frauen, Jungen und junge Männer, die sie in der ihnen zugedachten Rolle eingrenzen und sie zu dem Menschen erziehen, welcher der gesellschaftlichen Ordnung entspricht. Dabei wird nicht auf die Wünsche und Bedürfnisse des Einzelnen eingegangen, sondern jedes Individuum wird auf sehr subtile Art und Weise in seine Rolle „hineinerzogen“. Selbst die emanzipierteste Frau und der emanzipierteste Mann hat, sei es auf der kleinsten Ebene, ebenfalls Verhaltensweisen, in denen sich ihre Rolle manifestiert. Dies gilt gleichermaßen für Frauen und Männer. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- Selbstbestimmung
- Abgrenzung der Begriffe „krank“ und „behindert“
- Selbstbestimmung bei Menschen mit geistiger Behinderung
- Das Verhältnis von Selbstbestimmung und Abhängigkeit
- Wege zur Selbstbestimmung
- Das Normalisierungsprinzip als Voraussetzung zur Selbstbestimmung von Menschen mit geistiger Behinderung
- Empowerment
- Die Indepentent-Living-Bewegung
- Das Empowerment-Konzept
- Analyse der Kritik am Empowerment-Konzept
- Ursachen und Folgen negativer Verhaltensweisen gegenüber Menschen mit geistiger Behinderung
- Die Situation der Mütter mit geistig behinderten Kindern
- Die Familie mit einem Kind mit geistiger Behinderung
- Die Rolle des Vater
- Die Rolle der nichtbehinderten Geschwister
- Der Krisenverarbeitungsprozess nach Schuchardt
- Die historische Betrachtung der Mutterrolle
- Die Rolle der Mutter in der Gesellschaft
- Die Familie mit einem Kind mit geistiger Behinderung
- Auswirkungen der gesellschaftlichen Bedingungen auf die Selbstbestimmung der Mütter mit einem geistig behinderten Kind und Möglichkeiten zu einem selbstbestimmten Leben
- Erwartungen, Forderungen und Verhalten seitens der Umwelt an die Mütter
- Die permanente Mutterschaft und Omnipräsenz
- Auswirkungen auf die Freizeit und soziale Kontakte der Mutter
- Auswirkungen auf die Erwerbstätigkeit der Mütter
- Beeinträchtigungen der Autonomie bzw. der Selbstbestimmung der Mütter
- Das Normalisierungsprinzip in Bezug auf die Mutter
- Das Empowerment-Konzept in bezug auf die Mütter
- Auswirkungen der Rolle der Mutter auf die Selbstbestimmung des Kindes mit geistiger Behinderung
- „Das gemeinsame Sorgenkind der Familie“
- Das behinderte Kind als Gattensubstitut
- Das behinderte Kind als Sündenbock
- Ausblick: Nötige Veränderungen zu mehr Selbstbestimmung für Kinder mit geistiger Behinderung
- Veränderungen in der Gesellschaft
- Verändertes Rollenverständnis
- Ein verändertes Menschenbild
- Ein gut funktionierendes Familiensystem
- Eine gelungene Verarbeitung der Behinderung des Kindes
- Veränderungen in der Gesellschaft
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Auswirkungen der gesellschaftlichen Bedingungen auf die Selbstbestimmung von Müttern mit einem geistig behinderten Kind und die daraus resultierenden Folgen für die Selbstbestimmung des Kindes.
- Bedeutung von Selbstbestimmung für Menschen mit geistiger Behinderung
- Einfluss von gesellschaftlichen Normen und Erwartungen auf die Rolle von Müttern mit einem geistig behinderten Kind
- Herausforderungen für die Selbstbestimmung von Müttern und Kindern in der Familie
- Konzepte wie Normalisierung und Empowerment im Kontext der Selbstbestimmung
- Möglichkeiten zur Stärkung der Selbstbestimmungspotentiale in der Familie
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt das Problem der eingeschränkten Selbstbestimmung von Müttern mit geistig behinderten Kindern und den damit verbundenen Herausforderungen für die Selbstbestimmung des Kindes in den Mittelpunkt.
- Selbstbestimmung: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Selbstbestimmung“ im Kontext von Menschen mit geistiger Behinderung und analysiert das Verhältnis von Selbstbestimmung und Abhängigkeit.
- Wege zur Selbstbestimmung: Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung des Normalisierungsprinzips und des Empowerment-Konzepts für die Selbstbestimmung von Menschen mit geistiger Behinderung.
- Ursachen und Folgen negativer Verhaltensweisen: Dieses Kapitel untersucht die gesellschaftlichen Ursachen und Folgen negativer Verhaltensweisen gegenüber Menschen mit geistiger Behinderung.
- Die Situation der Mütter: Dieses Kapitel analysiert die Rolle der Mütter in Familien mit einem geistig behinderten Kind, die Auswirkungen auf ihre Selbstbestimmung und die Rolle des Vaters und der Geschwister.
- Auswirkungen der gesellschaftlichen Bedingungen: Dieses Kapitel beleuchtet die Erwartungen und Forderungen der Gesellschaft an Mütter mit einem geistig behinderten Kind und die daraus resultierenden Auswirkungen auf ihre Selbstbestimmung.
- Auswirkungen der Rolle der Mutter: Dieses Kapitel untersucht die Auswirkungen der Rolle der Mutter auf die Selbstbestimmung des Kindes mit geistiger Behinderung und beschreibt verschiedene Muster der Familienbeziehungen.
- Ausblick: Dieses Kapitel skizziert notwendige Veränderungen in der Gesellschaft, im Familiensystem und bei der Verarbeitung der Behinderung des Kindes, um die Selbstbestimmung von Kindern mit geistiger Behinderung zu fördern.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Selbstbestimmung, Menschen mit geistiger Behinderung, Mutterrolle, Familie, Normalisierungsprinzip, Empowerment, gesellschaftliche Normen und Erwartungen, Inklusion, und der Förderung der Selbstbestimmungspotentiale von Kindern mit geistiger Behinderung.
- Arbeit zitieren
- Ingo Herzbruch (Autor:in), 2001, Wie kann man die Selbstbestimmung von Kindern mit geistiger Behinderung in der Familie stärken?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/21514