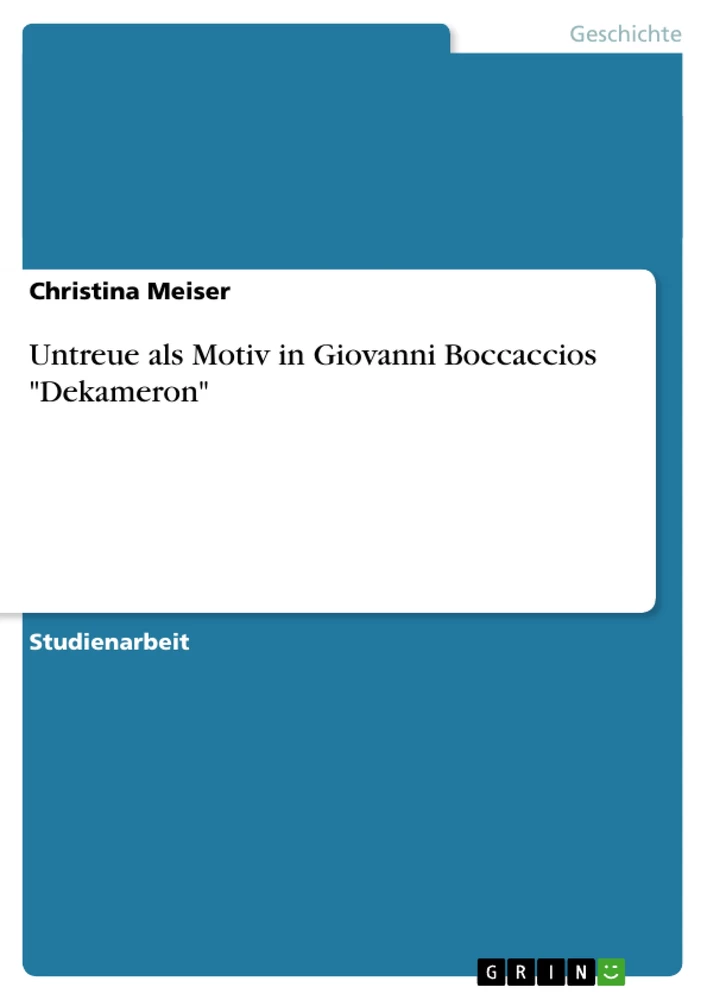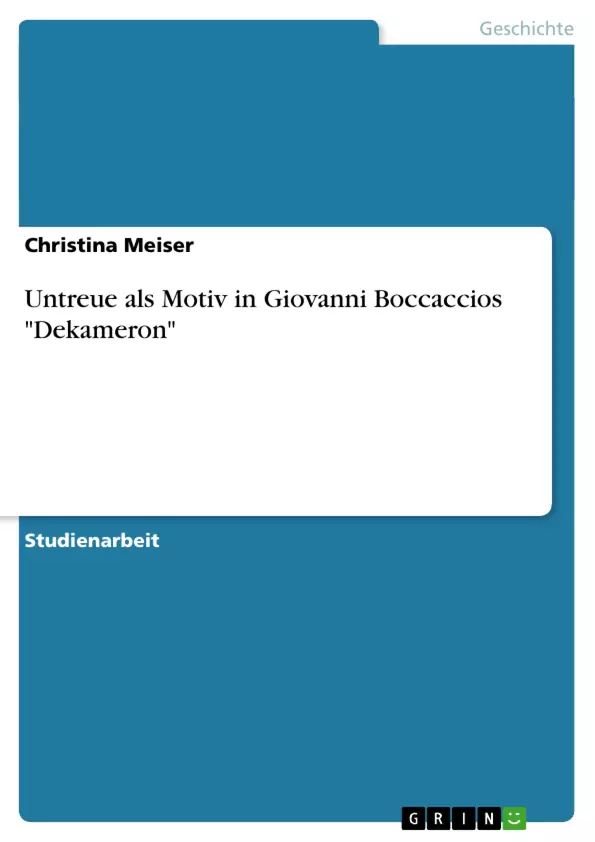Mit der erklärten Absicht, die Frauen zu amüsieren, schrieb Giovanni Boccaccio um 1350 das Dekameron, eine Sammlung von hundert in einer Rahmenerzählung eingebetteten Novellen. Die Erzählung handelt von zehn Leuten, die aufs Land gehen, um vor der in Florenz wütenden Pest geschützt zu sein. Um sich die Zeit zu vertreiben, erzählen sie sich abwechselnd Geschichten. Weil sie fürchten, von anderen Leuten gestört zu werden, kehren sie schließlich nach vierzehn Tagen in die Stadt zurück. Im ersten Kapitel dieser Arbeit werden das Leben und die früheren Werke des Giovanni Boccaccio näher beschrieben. Weiterhin wird auf das Dekameron eingegangen. Zuerst darauf, wie es entstanden und wodurch es so berühmt geworden ist. Dann soll erläutert werden, welche Stoffe darin bearbeitet werden. Außerdem wird der Inhalt beschrieben, um die Rahmenhandlung zu verdeutlichen.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit Ehe und Ehebruch im Mittelalter. Es wird dargestellt, wie eine Ehe im Mittelalter zustande kam und welches Mitspracherecht der Vater bei einer Eheschließung hatte. Weiterhin soll aufgezeigt werden, was ein Ehebruch für beide Partner bedeutete, wie er bestraft wurde und ob Ehebruch bei Männern anders gewertet wurde als bei Frauen.
Der zweite Teil dieses Kapitels beschäftigt sich mit der Darstellung von Ehe und Ehebruch in der Literatur des Mittelalters. Hierbei wird zwischen einzelnen Gattungen unterschieden.
In Kapitel 3 geht es um Ehebruch im Dekameron. Die ausgewählten Novellen beschäftigen sich ausschließlich mit Eheskandalen. An ihnen soll erläutert werden, wie Boccaccio die Ehen und den Ehebruch im Mittelalter darstellt. Unterteilt ist dieses Kapitel in die Geschichten, die von listigen Ehefrauen und ihren Geliebten handeln, in Erzählungen von Ehebruch durch Heirat wider Willen, von Ehebruch in Verbindung mit Gewalt und zuletzt in Ehebruch und Klerus.
Kapitel 4 beschäftigt sich mit dem Vergleich zwischen Literatur und Realität. Die Frage ist hier, ob Boccaccio mit seinen Geschichten die Realität widerspiegelte oder ob er die Inhalte der Erzählungen frei erfunden hat.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung ins Thema
- 1.1 Giovanni Boccaccio und seine Werke
- 1.2 Das Dekameron
- 2. Ehe und Ehebruch im Mittelalter
- 2.1 Ehe und Ehebruch
- 2.2 Ehe und Ehebruch in der Literatur des Mittelalters
- 3. Ehe und Ehebruch im Dekameron
- 3.1 Listige Frauen und ihre Liebhaber
- 3.2 Ehebruch durch Heirat wider Willen
- 3.3 Ehebruch und Gewalt
- 3.4 Ehebruch und Klerus
- 4. Vergleich der Ehe und des Ehebruchs in Literatur und Realität
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung von Ehe und Ehebruch im Dekameron von Giovanni Boccaccio im Kontext des Mittelalters. Ziel ist es, Boccaccios Schilderung von Eheskandalen zu analysieren und sie mit den realen Gegebenheiten der damaligen Zeit zu vergleichen. Dabei wird besonderes Augenmerk auf die unterschiedlichen Formen des Ehebruchs und deren Darstellung in den Novellen gelegt.
- Darstellung von Ehe und Ehebruch im Mittelalter
- Boccaccio's literarische Behandlung von Eheskandalen
- Vergleich zwischen literarischer Fiktion und historischer Realität
- Die Rolle der Frau in Boccaccio's Erzählungen
- Die verschiedenen Arten des Ehebruchs im Dekameron
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung ins Thema: Dieses Kapitel bietet eine Einführung in das Leben und Werk Giovanni Boccaccios, mit besonderem Fokus auf das Dekameron. Es wird der Entstehungskontext des Werkes, die Rahmenhandlung und die zentralen Themen der Novellen skizziert, um den Lesenden einen umfassenden Überblick zu bieten und die Grundlage für die nachfolgenden Kapitel zu schaffen. Der Fokus liegt auf der Kontextualisierung des Dekamerons innerhalb von Boccaccios Gesamtwerk und der damaligen Zeit.
2. Ehe und Ehebruch im Mittelalter: Dieses Kapitel beleuchtet die gesellschaftlichen und rechtlichen Aspekte von Ehe und Ehebruch im Mittelalter. Es beschreibt die damaligen Eheschließungspraktiken, die Rolle des Vaters und die Konsequenzen von Ehebruch für beide Geschlechter. Der Vergleich der Strafen und der gesellschaftlichen Bewertung von Ehebruch bei Männern und Frauen bildet einen Schwerpunkt. Der zweite Teil des Kapitels untersucht die Darstellung von Ehe und Ehebruch in der mittelalterlichen Literatur, wobei verschiedene literarische Gattungen berücksichtigt werden.
3. Ehe und Ehebruch im Dekameron: Dieses Kapitel analysiert die Darstellung von Eheskandalen in ausgewählten Novellen des Dekamerons. Es unterteilt die Analyse in verschiedene Kategorien von Ehebruch: listige Frauen und ihre Liebhaber, Ehebruch durch Zwangsheirat, Ehebruch mit Gewalt und Ehebruch in Verbindung mit dem Klerus. Die Analyse konzentriert sich auf die spezifischen narrativen Strategien, die Boccaccio verwendet, um diese Themen darzustellen, und ihre Bedeutung im Kontext des Gesamtwerkes.
4. Vergleich der Ehe und des Ehebruchs in Literatur und Realität: Dieses Kapitel vergleicht Boccaccios Darstellung von Ehe und Ehebruch mit den historischen Realitäten des Mittelalters. Es untersucht, inwieweit die Novellen eine realistische Darstellung der damaligen Zeit bieten oder ob es sich um fiktive Erzählungen handelt. Der Vergleich soll Aufschluss darüber geben, welche Aspekte Boccaccio möglicherweise übertrieben oder verändert hat, um seine Geschichten effektiver zu gestalten und welche Aspekte er möglicherweise realistisch wiedergegeben hat.
Schlüsselwörter
Giovanni Boccaccio, Dekameron, Ehe, Ehebruch, Mittelalter, Literatur, Novellen, Eheskandale, gesellschaftliche Normen, literarische Darstellung, Realität, Frauenrolle, Klerus, Gewalt.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dekameron: Ehe und Ehebruch im Mittelalter
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit analysiert die Darstellung von Ehe und Ehebruch im Dekameron von Giovanni Boccaccio im Kontext des Mittelalters. Sie vergleicht Boccaccios literarische Schilderung von Eheskandalen mit den historischen Gegebenheiten der damaligen Zeit.
Welche Themen werden im Dekameron behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf verschiedene Formen des Ehebruchs im Dekameron und deren literarische Darstellung. Besonderes Augenmerk liegt auf listigen Frauen und ihren Liebhabern, Ehebruch durch Zwangsheirat, Ehebruch mit Gewalt und Ehebruch in Verbindung mit dem Klerus. Die Rolle der Frau in Boccaccios Erzählungen wird ebenfalls untersucht.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Kapitel 1 bietet eine Einführung in das Leben und Werk Boccaccios und das Dekameron. Kapitel 2 beleuchtet Ehe und Ehebruch im Mittelalter aus gesellschaftlicher und rechtlicher Perspektive sowie deren Darstellung in der mittelalterlichen Literatur. Kapitel 3 analysiert die Darstellung von Eheskandalen in ausgewählten Novellen des Dekamerons. Kapitel 4 vergleicht die literarische Darstellung von Ehe und Ehebruch mit den historischen Realitäten des Mittelalters.
Wie wird Ehebruch im Dekameron dargestellt?
Die Arbeit unterteilt die Darstellung des Ehebruchs im Dekameron in verschiedene Kategorien, um die unterschiedlichen narrativen Strategien Boccaccios zu analysieren und deren Bedeutung im Kontext des Gesamtwerkes zu verstehen. Es werden sowohl die Motive als auch die Konsequenzen des Ehebruchs untersucht.
Welchen Vergleich stellt die Arbeit an?
Die Arbeit vergleicht die fiktive Darstellung von Ehe und Ehebruch im Dekameron mit den historischen Realitäten des Mittelalters. Es wird untersucht, inwieweit Boccaccio die Realität wiedergibt oder seine Geschichten dramatisiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Giovanni Boccaccio, Dekameron, Ehe, Ehebruch, Mittelalter, Literatur, Novellen, Eheskandale, gesellschaftliche Normen, literarische Darstellung, Realität, Frauenrolle, Klerus, Gewalt.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, Boccaccios Schilderung von Eheskandalen zu analysieren und sie mit den realen Gegebenheiten des Mittelalters zu vergleichen. Die unterschiedlichen Formen des Ehebruchs und deren Darstellung in den Novellen stehen dabei im Mittelpunkt.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler, Studenten und alle, die sich für die Literatur des Mittelalters, das Werk Boccaccios, die Darstellung von Ehe und Ehebruch in Literatur und Geschichte interessieren.
Wo finde ich weitere Informationen?
Weitere Informationen könnten in wissenschaftlichen Datenbanken und Literatur zum Dekameron und zum Mittelalter gefunden werden. Die genaue Quelle dieser Zusammenfassung ist nicht in diesem HTML-Dokument enthalten, aber der Inhalt ist aus der Vorlage extrahiert.
- Quote paper
- Christina Meiser (Author), 2003, Untreue als Motiv in Giovanni Boccaccios "Dekameron", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/21739