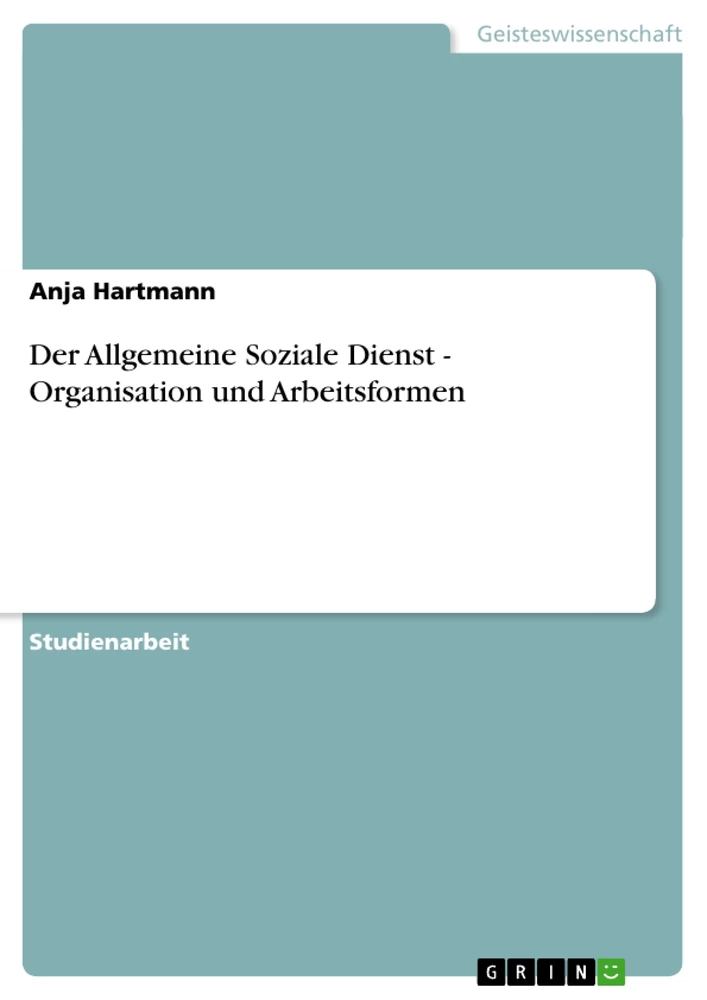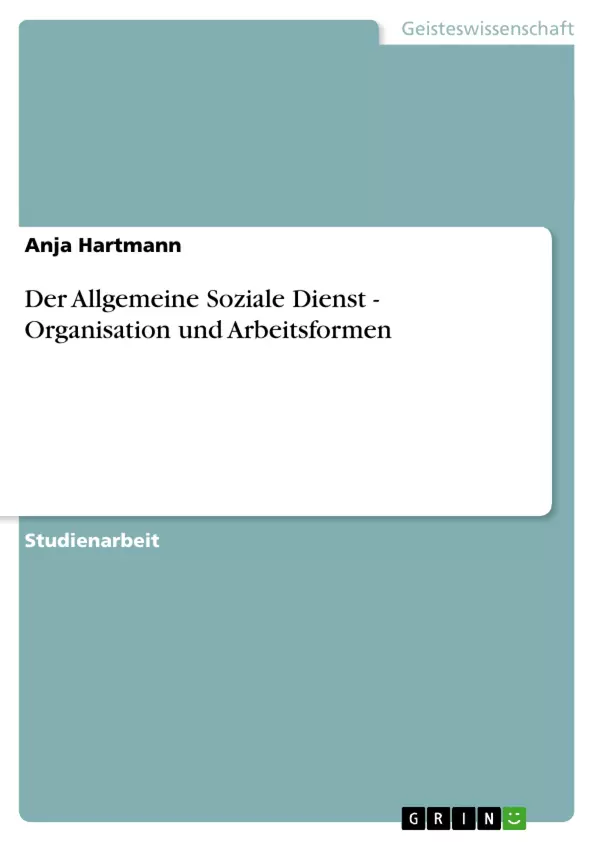Die Stellung des Allgemeinen Sozialen Dienstes (im Folgenden ASD genannt) innerhalb des deutschen Sozialsystems kann als zentral eingeschätzt werden. Innerhalb von Kreis und Kommune fasst er eine Reihe von behördlichen Angeboten zur Familienfürsorge zusammen (vgl. Kreft/Mielenz 1996, S.32). „Der ASD bildet auf der Kommunalen Ebene die Grundlage des Sozialsystems.“ (Textor 1994, S. 9) Der Begriff ASD umschreibt demnach eine institutionelle Gegebenheit einer Kommune, die verschiedenartige Hilfen für Menschen leisten soll und dabei „...annähernd gleiche Ausgangschancen für die Bevölkerung von Städten und Kreisen...“ (Schellhorn/Feldmann 1983, S.15) schafft.
Die Struktur der Allgemeinen Sozialen Dienste hat vielfältige Ausprägungsformen und variiert von Kommune zu Kommune. In welcher Weise die Organisation des ASD aufgebaut ist, hängt maßgeblich von der historischen Entwicklung der Gemeinde und von den Zielen und Standpunkten zur Sozialstruktur innerhalb der Kommune oder des Kreises ab.
„In der Praxis finden sich organisatorische Zuordnungen des ASD zum Jugendamt, zum Sozialamt oder zum Gesundheitsamt. Außerdem gibt es den ASD als selbständige Organisationseinheit.“ (Becker/Mulot/Wolf 1997, S. 843) Des weiteren existieren in den neuen Bundesländern auch Organisationsformen mit reduzierter Aufgabenzuweisung. So ist zum Beispiel mancherorts der ASD ausschließlich für ein Amt, das Sozialamt, das Jugendamt oder das Gesundheitsamt der Kommune tätig. In solchen Gemeinden sind somit 3 allgemeine soziale Dienste vorhanden (vgl. Becker/Mulot/Wolf 1997, S. 843).
Die vorliegende Arbeit will einen Überblick über die Strukturen, Historie, Ziele, Aufgaben, gesetzliche Grundlagen, Handlungsansätze und Arbeitsformen des Allgemeinen Sozialen Dienstes geben und zudem auch einige probleme aufzeigen, die immer wieder auftreten.
Inhaltsverzeichnis
- Begriffbestimmung und Organisationsstruktur
- Geschichtlicher Abriss
- Notwendigkeit und Bedeutung des ASD
- Zielgruppen und Problemlagen
- Zentrale Aufgaben
- Gesetzliche Grundlagen
- Handlungsansätze, Merkmale und spezifische Arbeitsweisen
- dezentrale Organisation / Dekonzentration
- Gehstruktur/Zusammenlegung von Innen- und Außendienst
- Ganzheitlichkeit / Allzuständigkeit
- Generalismus
- Alltags- und Lebensweltbezug
- Prävention
- Partizipation/Wunsch- und Wahlrecht der Bürger
- Hilfe zur Selbsthilfe
- Zusammenarbeit/Wirksamkeit/ Effektivität
- Arbeitsformen
- Einzelfallarbeit
- Gruppen- und Netzwerkorientierte Arbeit
- Gemeinwesen- und Stadtteilarbeit
- politische Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Probleme
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) in Deutschland. Sie beleuchtet seine historische Entwicklung, seine Organisationsstruktur, seine zentralen Aufgaben und die damit verbundenen Herausforderungen. Der Fokus liegt auf der Bedeutung des ASD im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen und der Vielfalt seiner Arbeitsmethoden.
- Historische Entwicklung des ASD
- Organisationsstruktur und -formen des ASD
- Zentrale Aufgaben und Arbeitsweisen des ASD
- Zielgruppen und Problemlagen des ASD
- Herausforderungen und Probleme des ASD
Zusammenfassung der Kapitel
Begriffbestimmung und Organisationsstruktur: Die Stellung des Allgemeinen Sozialen Dienstes (ASD) im deutschen Sozialsystem wird als zentral beschrieben. Der ASD bündelt kommunale Angebote zur Familienfürsorge. Seine Organisationsstruktur variiert je nach Kommune und historischer Entwicklung, mit Zuordnungen zum Jugendamt, Sozialamt oder Gesundheitsamt, oder als eigenständige Einheit. In den neuen Bundesländern existieren auch Formen mit reduzierter Aufgabenzuweisung.
Geschichtlicher Abriss: Die Entstehung des ASD wird im Kontext der Industrialisierung und Verstädterung des 19. Jahrhunderts verortet, als traditionelle Hilfesysteme überfordert waren. Das Elbersfelder System mit seiner Trennung von Arbeitsfähigen und -unfähigen, sowie die Entwicklung der Einheitsfürsorge und Bezirksfürsorge werden als wichtige Schritte in der Entwicklung des ASD hervorgehoben. Das Reichswohlfahrtsgesetz von 1922 und die spätere Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg, einschließlich des Bundessozialhilfegesetzes von 1962, werden ebenfalls diskutiert. Die Umbenennung der Familienfürsorge in Allgemeinen Sozialdienst im Jahr 1975 wird als wichtiger Schritt zur Konsolidierung und umfassenden sozialen Dienstleistung dargestellt.
Notwendigkeit und Bedeutung des ASD: Die Bedeutung des ASD wird durch den gesellschaftlichen Wandel (Individualisierung, Pluralisierung) begründet. Veränderte Familienstrukturen, demografischer Wandel, wirtschaftliche Entwicklungen, Folgen der Wiedervereinigung und zunehmende soziale Problemlagen erhöhen den Bedarf an sozialer Unterstützung. Der ASD fungiert als „Netz unterm sozialen Netz“, nimmt alle Hilfesuchenden auf und koordiniert die Zusammenarbeit mit spezialisierten Diensten.
Zielgruppen und Problemlagen: Der ASD betreut eine breite und differenzierte Klientel, inklusive Männer, Frauen, Kinder, Jugendliche, ältere Menschen, Familien verschiedener Konstellationen und Menschen mit Migrationshintergrund. Die Problemlagen reichen von persönlichen und familiären Schwierigkeiten über materielle Not bis hin zu Wohnproblemen. Die Komplexität und Vielfalt der Problemlagen wird hervorgehoben.
Zentrale Aufgaben: Die zentrale Aufgabe des ASD besteht darin, die psychosoziale Grundversorgung der Bevölkerung zu gewährleisten. Er nimmt auch Fälle an, die von spezialisierten Diensten aufgrund von Zuständigkeitsfragen nicht bearbeitet werden können. Die Arbeit wird von qualifizierten Sozialarbeitern/Sozialpädagogen durchgeführt, mit dem Fokus auf präventiven und ganzheitlichen Hilfen.
Schlüsselwörter
Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD), Familienfürsorge, Sozialarbeit, Sozialpädagogik, Sozialhilfe, Gesellschaftswandel, Individualisierung, Pluralisierung, Prävention, Ganzheitlichkeit, Allzuständigkeit, Zielgruppen, Problemlagen, Gesetzliche Grundlagen, Arbeitsformen, Einzelfallarbeit, Gruppenarbeit, Gemeinwesenarbeit.
Häufig gestellte Fragen zum Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD)
Was ist der Allgemeine Soziale Dienst (ASD) und welche Aufgaben hat er?
Der Allgemeine Soziale Dienst (ASD) ist eine zentrale Einrichtung im deutschen Sozialsystem, die die psychosoziale Grundversorgung der Bevölkerung gewährleistet. Er bündelt kommunale Angebote zur Familienfürsorge und betreut eine breite Klientel mit unterschiedlichsten Problemlagen, von persönlichen Schwierigkeiten bis hin zu materieller Not. Der ASD nimmt auch Fälle an, die von spezialisierten Diensten nicht bearbeitet werden können, und koordiniert die Zusammenarbeit mit anderen Diensten. Seine zentralen Aufgaben umfassen präventive und ganzheitliche Hilfen.
Wie ist der ASD organisiert?
Die Organisationsstruktur des ASD variiert je nach Kommune und historischer Entwicklung. Er kann dem Jugendamt, Sozialamt oder Gesundheitsamt zugeordnet sein oder eine eigenständige Einheit bilden. In den neuen Bundesländern gibt es auch Formen mit reduzierter Aufgabenzuweisung. Die Organisationsformen reichen von dezentraler Organisation bis hin zu Zusammenlegungen von Innen- und Außendienst.
Welche Arbeitsformen verwendet der ASD?
Der ASD arbeitet mit verschiedenen Methoden, darunter Einzelfallarbeit, gruppen- und netzwerkorientierte Arbeit, Gemeinwesen- und Stadtteilarbeit sowie politische und Öffentlichkeitsarbeit. Die Arbeit zeichnet sich durch Ganzheitlichkeit, Generalismus, Allzuständigkeit, Alltags- und Lebensweltbezug, Prävention, Partizipation und Hilfe zur Selbsthilfe aus.
Welche Zielgruppen betreut der ASD?
Der ASD betreut eine breite und differenzierte Klientel: Männer, Frauen, Kinder, Jugendliche, ältere Menschen, Familien verschiedener Konstellationen und Menschen mit Migrationshintergrund. Die Problemlagen der Klienten sind vielfältig und komplex.
Welche gesetzlichen Grundlagen regeln die Arbeit des ASD?
Die gesetzlichen Grundlagen des ASD sind im Laufe der Zeit durch verschiedene Gesetze wie das Reichswohlfahrtsgesetz von 1922 und das Bundessozialhilfegesetz von 1962 geprägt worden. Die Umbenennung der Familienfürsorge in Allgemeinen Sozialdienst 1975 markierte einen wichtigen Schritt zur Konsolidierung und umfassenden sozialen Dienstleistung. Die genauen gesetzlichen Bestimmungen variieren je nach Bundesland und Kommune.
Welche Herausforderungen und Probleme bestehen für den ASD?
Der ASD steht vor verschiedenen Herausforderungen, darunter der gesellschaftliche Wandel (Individualisierung, Pluralisierung), veränderte Familienstrukturen, demografischer Wandel, wirtschaftliche Entwicklungen und zunehmende soziale Problemlagen. Die Komplexität und Vielfalt der Problemlagen stellen hohe Anforderungen an die Mitarbeiter. Die Text erwähnt auch allgemeine Probleme, die genauer im entsprechenden Kapitel beschrieben werden.
Welche historische Entwicklung hat der ASD durchlaufen?
Die Entstehung des ASD wird im Kontext der Industrialisierung und Verstädterung des 19. Jahrhunderts verortet, als traditionelle Hilfesysteme überfordert waren. Das Elbersfelder System, die Einheitsfürsorge und die Bezirksfürsorge waren wichtige Schritte in seiner Entwicklung. Die Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg und das Bundessozialhilfegesetz von 1962 prägten den ASD maßgeblich. Die Umbenennung in Allgemeinen Sozialdienst 1975 symbolisiert die Konsolidierung und Erweiterung seiner Aufgaben.
Welche Schlüsselbegriffe sind mit dem ASD verbunden?
Wichtige Schlüsselbegriffe im Zusammenhang mit dem ASD sind: Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD), Familienfürsorge, Sozialarbeit, Sozialpädagogik, Sozialhilfe, Gesellschaftswandel, Individualisierung, Pluralisierung, Prävention, Ganzheitlichkeit, Allzuständigkeit, Zielgruppen, Problemlagen, Gesetzliche Grundlagen, Arbeitsformen, Einzelfallarbeit, Gruppenarbeit und Gemeinwesenarbeit.
- Quote paper
- Anja Hartmann (Author), 2003, Der Allgemeine Soziale Dienst - Organisation und Arbeitsformen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/21754