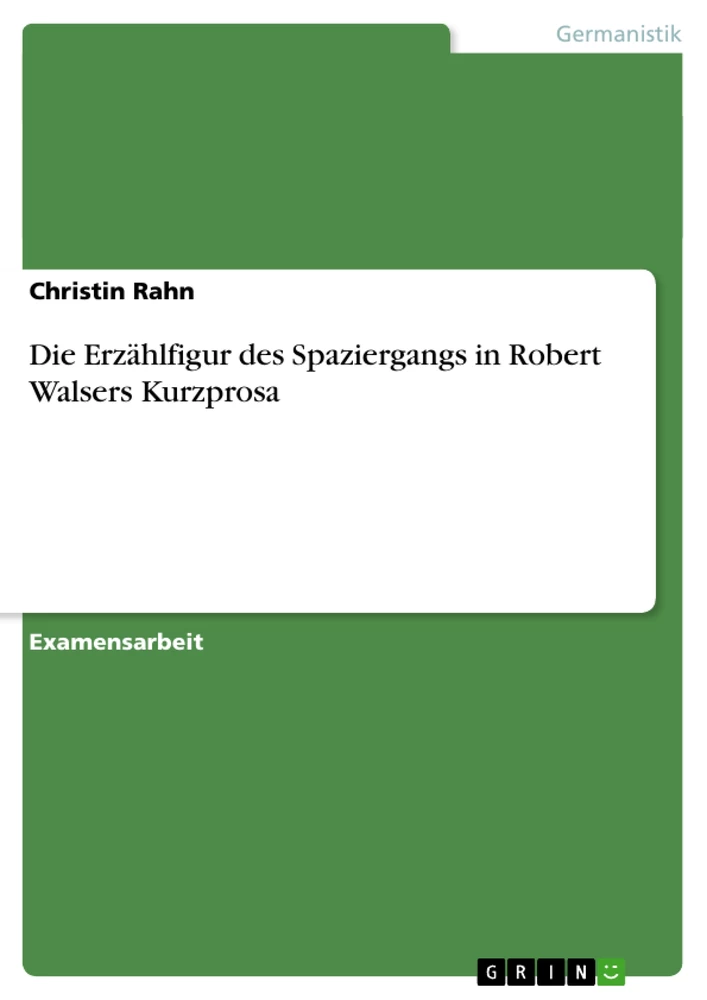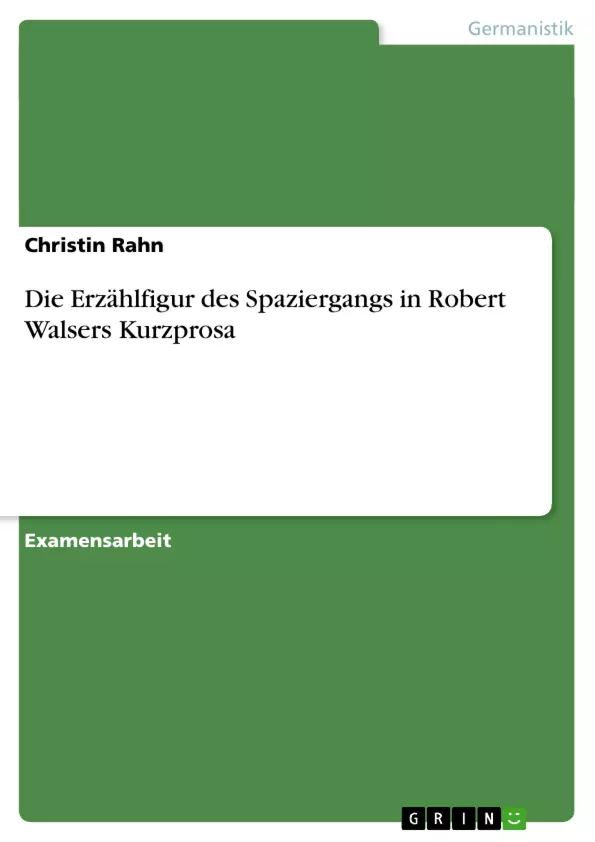Der Aufbau dieser Arbeit orientiert sich an der Chronologie von Robert Walsers
Prosatexten. Dies liegt nahe, da sich zwischen den Texten einer bestimmten Entstehungszeit (v.a. aber in den Bieler Jahren) zahlreiche Ähnlichkeiten und Bezüge
feststellen lassen, so dass die Texte sich bei einer Int erpretation gegebenenfalls gegenseitig
erhellen können. Dieses Verfahren ermöglicht darüber hinaus einen Vergleich der Arbeiten
verschiedener Schaffensphasen, wobei zu überprüfen sein wird, ob die Erzählfigur des
Spaziergangs sich in Walsers Werk verändert.
In der Sekundärliteratur hat es sich durchgesetzt, Walsers Texte bestimmten
Schaffensperioden zuzuordnen; so wird seine frühe Dichtung von der Berliner, der Bieler
und der Berner Phase unterschieden, wobei die Übergänge zwischen den einzelnen Phasen
naturgemäß fließend sind. An diesen Schaffensphasen entlang soll auch hier die Erzählfigur
des Spaziergangs in Walsers Kurzprosa untersucht werden. Dabei stehen hier am Anfang
ganz bewusst keine Arbeitshypothesen. Stattdessen wird sich die Untersuchung, im Sinne
des Spaziergangs, als unvoreingenommener "Gang" durch die einzelnen Spaziergangstexte
vollziehen, bei dem - soweit das möglich ist - der Blick offen bleiben soll für
verschiedenste Entdeckungen. Nach einem ersten einleitenden Teil werden zunächst einze lne Texte, die vor der Berliner
Zeit entstanden sind, betrachtet. In den Berliner Texten wird dann die Großstadt als neues
Motiv bedeutsam, so dass der Spaziergang im dritten Teil der Arbeit unter dem Aspekt der
neuen großstädtischen Umgebung betrachtet werden muss. Mit dem Umzug von Berlin
nach Biel erfolgt eine deutliche Veränderung in Walsers Schreiben, das Motiv des
Spaziergangs rückt nun noch mehr in den Vordergrund und auch stilistisch hebt sich die
Bieler Prosa von den früheren Arbeiten deutlich ab, was im vierten Teil der Arbeit
ausgeführt werden wird. Der Übergang zur Berner Prosa markiert dann in Walsers Werk
nochmals einen auffälligen Wechsel der Gegenständlichkeit, aber auch des Sprachstils. Der
Spaziergang rückt als Motiv in den Hintergrund und die Texte werden immer
unverständlicher. Das umfangreiche Textkorpus der Berner Jahre besteht zum größten Teil
aus zu Walsers Lebzeiten unveröffentlichten Migrogrammschriften, deren Analyse den
Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. Daher wird die Berner Prosa nur in einem kurzen
Ausblick auf die Entwicklung der Erzählfigur des Spaziergangs behandelt werden. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vorhaben
- Walser, ein "Shakespeare des Prosastücks"
- Probleme bei der Gattungszuordnung
- Walser als "Zeitungslieferant"
- Das Prosastück als Formprinzip
- Erste Annäherung an den Spaziergang
- Die kulturgeschichtliche Entwicklung des Spaziergangs
- Schelles Theorie des Spaziergangs
- Gehen und Spazieren in der Literatur
- Der Spaziergang in Walsers früher Prosa
- "Der Greifensee"
- Textanalyse
- Baẞlers Interpretationsansatz
- Ergebnis
- Elisabetta Niccolini: Der Spaziergang als poetologisches Konzept
- Weitere Texte aus Walsers Frühwerk
- "Fritz Kochers Aufsätze"
- "Ein Maler"
- "Simon"
- Zusammenfassung
- "Der Greifensee"
- Berlin: Spazieren in der Großstadt
- Robert Walser in Berlin
- Exkurs: Großstadtliteratur und die Figur des Flaneurs
- Der Schriftsteller als Flaneur in der französischen Großstadtdichtung
- Die Großstadt und der Flaneur in der deutschen Literatur
- Die Erzählfigur des Spaziergangs in Walsers Berliner Kurzprosa
- Walser, ein Flaneur in Berlin?
- "Guten Tag, Riesin!" und "Fabelhaft"
- "Der Park" und "Tiergarten"
- "Friedrichstraße", "Berlin W" und "Großstadtstraße"
- Zusammenfassung
- Der Spaziergang als Zentrum der Bieler Prosa
- Der Umbruch in der Bieler Dichtung
- Die Erzählfigur des Spaziergangs in Walsers Bieler Prosa
- Zum Beispiel: "Fußwanderung"
- Die Wiederholung des Immergleichen
- Sprachwucherung
- Der Blick hinter die Idylle
- Zusammenfassung
- "Der Spaziergang"
- Vorbemerkung
- Analyse
- Ergebnis
- Der Spaziergang als Schreibverfahren
- Gegenüberstellung: Untersuchungsergebnis und Interpretationsansätze
- Die Berner Prosa als Interpretationsschlüssel
- Zum Beispiel: "Zückerchen"
- Schreiben um des Schreibens Willen
- Ergebnis: Schreiben als Spaziergang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende wissenschaftliche Arbeit befasst sich mit der Bedeutung der Erzählfigur des Spaziergangs in der Kurzprosa von Robert Walser. Sie untersucht, wie das Motiv des Spaziergangs die Form und Inhalte der Texte prägt und wie es sich in den verschiedenen Schaffensphasen Walsers entwickelt.
- Analyse des Spaziergangsmotivs in seiner Vielfältigkeit
- Bedeutung der formalen Gestaltung der Spaziergangstexte
- Untersuchung der Veränderungen des Spaziergangsmotivs in den verschiedenen Schaffensphasen
- Einbezug der Natur und der Großstadt als Orte des Spaziergangs
- Die Rolle des Spaziergangs als Schreibverfahren
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die das Vorhaben der Arbeit, die Besonderheiten von Walsers Prosastücken und die Bedeutung des Spaziergangs in seinem Werk erläutert. Das zweite Kapitel untersucht den Spaziergang in Walsers früher Prosa am Beispiel von "Der Greifensee" und analysiert die Bedeutung dieses Motivs im Kontext der damaligen Zeit. Der dritte Teil der Arbeit widmet sich der Berliner Phase Walsers und betrachtet den Spaziergang im Kontext der Großstadtliteratur und der Figur des Flaneurs. Im vierten Kapitel wird der Schwerpunkt auf die Bieler Prosa gelegt und die tiefgreifende Veränderung, die der Spaziergang in Walsers Werk erfährt, herausgestellt. Abschließend werden die Erkenntnisse der Arbeit in einem Kapitel zusammengefasst und die Berner Prosa als weitere Entwicklungsstätte der Erzählfigur des Spaziergangs beleuchtet.
Schlüsselwörter
Robert Walser, Kurzprosa, Erzählfigur des Spaziergangs, Spaziergangsmotiv, Form und Inhalt, Großstadtliteratur, Flaneur, Bieler Prosa, Berner Prosa, Schreibverfahren.
- Quote paper
- Christin Rahn (Author), 2002, Die Erzählfigur des Spaziergangs in Robert Walsers Kurzprosa, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/21971