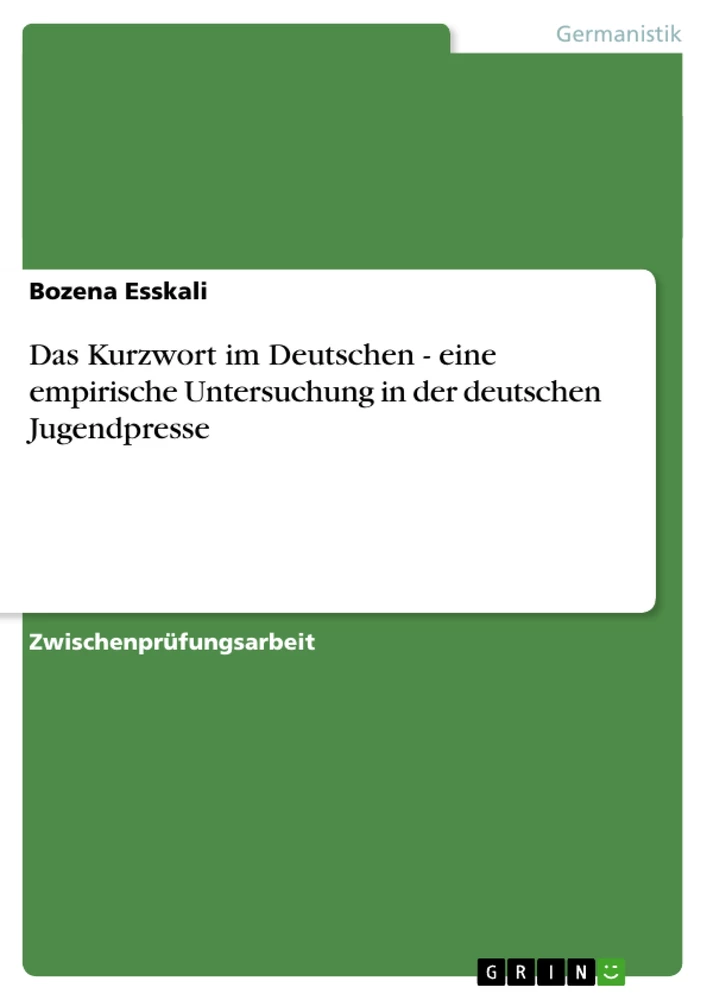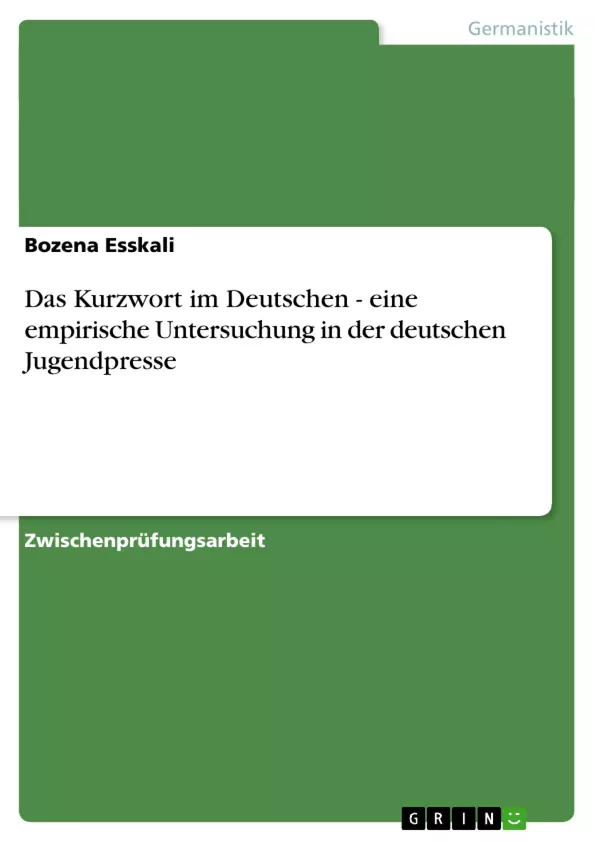Kurzwörter sind ein Phänomen, das mit der Entwicklung der Sprache entstanden ist. Die ersten Kurzwörter benutzte man in der gesprochenen Sprache um Personennamen abzukürzen. Mit der Entstehung der Alphabetschrift wurden vor allem Kurzwörter verbreitet, die aus den Anfangsbuchstaben (Initialen) von einzelnen Wörter gebildet waren. Aber die bedeutsame Zunahme und Ausbreitung von Kurzwörtern fing erst mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts an. Erst in diesem Jahrhundert hat man angefangen, die Kurzwörter zu untersuchen und zu typologisieren. In der vorliegenden Arbeit möchte ich mich mit den Kurzwörtern im Deutschen befassen. In dem heutigen Deutsch treten oft verschiedene Arten der Wortkürzung auf, die aber nicht zu den Kurzwörtern gezählt werden können. Ich möchte diese Kürzungserscheinungen von meinem Untersuchungsgegenstand ausgrenzen und kurz erläutern. Es handelt sich um mehrfach im Text genannte Wortteile, die oft gekürzt und durch Konjunktionen ersetzt werden:
(1a) Blumen- und Gemüsebeete
Sie werden jedoch als eine Art Halbkomposita und nicht als Kurzwort betrachtet. Auch auf der phonologischen Ebene treten Kürzungen in der Form der Aphärese, der Apokope und der Synkope (Lautwegfall am Wortanfang, Wortende oder in der Mitte) auf. Sie zählen nicht zu den Kurzwörtern.
(2 a) raus aus heraus
Eine Art der Kürzung, aber kein Kurzwort, ist auch Haplologie, wo eine von zwei gleichen Silben im Wort ausgelassen wird:
(3 a) Zauberin statt Zaubererin
Zu den umstrittensten sprachlichen Kürzungen gehören die Abkürzungen. Es sind Schriftabkürzungen, die nur eine graphische Form haben und keine eigene Lautgestalt besitzen. Sie werden immer nur so ausgesprochen, wie ihre Vollform ausgeschrieben wird.
(4 a) /u.s.w./: /und so weiter/
Da der Schwerpunkt meiner Arbeit in der Untersuchung der Kurzwörter im Deutschen liegt, habe ich die Abkürzungen und die anderen schon erwähnten Kürzungsverfahren ausgelassen. In dem ersten Teil meiner Arbeit möchte ich mich mit der Bildung, der Stellung und den homonynenbildenden Kurzwörtern befassen. Anschließen versuche ich, mit Hilfe von empirischen Untersuchungen, die Tendenzen im Gebrauch einiger Kurzworttypen in der studentischen Presse darzustellen
Inhaltsverzeichnis
- Verzeichnis der wichtigsten Kurzformen
- Einführung
- 1. Die Relationen zwischen Kurzwort und Basislexem
- 2. Kriterien zur Beschreibung und Typologisierung der Kurzwörter
- 3. Haupttypen der Kurzwörter
- 3.1. Unisegmentale Kurzwörter
- 3.1.1. Kopfwörter
- 3.1.2. Endwörter
- 3.1.3. Rumpfwörter
- 3.2. Partielle Kurzwörter
- 3.3. Multisegmentale Kurzwörter
- 3.3.1. Silbenkurzwörter
- 3.3.2. Mischkurzwörter
- 3.3.3. Initialkurzwörter
- 3.3.3.1. Mit dem Lautwert realisierte Initialwörter
- 3.3.3.2. Initialkurzwörter mit dem Buchstabennamen realisiert
- 4. Homonymenbildende Kurzwortvarianten
- 5. Die Integration der Kurzwörter in das Sprachsystem
- 6. Zum Gebrauch einiger Kurzworttypen anhand einer Untersuchung
- 7. Schlußwort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Entstehung, Verwendung und Typologisierung von Kurzwörtern in der deutschen Sprache. Im Fokus stehen die Beziehungen zwischen Kurzwörtern und ihren Basislexemen, sowie die verschiedenen Kriterien zur Klassifizierung von Kurzwörtern. Darüber hinaus werden die wichtigsten Typen von Kurzwörtern und ihre Integration in das Sprachsystem untersucht.
- Die Beziehung zwischen Kurzwort und Basislexem
- Kriterien zur Beschreibung und Typologisierung von Kurzwörtern
- Haupttypen von Kurzwörtern
- Die Integration der Kurzwörter in das Sprachsystem
- Gebrauch von Kurzworttypen in der studentischen Presse
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die historische Entwicklung von Kurzwörtern und die Bedeutung der Kürzung im Deutschen. Im ersten Kapitel wird die Beziehung zwischen Kurzwörtern und ihren Basislexemen untersucht. Das zweite Kapitel erläutert die Kriterien zur Beschreibung und Typologisierung der Kurzwörter. Das dritte Kapitel präsentiert die wichtigsten Typen von Kurzwörtern und unterteilt sie in uni-, partiell- und multisegmentale Kurzwörter.
Kapitel 4 analysiert homonymenbildende Kurzwortvarianten, während Kapitel 5 die Integration der Kurzwörter in das Sprachsystem beleuchtet. Kapitel 6 untersucht den Gebrauch einiger Kurzworttypen anhand einer Untersuchung in der studentischen Presse. Das letzte Kapitel fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Kurzwort, Basislexem, Wortkürzung, Typologie, Sprachsystem, Homonymie, studentische Presse, empirische Untersuchung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Kurzwort im sprachwissenschaftlichen Sinne?
Ein Kurzwort ist eine durch Kürzung eines Basislexems entstandene neue Wortform, die eine eigene Lautgestalt besitzt (z.B. „Uni“ für Universität).
Was ist der Unterschied zwischen Abkürzungen und Kurzwörtern?
Abkürzungen (wie „u.s.w.“) werden als Vollform ausgesprochen, während Kurzwörter (wie „LKW“ oder „Kopfhörer“) als eigenständige Wörter gesprochen werden.
Was sind Kopfwörter und Endwörter?
Kopfwörter behalten den Anfang des Wortes (Auto - Automobil), Endwörter behalten den Schluss (Bus - Omnibus).
Was sind Initialkurzwörter?
Dies sind Kurzwörter, die aus den Anfangsbuchstaben mehrerer Wörter gebildet werden, wie z.B. „BMW“ oder „DVD“.
Warum sind Kurzwörter in der Jugendpresse so häufig?
Sie dienen der Sprachökonomie, wirken modern und grenzen oft die eigene Gruppe (Studenten/Jugendliche) sprachlich ab.
- Citation du texte
- Bozena Esskali (Auteur), 2000, Das Kurzwort im Deutschen - eine empirische Untersuchung in der deutschen Jugendpresse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/22053