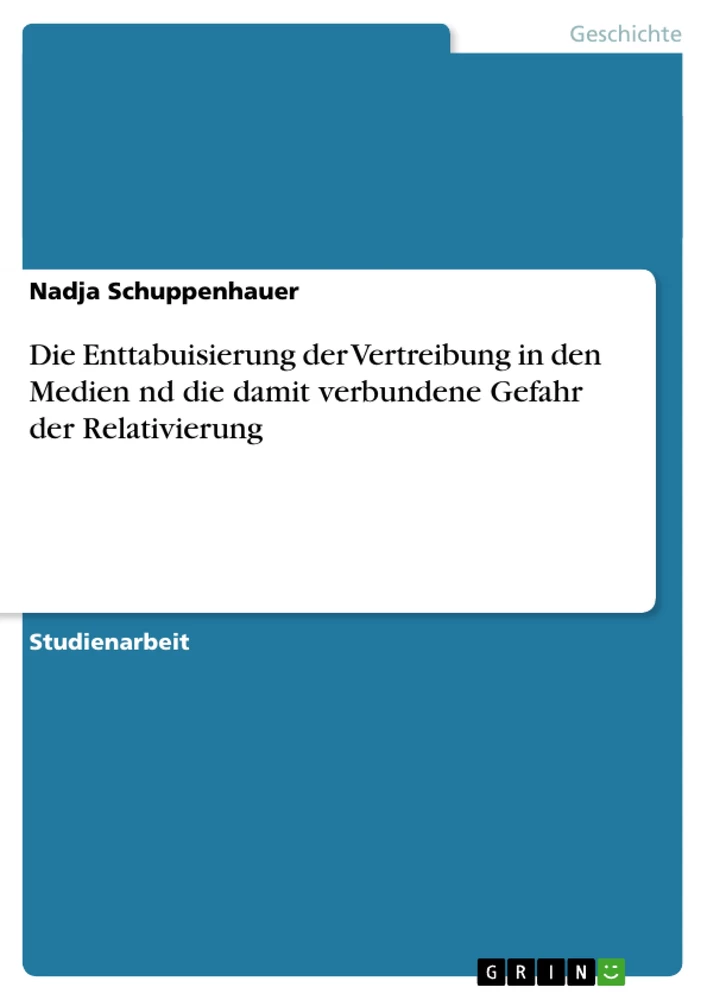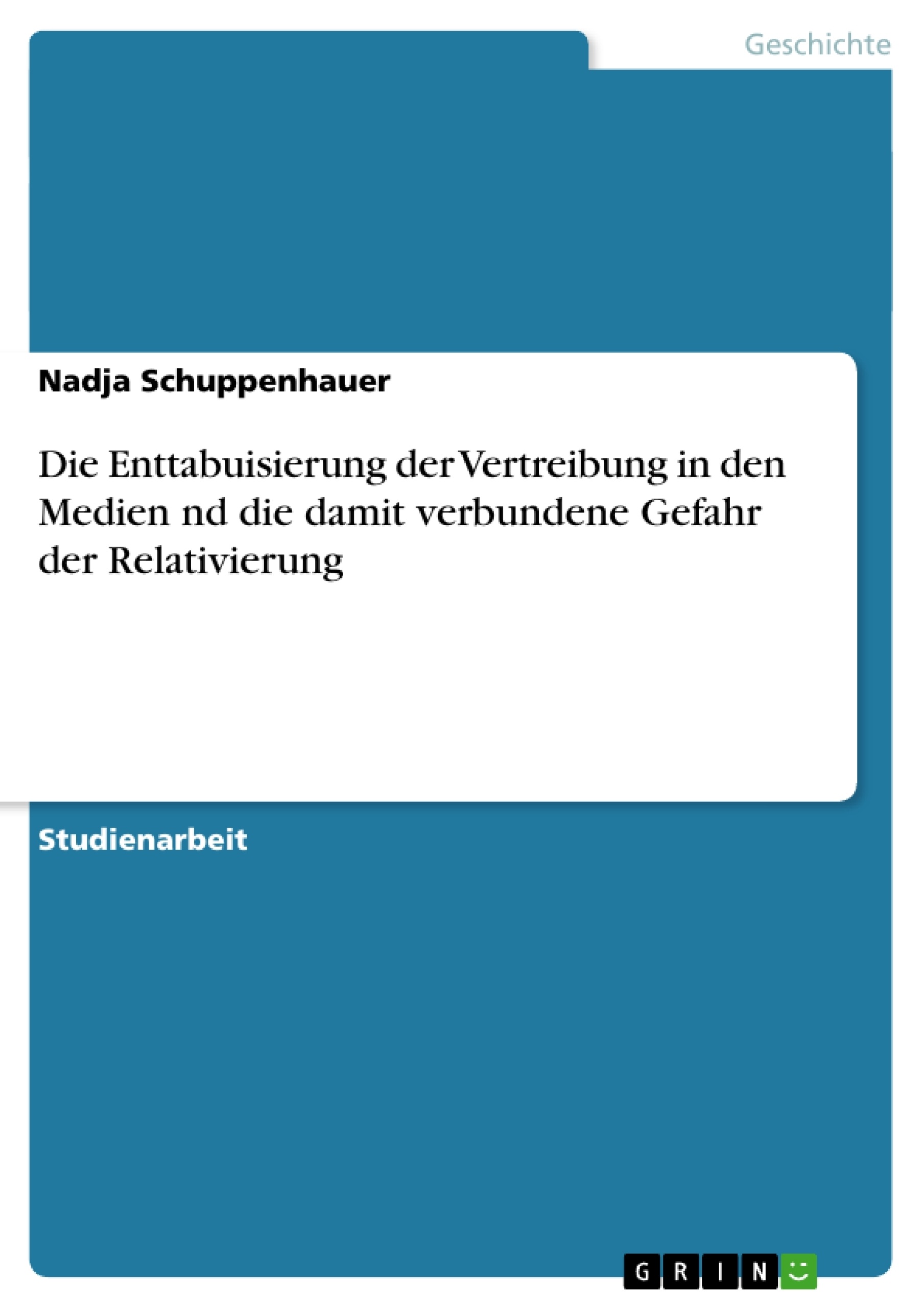Die vorliegende Arbeit untersucht das in der deutschen Medienöffentlichkeit neu entfachte Interesse an der Vertreibung der Deutschen, das mit der Veröffentlichung von Günter Grass‘ Novelle „Im Krebsgang“ im Frühjahr 2002, die den Untergang der Wilhelm Gustloff schildert, einsetzte. Im Besonderen wird die unterschiedliche Behandlung, die die Thematik in den beiden deutschen Staaten in der Zeit vom Ende des Zweiten Weltkrieges an sowohl auf der politischen als auch der öffentlichen Ebene erfahren hat, betrachtet, um den Wandel von dem Tabuthema „Vertreibung“ zu einer zentralen Thematik in den öffentlichen Medien zu verfolgen. Die Untersuchung der damit verbundenen Gefahr der Relativierung der damaligen Geschehnisse und deren unterschiedliche Interpretation in den diversen öffentlichen Medien soll verdeutlichen, dass die Diskussion des Themas und dessen Verständnis erst am Anfang steht und noch sehr viel Aufklärungsarbeit nötig ist. Die Opferperspektive, aus der die Öffentlichkeit auch sechzig Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges das Thema angeht, spricht den Bemühungen und den bereits erzielten Forschungsergebnissen von Wissenschaftlern und Historikern Hohn. Die Forschung ist seit geraumer Zeit, nicht zuletzt auch dank des internationalen Dialogs mit Wissenschaftlern aus den „Vertreiberstaaten“ dazu übergegangen, das Vertreibungsgeschehen in einen gesamteuropäischen Kontext zu stellen und vor seinem historischen Hintergrund einzuordnen. Das Vertreibungsgeschehen in der Öffentlichkeit aber wird immer noch isoliert betrachtet und lässt das Aktions-Reaktions-Schema außer acht, das zu den Ereignissen geführt hat, die Behandlung des Themenkomplexes setzt meist erst mit dem Jahre 1945 ein. Die Kluft zwischen Öffentlichkeit und Forschung kann gut an der Auseinandersetzung über das Errichten eines „Zentrums gegen Vertreibung“ verfolgt werden, die im Rahmen dieser Arbeit ebenfalls angeschnitten wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Vertreibung in den Medien und in der Öffentlichkeit vom Ende des 2. Weltkrieges an bis zum heutigen Datum
- SBZ/DDR
- Bundesrepublik Deutschland
- Die Zeit nach 1989
- Aktuelle Mediendebatte
- Augenscheinliche Erleichterung
- Tendenzielle Berichterstattung aus Opfersicht
- Kritische Stimmen
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem neu entfachten Interesse an der Vertreibung der Deutschen in der deutschen Medienöffentlichkeit, das durch Günter Grass' Novelle „Im Krebsgang“ ausgelöst wurde. Sie analysiert die unterschiedliche Behandlung des Themas in der DDR und der Bundesrepublik und verfolgt den Wandel vom Tabuthema „Vertreibung“ zu einer zentralen Thematik in den öffentlichen Medien.
- Die unterschiedliche Behandlung des Themas „Vertreibung“ in der DDR und der Bundesrepublik
- Der Wandel vom Tabuthema „Vertreibung“ zu einer zentralen Thematik in den öffentlichen Medien
- Die Gefahr der Relativierung der damaligen Ereignisse und deren unterschiedliche Interpretation in den Medien
- Die Kluft zwischen der öffentlichen Wahrnehmung und der wissenschaftlichen Forschung zum Thema Vertreibung
- Die Bedeutung der Opferperspektive im Kontext der historischen Ereignisse
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und beleuchtet den Hintergrund des neu erwachten Interesses an der Vertreibung in der deutschen Medienöffentlichkeit. Sie verweist auf die unterschiedliche Behandlung des Themas in den beiden deutschen Staaten und betont die Notwendigkeit weiterer Aufklärungsarbeit.
- Die Vertreibung in den Medien und in der Öffentlichkeit vom Ende des 2. Weltkrieges an bis zum heutigen Datum: Dieses Kapitel untersucht die Entwicklung der Vertriebenenpolitik und die damit verbundene Behandlung des Themas in der Öffentlichkeit in der DDR und der Bundesrepublik. Es wird die unterschiedliche Vorgehensweise in beiden Staaten beleuchtet und die Zielsetzung der Integration der Vertriebenen hervorgehoben. Der Schwerpunkt liegt auf der Tabuisierung des Vertriebenenthemas und der unterschiedlichen Ansätze in beiden deutschen Staaten.
- SBZ/DDR: Dieses Kapitel beschreibt die strikte Tabuisierung des Vertriebenenthemas in der DDR. Es werden die Gründe für die Einführung des Begriffs „Umsiedler“ anstelle von „Vertriebener“ und die politische Instrumentalisierung des Themas im Kalten Krieg erläutert.
- Bundesrepublik Deutschland: Dieses Kapitel beschreibt die allmähliche Lockerung des Koalitionsverbots für Vertriebene in den Westzonen und die Entstehung von Vertriebenenverbänden und Landsmannschaften. Es wird die Gründung der Vertriebenenpartei GB/BHE und deren Rolle in der deutschen Politik beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Themenkomplex der Vertreibung der Deutschen aus den ehemaligen Ostgebieten nach dem Zweiten Weltkrieg. Im Vordergrund stehen die Analyse der Medienberichterstattung, die unterschiedliche Behandlung des Themas in der DDR und der Bundesrepublik sowie die Gefahr der Relativierung der historischen Ereignisse. Zentrale Begriffe sind Vertreibung, Umsiedlung, Tabuisierung, Medienöffentlichkeit, Opferperspektive, historische Forschung und der internationale Dialog.
Häufig gestellte Fragen
Welches Ereignis löste das neue Interesse am Thema Vertreibung aus?
Die Veröffentlichung von Günter Grass’ Novelle „Im Krebsgang“ im Jahr 2002 gilt als Zündfunke für die entfachte Mediendebatte über die Vertreibung der Deutschen.
Wie unterschied sich der Umgang mit der Vertreibung in der DDR und der BRD?
In der DDR wurde das Thema weitgehend tabuisiert und die Betroffenen als „Umsiedler“ bezeichnet, während in der BRD Vertriebenenverbände eine politische Rolle spielten.
Was wird an der aktuellen Berichterstattung kritisiert?
Kritiker sehen die Gefahr einer Relativierung der NS-Verbrechen, wenn die Vertreibung isoliert aus einer reinen Opferperspektive betrachtet wird.
Was ist das „Zentrum gegen Vertreibung“?
Es handelt sich um ein umstrittenes Projekt zur Dokumentation der Vertreibung, das eine Kluft zwischen öffentlicher Wahrnehmung und wissenschaftlicher Forschung verdeutlicht.
Warum fordern Historiker eine Einordnung in den gesamteuropäischen Kontext?
Um das Aktions-Reaktions-Schema zu verstehen, muss die Vertreibung vor dem historischen Hintergrund des Zweiten Weltkriegs und im Dialog mit den Nachbarstaaten betrachtet werden.
- Citation du texte
- Nadja Schuppenhauer (Auteur), 2003, Die Enttabuisierung der Vertreibung in den Medien nd die damit verbundene Gefahr der Relativierung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/22214