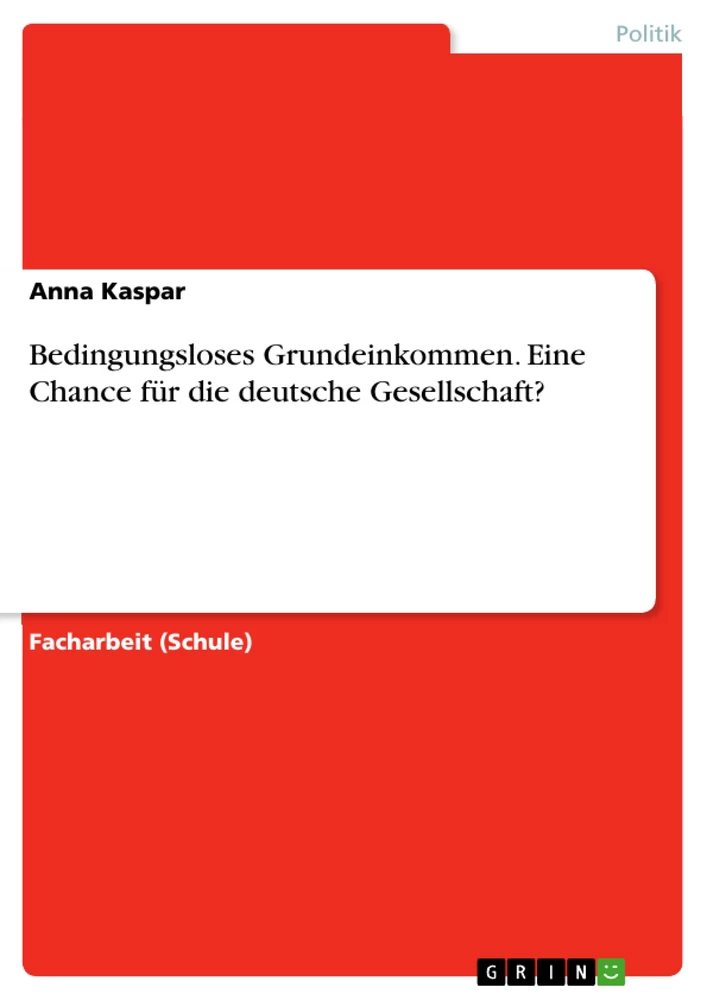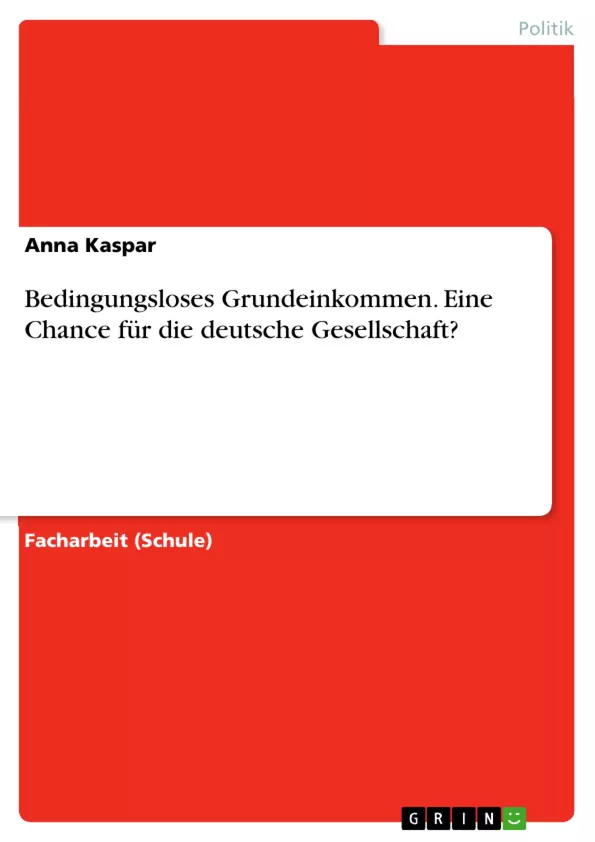„Die Würde des Menschen ist unantastbar“1. Dies ist Artikel 1 im deutschen Grundgesetz. Die derzeitige Strukturierung der sozialen Grundsicherung lässt Zweifel aufkommen, ob dies wirklich der Fall ist. Immer mehr Menschen wechseln aus Existenzangst ihren Wohnort, um woanders einen Job zu bekommen. Viele kämpfen seit Jahren mit der Verunsicherung in befristeten Beschäftigungsverhältnissen. Einige verzichten sogar auf weitere Kinder, da sich dies als zu große finanzielle und psychische Belastung niederschlagen würde. Im Rahmen meiner Hausarbeit, die ich über „Inwiefern beeinflusst unsere Ernährung die Umwelt?“ schrieb, wurde mein Bewusstsein für viele derzeitige Missstände größer. Mein Wunsch nach sozialer Gerechtigkeit, Freiheit, Verantwortung und Nachhaltigkeit wurde immer stärker. Wie wollen wir unser Zusammenleben auf der Erde gestalten? Was ist uns als Gesellschaft wichtig?
Inhaltsverzeichnis
1. Abkürzungsverzeichnis
2. Einleitung
3. Begriffliche Definition
3.1. Bedingungsloses Grundeinkommen
3.2. Arbeit
4. Bedingungsloses Grundeinkommen
4.1. Historische Entwicklung der Idee
4.2. Konzepte/Modelle
4.3. Negative Einkommenssteuer nach Milton Friedman
5. Hervorgehobenes Konzept nach Götz W. Werner
5.1. Zur Person Götz W. Werners
5.2. Philosophischer Ansatz und das dahinterstehende Menschenbild
5.3. Finanzierung
6. Fazit
7. Quellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Anmerkung: In dem vorliegenden Text wird lediglich und ausschließlich aus Gründen des besseren Leseflusses häufig nur die männliche Form verwendet. Selbstverständlich sind dabei immer beide Geschlechter angesprochen.
1. Einleitung
„Die Würde des Menschen ist unantastbar“[1]. Dies ist Artikel 1 im deutschen Grundge- setz. Die derzeitige Strukturierung der sozialen Grundsicherung lässt Zweifel aufkom- men, ob dies wirklich der Fall ist. Immer mehr Menschen wechseln aus Existenzangst ihren Wohnort, um woanders einen Job zu bekommen. Viele kämpfen seit Jahren mit der Verunsicherung in befristeten Beschäftigungsverhältnissen. Einige verzichten sogar auf weitere Kinder, da sich dies als zu große finanzielle und psychische Belastung nie- derschlagen würde. Im Rahmen meiner Hausarbeit, die ich über „Inwiefern beeinflusst unsere Ernährung die Umwelt?“ schrieb, wurde mein Bewusstsein für viele derzeitige Missstände größer. Mein Wunsch nach sozialer Gerechtigkeit, Freiheit, Verantwortung und Nachhaltigkeit wurde immer stärker. Wie wollen wir unser Zusammenleben auf der Erde gestalten? Was ist uns als Gesellschaft wichtig?
Das erste Mal gehört habe ich von der Idee des Bedingungslosen Grundeinkommens (BGE) im Zusammenhang mit den hohen Verwaltungskosten, die durch staatliche Transferleistungen entstehen würden. Diese Gelder könne man einsparen und dafür je- dem Menschen ein BGE auszahlen. Klingt erst einmal plausibel. Doch was steckt hinter der Idee? Ich beschäftigte mich näher mit dieser Frage. Ich erfuhr von Götz Werner, dem Gründer der Drogerie-Kette dm. Dieser ist einer der populärsten Befürworter des BGEs. Ich stieß per Zufall auf eine Veranstaltung in Hannover. Im Pavillon hält Götz Werner im Mai 2012 einen Vortrag mit dem Titel „1000 Euro für jeden – Freiheit, Gleichheit, Grundeinkommen“ halten. Ich hoffte, dass mir diese Veranstaltung viel- leicht Antworten auf meine Fragen geben würde. Bei dem Vortrag wurde mir sehr schnell bewusst, dass Götz Werner auf eine ganz andere Art und Weise denkt als ich. Dass er ein anderes Verständnis von Begriffen wie „Arbeit“ oder „Geld“ hat. Seine Ar- gumentation für ein BGE klingt plausibel und einleuchtend, doch wird auf die Finanzie- rung der Idee im Rahmen des Vortrags kaum eingegangen. Es geht anfänglich um das Menschenbild, um die Philosophie dieser Idee. Dies soll auch in der vorliegenden Fach- arbeit der Fall sein. Ich möchte verstärkt einen sozialpolitischen Ansatz als einen wirt- schaftlichen verfolgen. Zunächst werden die Begriffe „Bedingungsloses Grundeinkom- men“ und „Arbeit“ definiert. Danach stelle ich die Idee des BGEs sowohl historisch, als auch aktuell dar. Das BGE Modell von Götz W. Werner wird intensiver behandelt und abschließend soll durch das Fazit auf die Antwort meiner Leitfrage „BGE – Eine Chan- ce für die deutsche Gesellschaft ?“ hingeleitet werden.
2. Begriffliche Definition
Auf Grundlage der folgenden Definition von „Bedingungsloses Grundeinkommen“ und
„Arbeit“ ist diese Facharbeit gestaltet. Alle Annahmen und Denkansätze beziehen sich ausschließlich auf sie.
2.1. Bedingungsloses Grundeinkommen
Das BGE ist ein Betrag, der an jeden Bürger eines Staates ausbezahlt wird, ohne dass von ihm eine Gegenleistung dafür erwartet wird[2]. Dieser Betrag wird ohne Bedürftig- keitsprüfung oder sonstigen Antrag ausgezahlt, er ist auch nicht an eine Arbeitsbereit- schaft gekoppelt, er ist also bedingungslos. Die Höhe des Betrages (oder des Grundein- kommens) soll existenzsichernd sein, das heißt, dass bescheiden, aber menschenwürdig davon gelebt werden kann[3]. Das internationale Netzwerk BIEN legt noch ein weiteres Kriterium für das BGE fest: Es muss einen individuellen Rechtsanspruch begründen[4]. Das heißt, „dass jeder und jede (...) frei über sein oder ihr Grundeinkommen verfügen (soll), unabhängig davon, mit wem er oder sie das Leben teilt.“[5] Heute wird Einkom- men je nach Familienstand (ledig oder verheiratet) unterschiedlich besteuert. Auch wenn Sozialleistungen bezogen werden müssen, macht es einen Unterschied, ob Mann und Frau z.B. eine Liebesbeziehung führen oder in einer Wohngemeinschaft wohnen. Dies soll beim BGE nicht der Fall sein[6].
Das BGE steht im Gegensatz zur heutigen staatlich organisierten Grundversorgung, wie
z.B. dem Arbeitslosengeld II (ALG II). Diese ist an eine Bedürftigkeitsprüfung gekop- pelt und somit nur für einen bestimmten Teil der Gesellschaft zugänglich.
Die Idee des BGEs und die dahinterstehende Philosophie wird im hervorgehobenen Modell nach Götz W. Werner thematisiert.
2.2. Arbeit
Für das Wort „Arbeit“ gibt es viele Definitionen, im Duden findet man unter anderem folgende: a) Ausführung eines Auftrages, b) das Arbeiten, Schaffen, Tätigsein mit etw./jdm. oder für jdn., c) Mühe, Anstrengung; Beschwerlichkeit, Plage, d) Berufsaus- übung, Erwerbstätigkeit; Arbeitsplatz etc. pp.[7]. Bei Wikipedia findet man ebenfalls mehrere Definitionen. Für diese Facharbeit relevant sind die folgenden: a) die Arbeit im
philosophischen Sinne, b) die Arbeit im volkswirtschaftlichen Sinne, c) die Erwerbstä- tigkeit und d) die Lohnarbeit.
Die Lohnarbeit bezeichnet die Arbeit für oder gegen Lohn. Die Erwerbstätigkeit ist die Tätigkeit, mit deren Hilfe der menschliche Lebensunterhalt bestritten werden kann[8].
Die Arbeit im volkswirtschaftlichen Sinne bezeichnet ebenfalls die menschliche Tätig- keit zum Zwecke der Einkommenserzielung (Lohnarbeit/Erwerbstätigkeit), es kann aber auch eine menschliche Tätigkeit sein, die auf die Befriedigung der Bedürfnisse anderer Personen gerichtet ist. Im volkswirtschaftlichen Sinne ist Arbeit, die nicht für Lohn verrichtet wird (z.B. die kostenlos erbrachte Arbeit von Hausfrauen/-männern oder die gemeinnützige, ehrenamtliche Arbeit), keine Arbeit. Der Begriff ist also auf die Er- werbsarbeit reduziert[9].
Die Arbeit im philosophischen Sinne erfasst „alle Prozesse der bewussten schöpferi- schen Auseinandersetzung des Menschen mit der Natur und/oder der Gesellschaft. Sinngeber dieser Prozesse ist immer der eigenverantwortlich handelnde Mensch mit individuellen Bedürfnissen, Fähigkeiten und Anschauungen im Rahmen der aktuellen
Naturgegebenheiten und gesellschaftlichen Arbeitsbedingungen.“[10]
Götz W. Werner greift letztere Definition in seinem BGE-Modell auf, die aber auch oft die Grundlage für andere BGE-Modelle ist. Arbeit wird also nicht auf die Erwerbstätig- keit reduziert, sondern umfasst auch andere Tätigkeiten (wie z.B. das Ehrenamt).
3. Bedingungsloses Grundeinkommen
Die Idee eines Grundeinkommens lässt sich bis ins sechste Jahrhundert vor Christus zurückverfolgen[11]. Heute gewinnt die Idee wieder verstärkt an Aktualität. Es gibt ver- schiedene Modelle und Konzepte zur Finanzierung, die von den unterschiedlichsten Menschen entwickelt wurden. Das Modell der negativen Einkommenssteuer (nE) ist oft Teilkonzept dieser BGE-Modelle, weshalb es in dieser Arbeit einen separaten Platz be- kommt (siehe 3.3.). Im Folgenden soll nun kurz die historische Entwicklung der Idee
zusammengefasst werden und danach sollen die drei populärsten Konzepte inklusive der nE angerissen werden. Das Konzept Götz W. Werners wird gesondert behandelt (siehe 4.).
3.1. Historische Entwicklung der Idee
In der Verfassung Spartas im sechsten Jahrhundert vor Christus gibt es erstmal eine Trennung von Arbeit und Einkommen. Jedem „Vollbürger“ (keine Frauen und Sklaven) wurden lebensnotwendige Güter, unabhängig von Arbeitsleistung und Bedürftigkeit, garantiert[12].
Thomas Morus (englischer Staatsmann und humanistischer Autor[13]) thematisierte sehr
viel später, nämlich in der frühen Neuzeit, die Idee eines Grundeinkommens in seinem Roman „Utopia“ (1516). Um Diebstahl vorzubeugen, wird anstatt der Bestrafung von Dieben die Zahlung eines Lebensunterhalts für jeden Menschen vorgeschlagen.
Thomas Paine (politischer Intellektueller und einer der Gründerväter der Vereinigten Staaten[14]) formulierte, wieder rund zweihundert Jahre später, in „Agrarische Gerechtig- keit“ (1796) die Annahme, dass jeder Mensch ein natürliches Recht auf Grund und Bo- den habe. So soll jeder, der Boden „besitzt“, eine Bodenpacht zahlen, die in einen Fonds fließt. Aus diesem Fonds soll jeder Bürgerin und jedem Bürger eine Summe ausgezahlt werden, die als Entschädigung für den Verlust des natürlichen Erbes verstanden wird.
Joseph Charlier (belgischer Schriftsteller, Jurist, Kaufmann und Buchhalter[15]) veröffent-
lichte 1848 eine Überlegung, die an Paine anknüpft: Der Staat solle jedem Menschen ein Grundeinkommen („Minimum“) auszahlen. Das Geld stamme (wie bei Paine) aus den Abgaben, die bei Erwerb/Nutzung von natürlichen Ressourcen fällig würden. Die- ses Programm würde die „Herrschaft von Kapital über Arbeit beenden“. Der Staat sei jedoch nicht verpflichtet, darüber hinaus für Lebenshaltungskosten aufzukommen. Le- diglich die gerechte Aufteilung von Grund und Boden, wie auch die von natürlichen
Ressourcen, die jedem von Natur aus zustehe, müsse gesichert sein[16].
In den 1920er-Jahren wurde die Idee eines BGEs in Australien, Großbritannien, Kanada und Neuseeland populär. Erich Fromm (deutsch-amerikanischer Psychoanalytiker, Phi- losoph und Sozialpsychologe[17]) plädierte 1955 für ein Existenzminimum mit der Be- gründung, dass eine Arbeit, die jemandem nicht entspräche, abgelehnt werde können müsse, ohne Hunger oder sonstige Nöte leiden zu müssen.
Martin Luther King war einer der prominentesten Befürworter für ein BGE[18]: „Ich bin heute davon überzeugt, dass der einfachste Ansatz sich als der effektivste erweisen wird
[...]
[1] Grundgesetz Artikel 1 , 2012, http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_01.html (Stand: 14.03.13)
[2] vgl. Initiative Grundeinkommen Foehr 2011, http://www.initiative-grundeinkommen-foehr.de/definition.html (Stand: 08.03.13)
[3] vgl. Rätz/Krampertz, 2011, S. 11 & Werner, 2012, http://www.youtube.com/watch?v=lPnCMdn3SVc (Stand: 08.03.13)
[4] Werner/Goeher, 2010, S. 37f
[5] Werner/Goehler, 2010, S. 40
[6] Werner/Goehler, 2010, S. 39f
[7] vgl. Duden, 2013, http://www.duden.de/rechtschreibung/Arbeit (Stand: 08.03.13)
[8] vgl. Wikipedia, 2013, http://de.wikipedia.org/wiki/Arbeit (Stand: 08.03.13)
[9] vgl. Wikipedia, 2012, http://de.wikipedia.org/wiki/Arbeit_(Volkswirtschaftslehre) (Stand: 08.03.13)
[10] Wikipedia, 2013, http://de.wikipedia.org/wiki/Arbeit_(Philosophie) (Stand: 08.03.13)
[11] vgl. Werner/Goehler, 2010, S. 21
[12] vgl. Werner/Goehler, 2010, S. 21
[13] vgl. Wikipedia, 2013, http://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_Morus (Stand: 10.03.13)
[14] vgl. Wikipedia, 2013, http://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_Paine (Stand: 10.03.13)
[15] vgl. Wikipedia, 2011, http://de.wikipedia.org/wiki/Joseph_Charlier (Stand: 10.03.13)
[16] vgl. Werner/Goehler, 2010, S. 21f
[17] Unternimm die Zukunft, Unbekannt, http://www.unternimm-die-zukunft.de/de/zum-grundeinkommen/leporello/ (Stand: 12.03.13)
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt dieser Leseprobe zum Bedingungslosen Grundeinkommen?
Diese Leseprobe bietet eine umfassende Vorschau auf eine Arbeit zum Bedingungslosen Grundeinkommen (BGE). Sie enthält das Inhaltsverzeichnis, Ziele und Schlüsselthemen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter.
Was beinhaltet das Inhaltsverzeichnis?
Das Inhaltsverzeichnis umfasst: Abkürzungsverzeichnis, Einleitung, Begriffliche Definition (Bedingungsloses Grundeinkommen und Arbeit), Bedingungsloses Grundeinkommen (historische Entwicklung, Konzepte/Modelle, Negative Einkommenssteuer nach Milton Friedman), Hervorgehobenes Konzept nach Götz W. Werner (zur Person, philosophischer Ansatz, Finanzierung), Fazit und Quellenverzeichnis.
Was ist die Kernaussage der Einleitung?
Die Einleitung thematisiert die Würde des Menschen (Artikel 1 GG) und hinterfragt, ob die derzeitige soziale Grundsicherung diesem Anspruch gerecht wird. Sie erwähnt die Motivation des Autors, die durch eine vorherige Arbeit über Ernährung und Umwelt geweckt wurde, und den Wunsch nach sozialer Gerechtigkeit, Freiheit, Verantwortung und Nachhaltigkeit.
Wie wird das Bedingungslose Grundeinkommen (BGE) definiert?
Das BGE wird als ein Betrag definiert, der an jeden Bürger eines Staates ausgezahlt wird, ohne Gegenleistung, Bedürftigkeitsprüfung oder Arbeitsbereitschaft. Es soll existenzsichernd sein und einen individuellen Rechtsanspruch begründen.
Welche verschiedenen Definitionen von "Arbeit" werden betrachtet?
Es werden verschiedene Definitionen von "Arbeit" betrachtet, darunter die Definitionen im Duden und bei Wikipedia, insbesondere die philosophische, volkswirtschaftliche, Erwerbstätigkeit und Lohnarbeit.
Welche historische Entwicklung der Idee des BGE wird dargestellt?
Die historische Entwicklung wird von der Verfassung Spartas bis zu Thomas Morus, Thomas Paine, Joseph Charlier, Erich Fromm und Martin Luther King dargestellt.
Was ist die Negative Einkommenssteuer (nE) nach Milton Friedman?
Die Negative Einkommenssteuer wird als Teilkonzept vieler BGE-Modelle erwähnt und bekommt daher einen separaten Platz in der Arbeit.
Was ist das hervorgehobene Konzept nach Götz W. Werner?
Das Konzept von Götz W. Werner, dem Gründer von dm, wird intensiver behandelt, einschließlich seiner Person, seines philosophischen Ansatzes und seiner Vorstellungen zur Finanzierung.
Was ist das Ziel des Fazits?
Das Fazit soll auf die Antwort der Leitfrage "BGE – Eine Chance für die deutsche Gesellschaft?" hinführen.
Was ist die Anmerkung zur Verwendung der männlichen Form im Text?
Es wird darauf hingewiesen, dass aus Gründen des Leseflusses häufig nur die männliche Form verwendet wird, aber selbstverständlich immer beide Geschlechter angesprochen sind.
- Arbeit zitieren
- Anna Kaspar (Autor:in), 2013, Bedingungsloses Grundeinkommen. Eine Chance für die deutsche Gesellschaft?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/229571