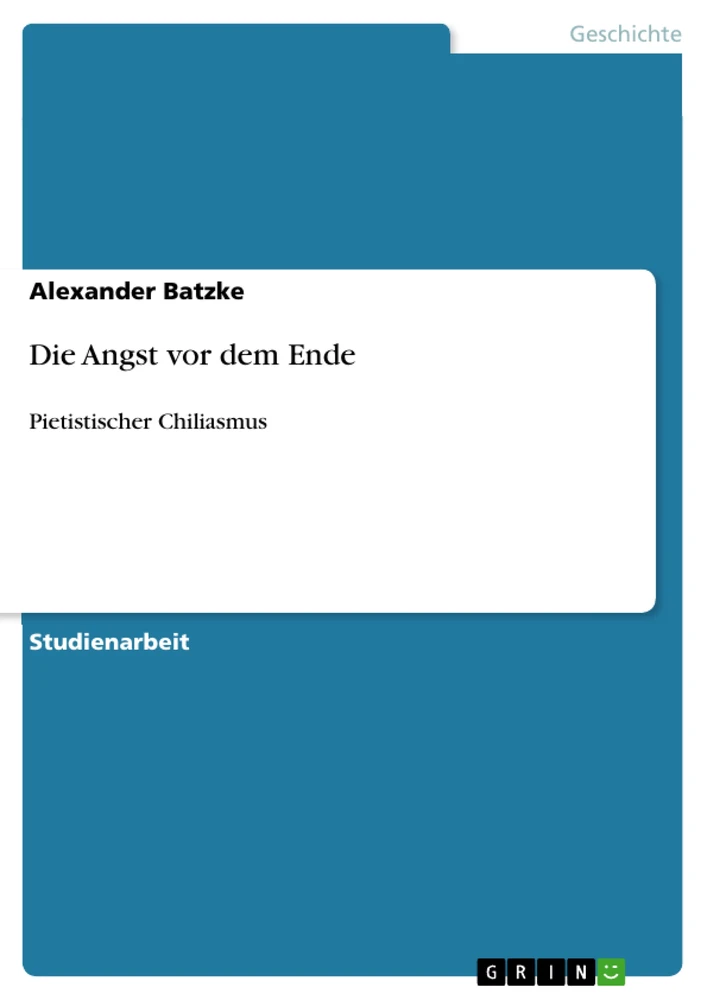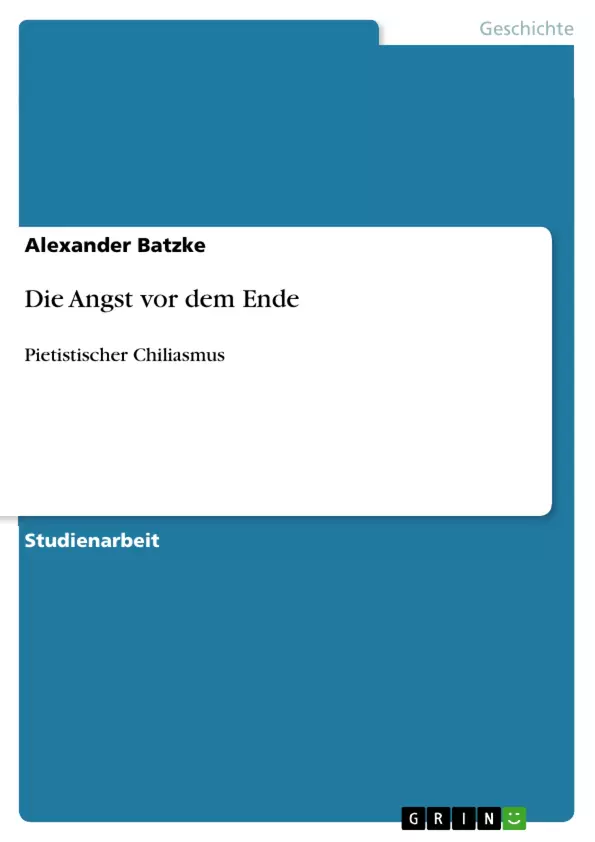Die Angst vor dem Ende. Eine Emotion, die sich durch die Geschichte zieht, wie ein roter Faden. Ob die Sintflut oder die Offenbarung des Johannes in der Bibel oder ganz konkrete Ängste vor dem Ende der bekannten Welt in Mittelalter und (Früher-)Neuzeit, ausgelöst durch Naturkatastrophen oder Wetterphänomene. Stets finden sich Prognosen, Prophetien und Deutungen, die die Angst vor einem bevorstehenden Ende der Welt schüren. Eine besondere Gruppe jedoch grenzte sich komplett von dieser gängigen Angst vor dem Ende ab. Stattdessen erwartete man es sehnlichst: Eine Hoffnung auf bessere Zeiten der Kirche auf Erden.
Denn zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert bildete sich im deutschen Protestantismus, vor allem in Halle und Württemberg, jedoch auch in Skandinavien, den Niederlanden, der Schweiz, England und Amerika, eine Frömmigkeitsbewegung heraus, die sich in vielen Punkten von den Lehren der Reformatoren abgrenzte. Die Anhänger dieser Gruppe wurden Pietisten genannt. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dieser Frömmigkeitsbewegung und deren Eschatologie.
Zuerst wird in einem historischen Abriss erklärt, worum es sich dabei handelte, und die wichtigsten Vertreter der Bewegung vorgestellt. Danach wird im Hauptteil der Arbeit anhand der Wochenbücher der Beate Paulus darauf eingegangen, wie sich die Vorstellungen der Pietisten explizit auf eine Biographie auswirkten. Zum Schluss wird noch kurz die Frage erörtert, ob es sich bei der Eschatologie der Pietisten um eine Jenseitsvorstellung oder eine Endzeitvorstellung handelt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Kontext
- 2.1. Pietismus
- 2.2. Chiliasmus
- 2.3. Johann Valentin Andreae
- 2.4. Philipp Jakob Spener
- 2.5. Gottfried Arnold
- 2.6. Das Ehepaar Petersen
- 2.7. Johann Albrecht Bengel
- 2.8. Friedrich Christoph Oetinger
- 3. Hauptteil
- 3.1. Biographie
- 3.2. Pietistische Vorstellungen
- 4. Abschlussfragen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die eschatologischen Vorstellungen des Pietismus im 17. und 18. Jahrhundert. Sie beleuchtet die Abgrenzung des pietistischen Chiliasmus von der allgemeinen Angst vor dem Ende der Welt und analysiert, wie sich diese spezifische Endzeitvorstellung in der Lebensführung der Pietisten niederschlug. Die Arbeit nutzt die Wochenbücher der Beate Paulus als Fallbeispiel.
- Pietismus als Frömmigkeitsbewegung
- Die Rolle des Chiliasmus im Pietismus
- Eschatologische Vorstellungen der Pietisten
- Biographie der Beate Paulus als Fallbeispiel
- Unterscheidung zwischen Jenseits- und Endzeitvorstellung im Pietismus
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Angst vor dem Ende und deren Abgrenzung im pietistischen Kontext ein. Sie beschreibt den Pietismus als eine Frömmigkeitsbewegung im deutschen Protestantismus und skizziert den Aufbau der Arbeit. Es wird die Bedeutung der Wochenbücher der Beate Paulus und relevanter Literatur für die Analyse hervorgehoben. Die Einleitung stellt klar, dass die Arbeit sich mit der spezifischen eschatologischen Sichtweise der Pietisten auseinandersetzt, die sich durch eine sehnsüchtige Erwartung des Endes auszeichnete, im Gegensatz zu einer angstbesetzten Perspektive.
2. Kontext: Dieses Kapitel liefert den historischen und theologischen Hintergrund. Es erklärt den Pietismus als eine Reformbewegung innerhalb des Protestantismus, die eine radikale, Gott-geweihte Lebensführung betonte. Es werden wichtige Vertreter des Pietismus wie Johann Valentin Andreae, Philipp Jakob Spener, Gottfried Arnold, das Ehepaar Petersen, Johann Albrecht Bengel und Friedrich Christoph Oetinger vorgestellt und deren Beiträge zur Bewegung erläutert. Der Begriff des Chiliasmus wird definiert und dessen Bedeutung für die pietistische Eschatologie herausgestellt. Der Abschnitt verdeutlicht die Abweichung der Pietisten von gängigen religiösen Normen und deren Fokus auf eine innige, persönliche Beziehung zu Gott.
3. Hauptteil: Der Hauptteil, gegliedert in die Abschnitte Biographie und Pietistische Vorstellungen, analysiert die Wochenbücher der Beate Paulus. Durch die detaillierte Untersuchung der Lebensgeschichte von Beate Paulus und der Darstellung ihrer religiösen Überzeugungen und Handlungen wird die praktische Umsetzung der pietistischen Eschatologie veranschaulicht. Dieser Teil verbindet theoretische Konzepte mit empirischem Material und liefert somit ein konkretes Beispiel für die im zweiten Kapitel beschriebenen Prinzipien. Die Analyse der Biographie soll die pietistische Endzeitvorstellung in ihren verschiedenen Aspekten veranschaulichen.
Schlüsselwörter
Pietismus, Chiliasmus, Eschatologie, Endzeitvorstellung, Jenseitsvorstellung, Frömmigkeit, Beate Paulus, Wochenbücher, Radikaler Pietismus, Johann Albrecht Bengel, Friedrich Christoph Oetinger, Philipp Jakob Spener.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Eschatologische Vorstellungen im Pietismus am Beispiel der Wochenbücher der Beate Paulus
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die eschatologischen (Endzeit-)Vorstellungen des Pietismus im 17. und 18. Jahrhundert. Sie konzentriert sich insbesondere auf die spezifische Form des Chiliasmus innerhalb des Pietismus und wie sich diese Endzeitvorstellung in der Lebensführung der Pietisten widerspiegelte. Die Wochenbücher der Beate Paulus dienen als Fallbeispiel für die empirische Analyse.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Pietismus als Frömmigkeitsbewegung, die Rolle des Chiliasmus innerhalb des Pietismus, die eschatologischen Vorstellungen der Pietisten im Allgemeinen und im speziellen Fall von Beate Paulus, die Unterscheidung zwischen Jenseits- und Endzeitvorstellung im Pietismus und die Biographie von Beate Paulus.
Welche Personen werden im Kontext des Pietismus erwähnt?
Die Arbeit erwähnt wichtige Persönlichkeiten des Pietismus wie Johann Valentin Andreae, Philipp Jakob Spener, Gottfried Arnold, das Ehepaar Petersen, Johann Albrecht Bengel und Friedrich Christoph Oetinger. Ihre Beiträge zur pietistischen Bewegung und zum Verständnis des Chiliasmus werden erläutert.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Hauptquelle dieser Arbeit sind die Wochenbücher der Beate Paulus. Zusätzlich wird auf relevante Literatur zum Pietismus, Chiliasmus und der eschatologischen Theologie dieser Zeit zurückgegriffen.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Kontextteil, einen Hauptteil und einen Schlussteil (implizit durch die Abschlussfragen angedeutet). Die Einleitung führt in das Thema ein. Der Kontextteil beschreibt den historischen und theologischen Hintergrund des Pietismus und des Chiliasmus. Der Hauptteil analysiert die Wochenbücher der Beate Paulus, um die praktische Umsetzung der pietistischen Eschatologie zu veranschaulichen. Abschließend werden (implizit) Fragen zur Vertiefung des Themas gestellt.
Was ist der Unterschied zwischen der Jenseits- und der Endzeitvorstellung im Pietismus (nach dieser Arbeit)?
Die Arbeit hebt einen Unterschied zwischen einer angstbesetzten Vorstellung vom Jüngsten Gericht und einer sehnsüchtigen Erwartung des Endes innerhalb des pietistischen Chiliasmus hervor. Die genaue Ausarbeitung dieser Unterscheidung ist im Text der Arbeit selbst zu finden.
Was ist der Chiliasmus im Kontext des Pietismus?
Der Chiliasmus, im Kontext dieser Arbeit, beschreibt die spezifische, von Angst freie Endzeitvorstellung innerhalb des Pietismus. Die Arbeit erklärt den Chiliasmus und dessen Bedeutung für die pietistische Eschatologie im Detail.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Pietismus, Chiliasmus, Eschatologie, Endzeitvorstellung, Jenseitsvorstellung, Frömmigkeit, Beate Paulus, Wochenbücher, Radikaler Pietismus, Johann Albrecht Bengel, Friedrich Christoph Oetinger, Philipp Jakob Spener.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für Leser gedacht, die sich für die Geschichte des Pietismus, die eschatologische Theologie und die Frömmigkeitsgeschichte interessieren. Der akademische Fokus und die Verwendung von Quellen wie den Wochenbüchern deuten auf eine Zielgruppe mit Interesse an wissenschaftlicher Auseinandersetzung hin.
- Arbeit zitieren
- B.A. Alexander Batzke (Autor:in), 2010, Die Angst vor dem Ende, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/229821