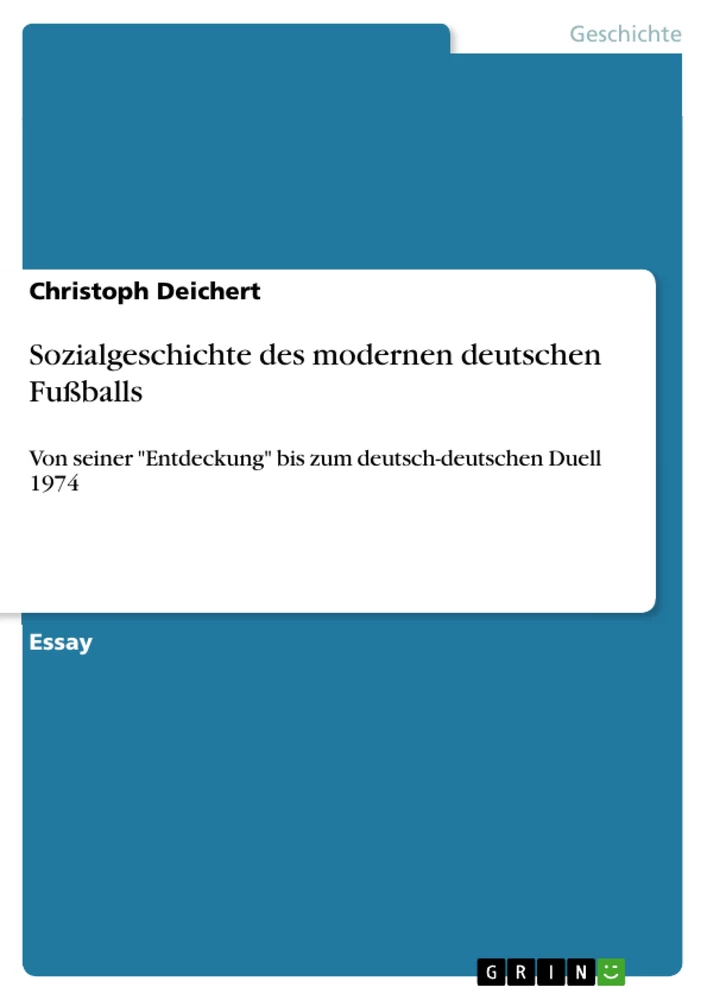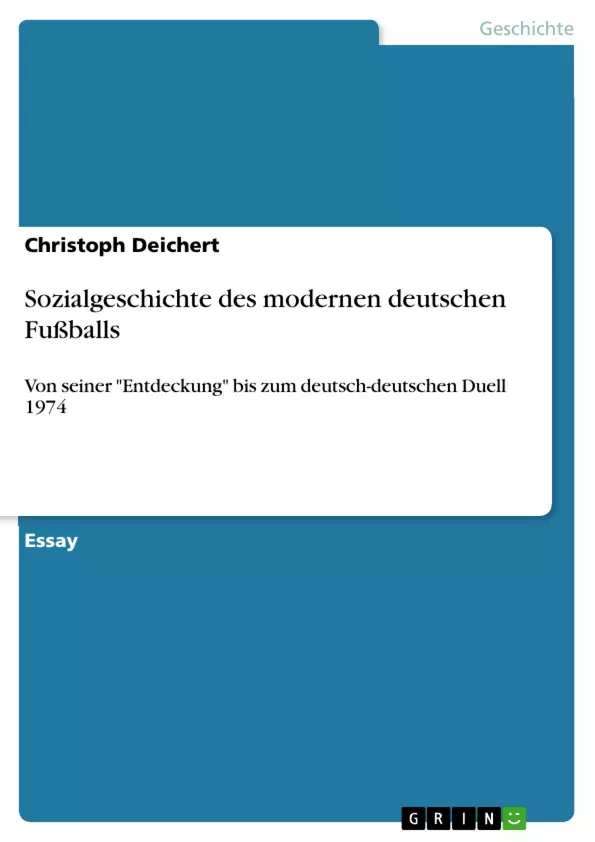Der Fußballsport ist seit seiner Ausbreitung über das „Mutterland“ England hinaus, von Migration begleitet worden. Das Spiel war außerhalb Englands zunächst primär ein Spiel von Migranten. Diese waren englische Kaufleute, Techniker und Akademiker. Ohne Kosmopolitismus und Migration hätte sich der Fußball nicht zu einem globalen Spiel entwickelt. (Vgl.: Schulze-Marmeling 2010 : S. 199) Um den Untersuchungsgegenstand in seinen globalen Charakter einzugrenzen, wird folgender Fragestellung und These nachgegangen:
Wie hat sich der Fußballsport als soziale Praxis in Deutschland entwickelt?
Der Fußballsport vermag es seinem Charakter nach, soziale und gesellschaftliche Elemente der Verbindung und auch der Trennung, in sich, zu vereinen.
Diese These erscheint am logischsten, da der Fußballsport ab dem Kaiserreich in allen politischen und gesellschaftlichen Systemen der deutschen Geschichte praktiziert wurde und diese Systeme hatten jeweils einen anderen Grad der Offenheit und Toleranz.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Mögliche Quellen
- Forschungsstand
- Quellen- und Literaturdiskussion
- Relevanz und Methode
- Die Gründung der ersten Vereine in Deutschland
- Gründung des Deutschen Fußball-Bundes
- Fußball im Ersten Weltkrieg
- Arbeiterfußball in der Weimarer Republik
- Katholischer Fußball in der Weimarer Republik
- Hooligans in der Weimarer Republik
- Sportberichte in der Weimarer Republik und im „Dritten Reich"
- Jüdische Sportvereine im „Dritten Reich"
- Hamburger SV im „Dritten Reich"
- Die Nationalmannschaft im „Dritten Reich"
- Hooligans im „Dritten Reich"
- Länderspiele während des Krieges
- Kontinuitäten in der Nachkriegszeit
- Vom „Wunder von Bern"
- Eklat des DFB-Vorsitzenden
- Fußball als Migrantensport in beiden Deutschlands
- Zuschauerzahlen der DDR Oberliga und der Bundesliga
- Aufeinandertreffen der beiden Deutschlands
- Julius-Hirsch-Preis
- Darstellung in der Kultur
- Fazit
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit verfolgt das Ziel, die Sozialgeschichte des modernen Fußballs in Deutschland von seiner „Entdeckung" bis zum deutsch-deutschen Duell 1974 zu untersuchen. Sie analysiert die Entwicklung des Fußballs als soziale Praxis im Kontext verschiedener politischer und gesellschaftlicher Systeme in Deutschland, wobei der Fokus auf der Interaktion von Integration und Segregation liegt.
- Die Rolle der Migration und des Einflusses aus England auf die Entstehung des Fußballs in Deutschland
- Die Entwicklung von Fußballvereinen und dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) im Kaiserreich und der Weimarer Republik
- Die Auswirkungen des Ersten und Zweiten Weltkriegs auf den Fußballsport und die Rolle der Nationalmannschaft
- Die soziale Segregation und Integration von Migranten im Fußballsport in beiden deutschen Staaten
- Die ideologische Nutzung des Fußballs durch das NS-Regime und die DDR
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Sozialgeschichte des Fußballs in Deutschland ein und stellt die Forschungsfrage und die These der Arbeit vor. Sie beleuchtet die Bedeutung von Migration für die Ausbreitung des Fußballs und die Relevanz des Themas für ein Seminar über Hafenstädte.
Das Kapitel über die Gründung der ersten Vereine in Deutschland analysiert die Rolle von englischen Migranten bei der Einführung des Fußballs in Deutschland und die Gründung des DFBs. Es beleuchtet die Bedeutung von jüdischen Deutschen für die Gründung des DFBs und die frühen Versuche, den Fußballsport zu „germanisieren".
Das Kapitel über den Fußball im Ersten Weltkrieg beschreibt die Bedeutung des Fußballs als Freizeitbeschäftigung für Soldaten und die Rolle des Sports bei der körperlichen Abhärtung nach dem Krieg.
Das Kapitel über Arbeiterfußball in der Weimarer Republik stellt die Entwicklung des Arbeiter-Turnerbundes und seine Fußball-Abteilungen dar. Es beleuchtet die Erfolge der Arbeitersportbewegung und die Herausforderungen durch politische und soziale Konflikte.
Das Kapitel über den katholischen Fußball in der Weimarer Republik beschreibt die Gründung des Reichsverbands für katholische Sportvereine und die Bedeutung des Fußballs für die katholische Jugendbewegung.
Das Kapitel über Hooligans in der Weimarer Republik analysiert die Ursachen für Gewaltausbrüche in den Stadien und die Entwicklung von Lokalrivalitäten.
Das Kapitel über Sportberichte in der Weimarer Republik und im „Dritten Reich" beschreibt die Entstehung der Livereportage im Rundfunk und die Rolle des Mediums für die NS-Propaganda.
Das Kapitel über jüdische Sportvereine im „Dritten Reich" schildert die Situation jüdischer Sportlerinnen und Sportler nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten und die Verfolgung durch das Regime.
Das Kapitel über den Hamburger SV im „Dritten Reich" zeigt die bedingungslose Unterordnung des Vereins unter das NS-Regime und die Ausschluss von jüdischen Sportlern.
Das Kapitel über die Nationalmannschaft im „Dritten Reich" beschreibt die Rolle des Fußballs in der NS-Propaganda und die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 1934.
Das Kapitel über Hooligans im „Dritten Reich" analysiert die Versuche des NS-Regimes, die Zuschauergewalt zu kontrollieren und die Masse zu politisch zu beeinflussen.
Das Kapitel über Länderspiele während des Krieges beleuchtet die Rolle des Fußballs in der Kriegs- und Propagandapolitik des NS-Regimes.
Das Kapitel über Kontinuitäten in der Nachkriegszeit beschreibt die Kontinuitäten in der DFB-Führung und der Fußballfachpresse und die gesellschaftliche und politische Neuausrichtung des Fußballs nach dem Krieg.
Das Kapitel über das „Wunder von Bern" erzählt die Geschichte des WM-Sieges 1954 und die Bedeutung des Ereignisses für die deutsche Gesellschaft.
Das Kapitel über den Eklat des DFB-Vorsitzenden schildert den Skandal um die nationalistische Rede von Peco Bauwens nach dem WM-Sieg.
Das Kapitel über den Fußball als Migrantensport in beiden Deutschlands beleuchtet die Einwanderung von „Gastarbeitern" bzw. „Kontraktarbeitern" und die Rolle des Fußballs bei der sozialen Integration und Segregation.
Das Kapitel über die Zuschauerzahlen der DDR Oberliga und der Bundesliga stellt die Entwicklung der Zuschauerzahlen in den höchsten Spielklassen beider deutscher Staaten dar.
Das Kapitel über das Aufeinandertreffen der beiden Deutschlands bei der Weltmeisterschaft 1974 beschreibt das Spiel zwischen der Bundesrepublik und der DDR und die ideologische Nutzung des Sports in der DDR.
Das Kapitel über den Julius-Hirsch-Preis erläutert die Bedeutung des Preises als Zeichen für Toleranz und Anerkennung der Diversität und stellt die bisherigen Preisträger vor.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Fußballsport in Deutschland, seine Entwicklung in verschiedenen politischen und gesellschaftlichen Systemen, die Rolle von Migration und Integration, die Bedeutung des DFBs, die Auswirkungen von Krieg und Propaganda auf den Fußball, die soziale Segregation und Integration von Migranten im Fußball, Hooligans, die NS-Zeit, die DDR, das „Wunder von Bern" und den Julius-Hirsch-Preis.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielte Migration bei der Entstehung des deutschen Fußballs?
Fußball war in Deutschland anfangs primär ein Sport von Migranten, insbesondere von englischen Kaufleuten und Akademikern, die das Spiel vom „Mutterland“ England nach Deutschland brachten.
Wie wurde Fußball im Nationalsozialismus instrumentalisiert?
Das NS-Regime nutzte den Fußball für propagandistische Zwecke, schloss jüdische Mitglieder aus Vereinen wie dem HSV aus und versuchte, den Sport zu „germanisieren“ und zur körperlichen Abhärtung einzusetzen.
Was war das Besondere am Arbeiterfußball in der Weimarer Republik?
Der Arbeiter-Turnerbund entwickelte eigene Fußball-Abteilungen als Gegenbewegung zum bürgerlichen Sport, was die soziale Trennung und gleichzeitig die Identitätsbildung innerhalb der Arbeiterklasse förderte.
Welche Bedeutung hatte das „Wunder von Bern“ für die deutsche Gesellschaft?
Der WM-Sieg 1954 gilt als zentrales Ereignis der Nachkriegszeit, das das deutsche Selbstbewusstsein stärkte, jedoch auch von nationalistischen Tönen in der DFB-Führung begleitet wurde.
Was ist der Julius-Hirsch-Preis?
Der DFB verleiht diesen Preis zur Anerkennung von Diversität und Toleranz im Fußball, benannt nach dem jüdischen Nationalspieler Julius Hirsch, der von den Nationalsozialisten ermordet wurde.
- Quote paper
- Christoph Deichert (Author), 2013, Sozialgeschichte des modernen deutschen Fußballs, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/231814