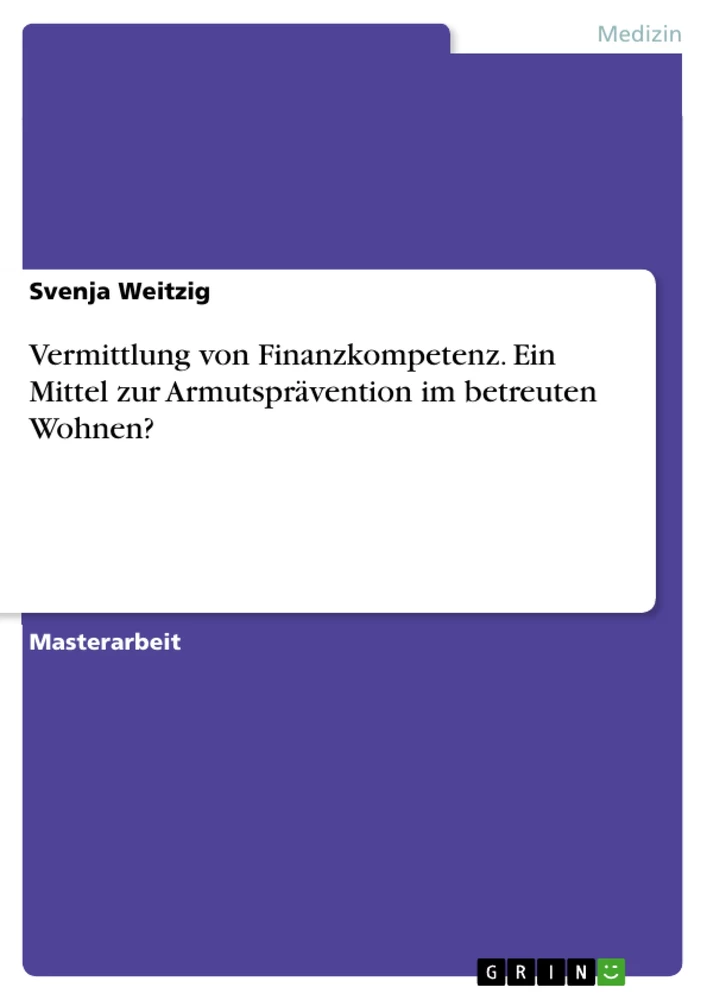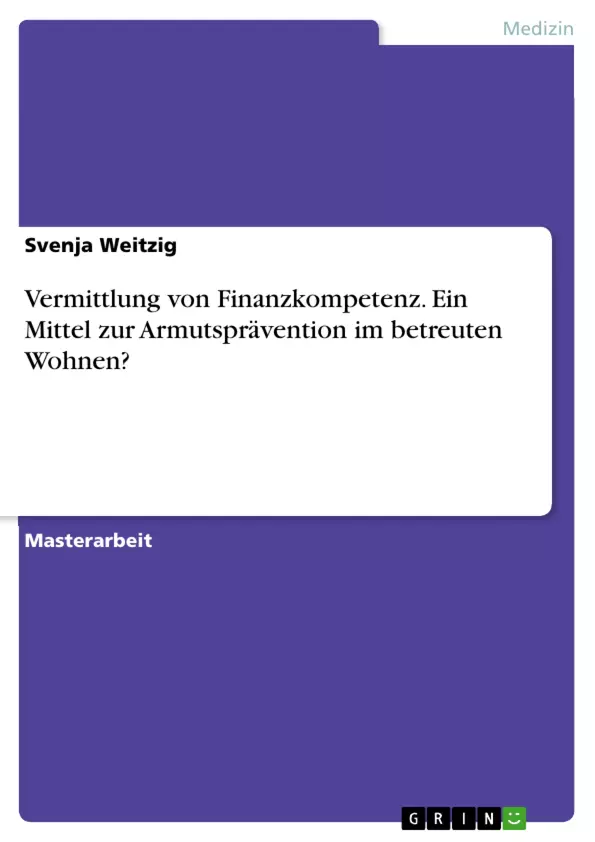Meine These für diese Arbeit besagt, dass erfolgreiche Vermittlung von Finanzkompetenz zu einer Erhöhung der Lebensqualität dieser Menschen führt und wesentlich zur Armutsprävention beiträgt.
Ziel dieser Arbeit ist es, die Notwendigkeit und die Möglichkeiten des Einsatzes entsprechender Konzepte darzustellen, um die Thematik in die aktuelle Diskussion und weitere Entwicklung des betreuten Wohnens einzubringen. Mittelfristiges Ziel ist es, das Konzept zu erproben und die Ergebnisse empirisch zu belegen, um es langfristig als festen Standard in die Arbeit im betreuten Wohnen zu integrieren. Aufgrund der Kürze von Zeit und Umfang der Masterarbeit müssen diese Ziele in einem weitergehenden Rahmen verfolgt und bearbeitet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Herausforderungen im eigenen Haushalt
- Problemstellungen
- Reaktionen und Lösungsstrategien der Klientel
- Zu erwartende Herausforderungen
- Hintergründe und aktuelle Entwicklungen
- Die soziale Situation
- Seelische Behinderungen
- Die Korrelation von Armut, Gesundheit und Arbeitslosigkeit
- Ambulantisierung - Selbstbestimmt in den eigenen Haushalt
- Kompetenz im privaten Haushalt
- Verbraucherkompetenz - Defizite und steigende Anforderungen
- Finanzkompetenz und ihre Bedeutung für den privaten Haushalt
- Vermittlung von Finanzkompetenz
- Präventions- und Interventionsmöglichkeiten
- Haltgebende Pädagogik
- Lösungsorientierte Beratung
- Basiskompetenz Finanzen
- Geld und Finanzdienstleistungen
- Wohnen
- Ernährung und Gesundheit
- Handy, Festnetz und Internet
- Nachhaltige Lebensplanung
- Konzepte und deren Umsetzung
- Seminar zur Vorbereitung auf das betreute Wohnen
- Starterpaket Finanzen - Ein Leitfaden
- Schulungen zur Vermittlung von Finanzkompetenz
- Thesen für die weitere Forschung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die Notwendigkeit und Möglichkeiten der Vermittlung von Finanzkompetenz zur Armutsprävention im betreuten Wohnen für Menschen mit Behinderung. Das Ziel ist die Darstellung geeigneter Konzepte und deren Einbringung in die aktuelle Diskussion und Weiterentwicklung des betreuten Wohnens. Die Arbeit beleuchtet die Herausforderungen im Umgang mit Finanzen dieser Zielgruppe und analysiert mögliche Lösungsansätze.
- Herausforderungen im Umgang mit Finanzen bei Menschen mit Behinderung im betreuten Wohnen
- Soziale Situation und deren Einfluss auf die Finanzkompetenz
- Präventions- und Interventionsmöglichkeiten zur Verbesserung der Finanzkompetenz
- Konzepte zur Vermittlung von Finanzkompetenz und deren Umsetzung
- Beitrag der Finanzkompetenz zur Erhöhung der Lebensqualität und Armutsprävention
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung präsentiert anhand des Fallbeispiels Mandy Müller die Problematik mangelnder Finanzkompetenz bei Menschen mit Behinderung im betreuten Wohnen und begründet die Relevanz der Thematik für die vorliegende Masterarbeit. Sie definiert die Zielgruppe und die These der Arbeit, wonach erfolgreiche Finanzkompetenzvermittlung die Lebensqualität erhöht und Armut präventiv wirkt. Das Ziel der Arbeit ist die Darstellung notwendiger Konzepte und deren Integration in das betreute Wohnen.
Herausforderungen im eigenen Haushalt: Dieses Kapitel beschreibt die Schwierigkeiten, mit denen Menschen mit Behinderung im betreuten Wohnen im Umgang mit ihrem Haushalt konfrontiert sind. Es beleuchtet die Problemstellungen, Reaktionen und Lösungsstrategien der Betroffenen sowie die zu erwartenden Herausforderungen im Alltag. Die beschriebenen Fallbeispiele verdeutlichen die Komplexität der Situation und die Notwendigkeit gezielter Interventionen.
Hintergründe und aktuelle Entwicklungen: Dieses Kapitel analysiert die soziale Situation der Zielgruppe, insbesondere die steigende Zahl von Menschen mit seelischen Behinderungen und die Korrelation von Armut, Gesundheit und Arbeitslosigkeit. Es untersucht den Trend zur Ambulantisierung und die damit verbundenen Herausforderungen an die Selbstständigkeit. Der Fokus liegt auf den Defiziten in der Verbraucherkompetenz und der Bedeutung von Finanzkompetenz für den privaten Haushalt.
Präventions- und Interventionsmöglichkeiten: Das Kapitel widmet sich den Möglichkeiten der Prävention und Intervention zur Verbesserung der Finanzkompetenz. Es stellt Konzepte wie haltgebende Pädagogik, lösungsorientierte Beratung und nachhaltige Lebensplanung vor und präsentiert das „Starterpaket Basiskompetenz Finanzen“ als ein konkretes Beispiel für ein unterstützendes Angebot. Die vielschichtigen Kompetenzstufen der Klientel machen weitere, differenzierte Konzepte notwendig, die hier aber nur angedeutet werden.
Konzepte und deren Umsetzung: Dieses Kapitel beschreibt verschiedene Konzepte zur Vermittlung von Finanzkompetenz, darunter Seminare zur Vorbereitung auf das betreute Wohnen, ein „Starterpaket Finanzen“ als Leitfaden und Schulungen zur praktischen Anwendung von Finanzwissen. Es skizziert die praktische Umsetzung dieser Konzepte und betont den Bedarf an differenzierten Ansätzen.
Schlüsselwörter
Finanzkompetenz, Armutsprävention, Betreutes Wohnen, Menschen mit Behinderung, Soziale Inklusion, Verbraucherbildung, Präventionsmaßnahmen, Interventionsstrategien, Nachhaltige Lebensplanung, Lösungsorientierte Beratung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Masterarbeit: Finanzkompetenz und Armutsprävention im betreuten Wohnen
Was ist der Gegenstand der Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht die Notwendigkeit und Möglichkeiten der Vermittlung von Finanzkompetenz zur Armutsprävention im betreuten Wohnen für Menschen mit Behinderung. Sie analysiert die Herausforderungen im Umgang mit Finanzen dieser Zielgruppe und präsentiert geeignete Konzepte zur Verbesserung der Situation.
Welche Zielgruppe wird betrachtet?
Die Arbeit konzentriert sich auf Menschen mit Behinderung, die im betreuten Wohnen leben. Dabei werden insbesondere die Schwierigkeiten im Umgang mit Finanzen und die damit verbundenen Risiken von Armut beleuchtet.
Welche Herausforderungen werden im Umgang mit Finanzen beschrieben?
Die Arbeit beschreibt vielfältige Herausforderungen, darunter Defizite in der Verbraucher- und Finanzkompetenz, die soziale Situation der Betroffenen (z.B. seelische Behinderungen, Armut, Arbeitslosigkeit), und die Komplexität des Alltags im eigenen Haushalt. Fallbeispiele veranschaulichen die konkreten Probleme.
Welche Präventions- und Interventionsmöglichkeiten werden vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert verschiedene Ansätze zur Verbesserung der Finanzkompetenz, darunter haltgebende Pädagogik, lösungsorientierte Beratung, nachhaltige Lebensplanung und konkrete Programme wie das „Starterpaket Basiskompetenz Finanzen“. Die Notwendigkeit differenzierter Konzepte wird betont.
Welche Konzepte zur Vermittlung von Finanzkompetenz werden vorgestellt?
Es werden verschiedene Konzepte vorgestellt, wie Seminare zur Vorbereitung auf das betreute Wohnen, ein „Starterpaket Finanzen“ als Leitfaden und Schulungen zur praktischen Anwendung von Finanzwissen. Die praktische Umsetzung dieser Konzepte wird skizziert.
Welchen Beitrag leistet Finanzkompetenz zur Lebensqualität und Armutsprävention?
Die Arbeit argumentiert, dass eine erfolgreiche Vermittlung von Finanzkompetenz die Lebensqualität der Betroffenen steigert und Armut präventiv wirkt. Dies wird durch die Analyse der Herausforderungen und die Präsentation geeigneter Konzepte belegt.
Wie ist die Masterarbeit strukturiert?
Die Arbeit umfasst Kapitel zur Einleitung, den Herausforderungen im eigenen Haushalt, den Hintergründen und aktuellen Entwicklungen, Präventions- und Interventionsmöglichkeiten, Konzepten und deren Umsetzung, Thesen für die weitere Forschung und ein Fazit. Ein detailliertes Inhaltsverzeichnis ist im Dokument enthalten.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Finanzkompetenz, Armutsprävention, Betreutes Wohnen, Menschen mit Behinderung, Soziale Inklusion, Verbraucherbildung, Präventionsmaßnahmen, Interventionsstrategien, Nachhaltige Lebensplanung, Lösungsorientierte Beratung.
Gibt es Fallbeispiele in der Arbeit?
Ja, die Arbeit verwendet Fallbeispiele, um die Herausforderungen und die Notwendigkeit von Interventionen zu veranschaulichen. Ein Beispiel ist der Fall von Mandy Müller in der Einleitung.
Für wen ist diese Masterarbeit relevant?
Diese Masterarbeit ist relevant für Fachkräfte im Bereich des betreuten Wohnens, Sozialarbeiter, Angehörige von Menschen mit Behinderung, und alle, die sich mit der Thematik Armutsprävention und sozialer Inklusion auseinandersetzen.
- Quote paper
- Svenja Weitzig (Author), 2009, Vermittlung von Finanzkompetenz. Ein Mittel zur Armutsprävention im betreuten Wohnen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/231938