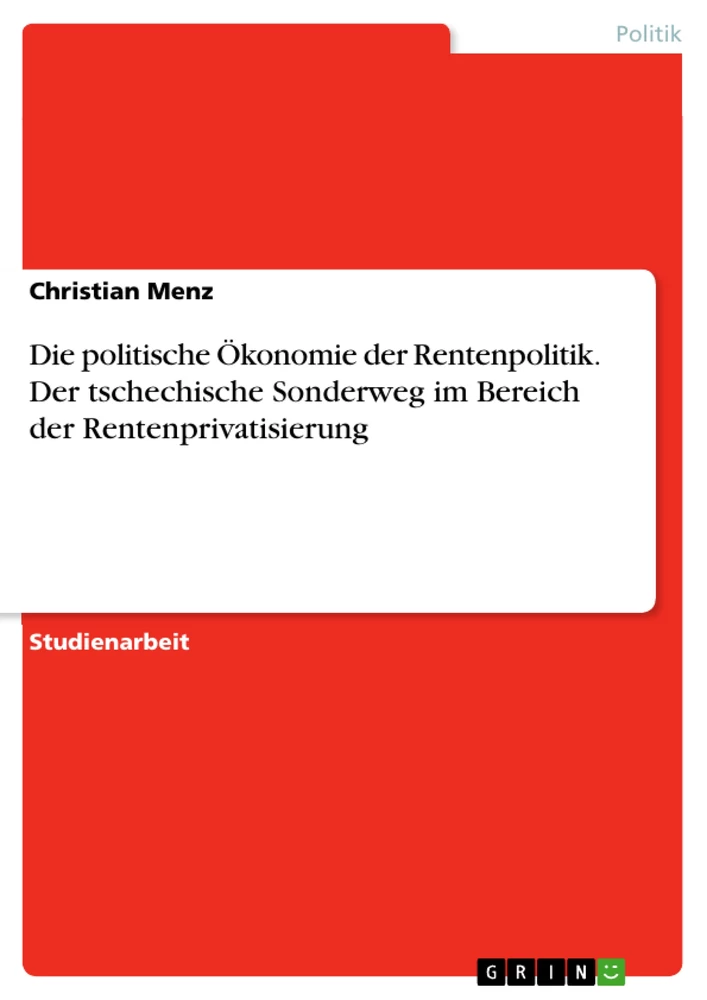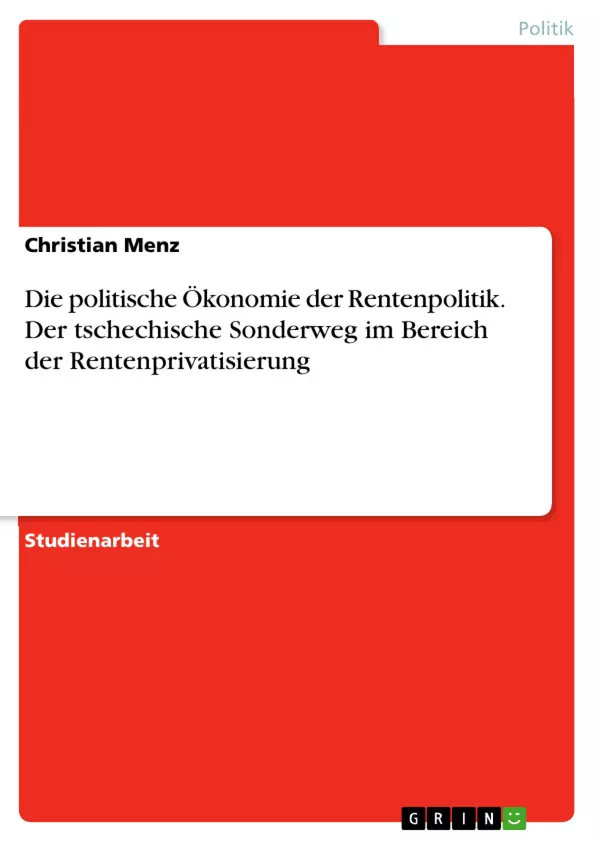Bis Mitte der 1990er Jahre wurden Rentenreformen durch die post-kommunistischen Entscheidungsträger noch „bemerkenswert zurückhaltend“ (Götting 1998: 158) angegangen. Rentenprivatisierungen hätten für sie bis dato keine Rolle gespielt (vgl. Orenstein 2008: 905). Nichtsdestotrotz sind – mit Ausnahme von Tschechien und Slowenien – mittlerweile alle 2004 und 2007 der EU beigetretenen Staaten in MOE dem ungarischen Beispiel (1998) gefolgt und haben ihre Alterssicherungssysteme auf ein sog. ‚Mehrsäulensystem‘ umgestellt, d.h. das Umlageverfahren ergänzt und teilweise ersetzt durch private Pflichtversicherungen. Aber wodurch kann erklärt werden, dass in Tschechien bis zum heutigen Tag keine verpflichtende private Rentenversicherung eingeführt wurde? Können aus einer Analyse des tschechischen Sonderwegs eventuell Rückschlüsse gezogen werden auf den empirischen Erklärungsgehalt der bisher zum Großteil in OECD-Staaten entwickelten und empirisch „getesteten“ Wohlfahrtstaatstheorien? Wenn ja, welche? Um mögliche Antworten auf diese Fragen zu finden, wird im Rahmen dieser Untersuchung der „deviant case“ der tschechischen Rentenpolitik anhand einer theoriegeleiteten Einzelfallstudie untersucht.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Methodik und Forschungsziel
3. Theorien der wohlfahrtsstaatlichen Entwicklung
3.1 Der Machtressourcenansatz
3.2 Die Parteiendifferentheorie
3.3 Politisch- institutionalistische Theorien
3.4 Einbettung in den sozioökonomischen und historischen Kontext
4. Fallstudie Tschechien
4.1 Kurzer Überblick über das tschechische Rentensystem
4.2 Phase I: sozial-liberale Reformpolitik unter Václav Klaus (1993-1996)
4.3 Phase II: Bestrebungen zur Erhaltung des Status Quo (ab 1997)
5. Fazit
6. Anhang
Tabelle 1: Typen von Rentenprivatisierung, weltweit (Stand 2008)*
Tabelle 2: Institutionelle Struktur des tschechischen Rentensystems (Stand 2004)
Tabelle 3: Das tschechische Rentenversicherungssystem im Überblick
Tabelle 4: Die Entwicklung verschiedener makroökonomischer und rentenspezifischer Indikatoren (1993-2000)
Tabelle 5: Die offizielle Arbeitslosenquote in der Tschechischen Republik (in %), 1990-2003 (jeweils zum Jahresende)
Tabelle 6: Die Position der politischen Akteure in der Tschechischen Republik in Bezug auf potentielle Rentenreformen (Stand 2001)
Tabelle 7: Rentenaussgaben in Prozent des BIP – Tschechische Republik (Stand 2007)
Tabelle 8: Verhältnis von Sozial- und Gesundheitsausgaben zum BIP, Tschechische Republik (1990-2002)
7. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Entgegen der in Forschung weit verbreiteten Annahme, dass staatliche Umlageverfahren in der Rentenversicherung „highly resistant to radical reform“ seien (Pierson 1998: 553), wurden seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion in zahlreichen osteuropäischen Staaten verpflichtende private Rentenversicherungen eingeführt und somit tiefgreifende strukturelle[1] Reformen umgesetzt. Darüber hinaus seien laut Pierson selbst bescheidene Privatisierungsprozesse in den OECD-Staaten nur politisch umsetzbar gewesen „in the relatively few countries lacking extensive and mature pay-as-you-go-systems“ (ebd.). In vielen Staaten Mittel- und Osteuropas (MOE), insbesondere in den vier Visegrád-Ländern, besteht eine lange Tradition des Bismarckschen Sozialstaatsmodells, wobei dessen Institutionen teilweise auch unter dem Kommunismus fortbestanden und nach 1990 mitsamt des Umlageverfahrens in der Rentenversicherung reanimiert wurden (Cook 2010: 672; Cerami 2006: 65-66; Cerami 2008: 14-15; Inglot 2008). Bis Mitte der 1990er Jahre wurden Rentenreformen durch die post-kommunistischen Entscheidungsträger noch „bemerkenswert zurückhaltend“ (Götting 1998: 158) angegangen. Rentenprivatisierungen hätten für sie bis dato keine Rolle gespielt (vgl. Orenstein 2008: 905). Nichtsdestotrotz sind – mit Ausnahme von Tschechien und Slowenien – mittlerweile alle 2004 und 2007 der EU beigetretenen Staaten in MOE dem ungarischen Beispiel (1998) gefolgt und haben ihre Alterssicherungssysteme auf ein sog. ‚Mehrsäulensystem‘[2] umgestellt, d.h. das Umlageverfahren ergänzt und teilweise ersetzt durch private Pflichtversicherungen.[3] Begründet wird dies vielfach mit dem stark gestiegenem Druck zur Konsolidierung der Alterssicherungssysteme und der öffentlichen Haushalte durch die Verschärfung negativer sozioökonomischer Entwicklungstrends (Cerami 2008: 12) sowie dem großen Einfluss internationaler Finanzinstitutionen (Müller 1999a: 168-172; Orenstein 2009). Der (vermeintlich) gestiegene Reformbedarf habe wiederum den politischen Handlungsspielraum der reformwilligen Regierungen erweitert, welche durch günstige institutionelle Faktoren (z.B. geringe Anzahl der Vetospieler, einflussreiches Finanzministerium) und geringem Widerstand durch Interessengruppen oder auch durch den Einsatz von „divide and pacify“-Strategien (Vanhuysse 2006a) in der Lage gewesen seien, umfassende strukturelle Reformen durchzusetzen.
Aber wodurch kann erklärt werden, dass in Tschechien bis zum heutigen Tag keine verpflichtende private Rentenversicherung eingeführt wurde? Können aus einer Analyse des tschechischen Sonderwegs eventuell Rückschlüsse gezogen werden auf den empirischen Erklärungsgehalt der bisher zum Großteil in OECD-Staaten entwickelten und empirisch „getesteten“ Wohlfahrtstaatstheorien? Wenn ja, welche? Um mögliche Antworten auf diese Fragen zu finden, wird im Rahmen dieser Untersuchung der „deviant case“ der tschechischen Rentenpolitik anhand einer theoriegeleiteten Einzelfallstudie untersucht.
Im ersten Abschnitt erfolgt die Vorstellung der Forschungsfrage und des Forschungsziels sowie der daraus abgeleiteten Methodik. Im darauffolgenden Kapitel werden die gängigen Staatstätigkeitstheorien kurz vorgestellt und diskutiert. Diese bilden wiederum den theoretischen Rahmen für die empirische Untersuchung der Einzelfallstudie im dritten Kapitel. Abschließend erfolgt ein Fazit, in dem die wesentlichen Ergebnisse der Analyse vorgestellt und vor dem Hintergrund der wohlfahrtsstaatlichen Forschungsliteratur kurz diskutiert werden.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der „tschechische Sonderweg“ in der Rentenpolitik?
Während viele osteuropäische Staaten ihre Rentensysteme privatisierten, hielt Tschechien lange Zeit an einem staatlichen Umlageverfahren ohne verpflichtende private Säule fest.
Warum haben andere MOE-Staaten ihre Renten privatisiert?
Gründe waren oft hoher Konsolidierungsdruck, sozioökonomische Trends und der Einfluss internationaler Finanzinstitutionen wie der Weltbank.
Welche Theorien erklären die Entwicklung des Wohlfahrtsstaates?
Die Arbeit nutzt den Machtressourcenansatz, die Parteiendifferenztheorie sowie politisch-institutionalistische Theorien zur Analyse.
Welche Rolle spielte Václav Klaus in der tschechischen Rentenpolitik?
Unter Klaus wurde eine sozial-liberale Reformpolitik verfolgt (1993-1996), die trotz marktwirtschaftlicher Rhetorik den sozialen Frieden durch den Erhalt staatlicher Kernstrukturen wahrte.
Sind staatliche Rentensysteme resistent gegen Reformen?
Die Forschung (z.B. nach Pierson) nimmt oft an, dass etablierte Umlagesysteme schwer zu reformieren sind. Tschechien dient hierbei als interessanter „Deviant Case“.
- Citar trabajo
- Christian Menz (Autor), 2011, Die politische Ökonomie der Rentenpolitik. Der tschechische Sonderweg im Bereich der Rentenprivatisierung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/232036