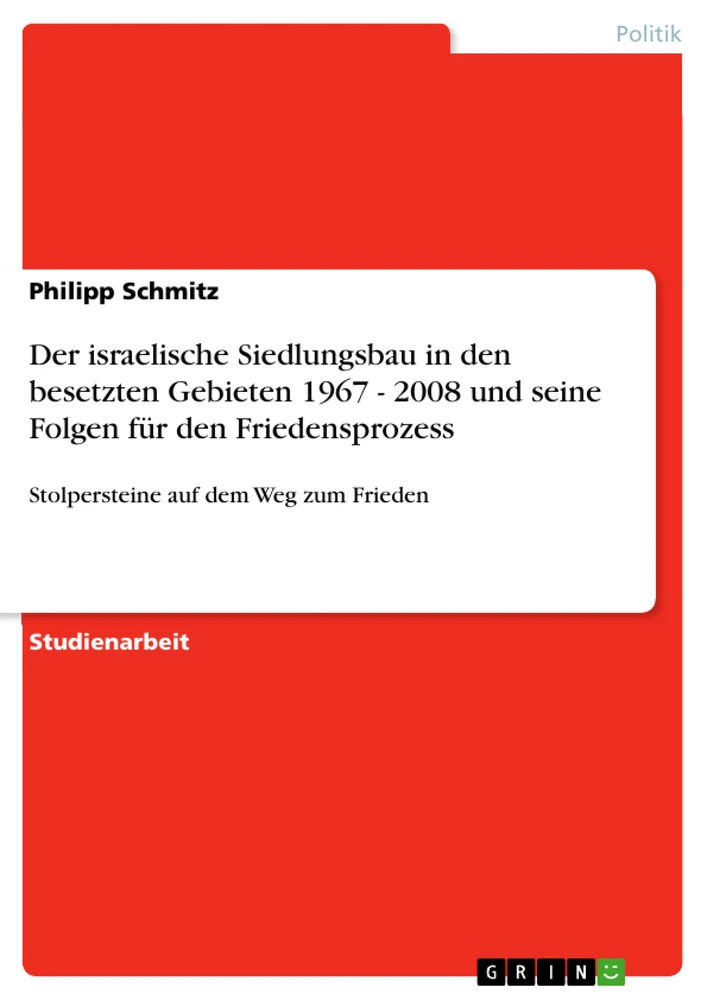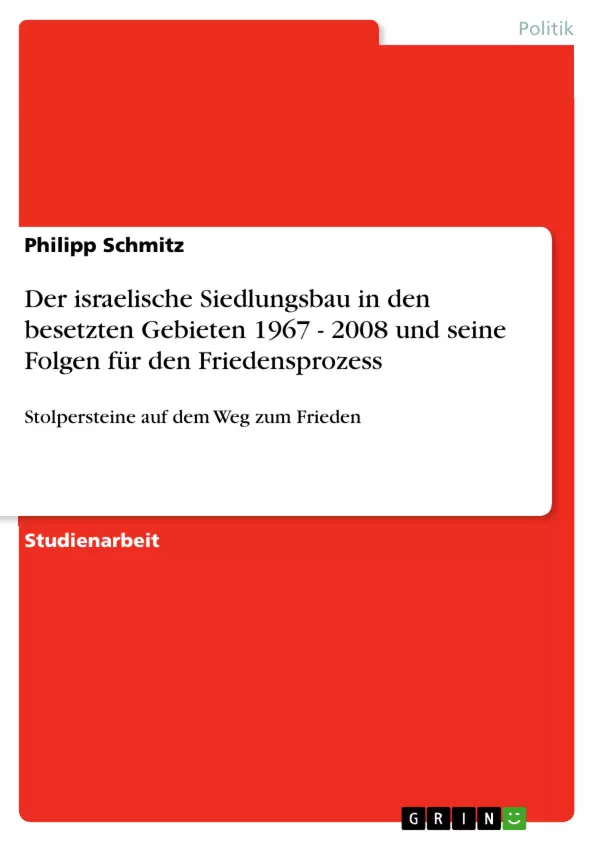Der Nahostkonflikt ist einer der ältesten und vielschichtigsten Konflikte weltweit und lässt sich in seiner ganzen Breite selbst in einem weit größeren Rahmen kaum zufriedenstellend untersuchen. Deshalb ist es unbedingt erforderlich, sich in dieser Arbeit auf ein einzelnes Problemfeld zu beschränken, um es umfassend analysieren zu können. Vor allem in Hinblick auf einen möglichen israelisch-palästinensischen Frieden bieten sich hier zahlreiche Themenkomplexe an, etwa die Flüchtlingsfrage oder der Status von Jerusalem. Eine entscheidende Rolle bei der Suche nach einer dauerhaften Friedenslösung wird jedoch die israelische Siedlungspolitik in den besetzten Gebieten mit all ihren Folgen spielen, denn „settlers and settlements in the occupied territories formed, and continue to form, one of the most important – if not the most important block on the road to Israeli-Palestinian coexistence on the macro-level.“ (Demandt 1996:99). Die Fragen die sich hieraus ergeben, liegen auf der Hand: Wie konnte sich der israelische Siedlungsbau in den 1967 besetzten Gebieten zu einem der größten Hemmnisse im aktuellen Friedensprozess entwickeln? Wie lässt sich das Dilemma der Siedlungen lösen? Diese Fragen gilt es in der vorliegenden Arbeit zu klären.
Zunächst soll jedoch kurz ein Ansatz für die Behandlung des Themas im Unterricht dargestellt werden, wobei der Schwerpunkt dieser Arbeit insgesamt eindeutig auf dem wissenschaftlichen Aspekt liegt und der didaktische Ansatz daher nur sehr knapp beschrieben wird. Anschließend folgt als Einstieg eine Untersuchung der israelischen Siedlungspolitik bis 2005, wobei hier der Schwerpunkt klar auf der Untersuchung der Frage, wie die Anfänge derselben aussahen, liegt. Im nächsten Kapitel soll speziell der israelische Rückzug aus dem Gaza-Streifen 2005 untersucht werden unter besonderer Berücksichtigung der Frage nach der Modellhaftigkeit der Evakuierung für zukünftige Räumungen. Das Thema der Extremisten unter den jüdischen Siedlern verdient eine gesonderte Behandlung, da es exemplarisch die Brisanz und – im wahrsten Sinne des Wortes – die Sprengkraft verdeutlicht, die diese Gruppierungen für die israelische Gesellschaft und den Friedensprozess allgemein haben. Im folgenden Abschnitt wird der aktuelle Stand der Siedlungspolitik seit 2005 reflektiert, bevor abschließend Lösungsmöglichkeiten und Perspektiven entwickelt und dargelegt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die israelische Siedlungspolitik im Unterricht – Didaktische Ansätze
- Der israelische Siedlungsbau von 1967 bis 2005
- Der Rückzug aus dem Gaza-Streifen – Modell für das Westjordanland?
- Extremisten unter Extremisten – Gush Emunim, Hügeljugend und Jüdischer Untergrund
- Gegenwart und Zukunft des israelischen Siedlungsbaus
- Die israelische Siedlungspolitik seit 2005
- Ausblick - Perspektiven und Lösungsmöglichkeiten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem israelischen Siedlungsbau in den besetzten Gebieten seit 1967 und untersucht seine Folgen für den Friedensprozess im Nahen Osten. Das Hauptziel ist es, die Entwicklung des Siedlungsbaues zu analysieren und seine Bedeutung für das Scheitern einer dauerhaften Friedenslösung aufzuzeigen.
- Die Anfänge des israelischen Siedlungsbaues nach dem Sechs-Tage-Krieg von 1967
- Die Rolle von politischen und religiös-ideologischen Motivationen für die Siedlungspolitik
- Der Rückzug aus dem Gaza-Streifen als mögliches Modell für das Westjordanland
- Die Rolle von extremistischen Siedlergruppen im israelischen Kontext
- Die aktuelle Situation der Siedlungspolitik und mögliche Perspektiven für eine Friedenslösung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung befasst sich mit dem Nahostkonflikt und seiner Komplexität, bevor sie die Bedeutung der israelischen Siedlungspolitik für den Friedensprozess hervorhebt. Kapitel 2 stellt didaktische Ansätze für die Behandlung des Themas im Geschichtsunterricht vor. Kapitel 3 analysiert die Entwicklung des Siedlungsbaues bis 2005, wobei die Frage nach den Anfängen und den politischen und ideologischen Motivationen im Vordergrund steht. Kapitel 4 untersucht den Rückzug aus dem Gaza-Streifen 2005 und seine mögliche Vorbildfunktion für weitere Evakuierungen. Kapitel 5 thematisiert die Rolle von extremistischen Siedlergruppen für die israelische Gesellschaft und den Friedensprozess. Das Kapitel 6 reflektiert die aktuelle Situation der Siedlungspolitik seit 2005 und diskutiert mögliche Perspektiven und Lösungsansätze für die Zukunft.
Schlüsselwörter
Der israelische Siedlungsbau, Nahostkonflikt, Friedensprozess, Besetzte Gebiete, Gush Emunim, Hügeljugend, Jüdischer Untergrund, Extremisten, Strategische und Sicherheitserwägungen, Religiöse Motivationen, Politische Motivationen, Rückzug aus dem Gaza-Streifen, Modellhaftigkeit, Lösungsmöglichkeiten, Perspektiven.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist der Siedlungsbau ein Hindernis für den Frieden?
Siedlungen in den besetzten Gebieten erschweren die territoriale Integrität eines zukünftigen palästinensischen Staates und führen zu Spannungen zwischen den Volksgruppen.
Was war die Bedeutung des Rückzugs aus dem Gaza-Streifen 2005?
Es war ein Versuch, das Siedlungsproblem durch Räumung zu lösen, wobei die Arbeit untersucht, ob dies als Modell für das Westjordanland dienen kann.
Wer sind die extremistischen Siedlergruppen?
Gruppen wie Gush Emunim oder die „Hügeljugend“ vertreten religiös-ideologische Positionen, die oft im Widerspruch zu staatlichen Friedensbemühungen stehen.
Welche Motivationen stecken hinter dem Siedlungsbau?
Die Motive sind vielfältig und reichen von strategischen Sicherheitserwägungen bis hin zu religiösen und ideologischen Überzeugungen.
Gibt es Lösungsmöglichkeiten für das Siedlungsdilemma?
Die Arbeit diskutiert verschiedene Perspektiven und Ansätze, wie eine dauerhafte Koexistenz trotz der bestehenden Siedlungsstrukturen erreicht werden könnte.
- Arbeit zitieren
- Philipp Schmitz (Autor:in), 2008, Der israelische Siedlungsbau in den besetzten Gebieten 1967 - 2008 und seine Folgen für den Friedensprozess, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/232115