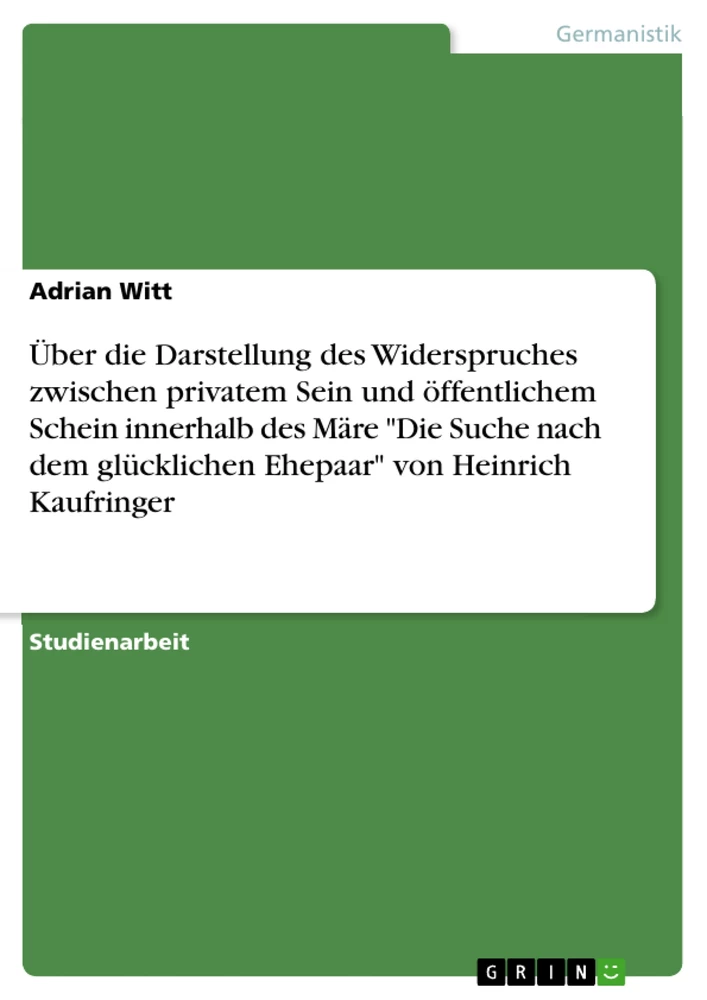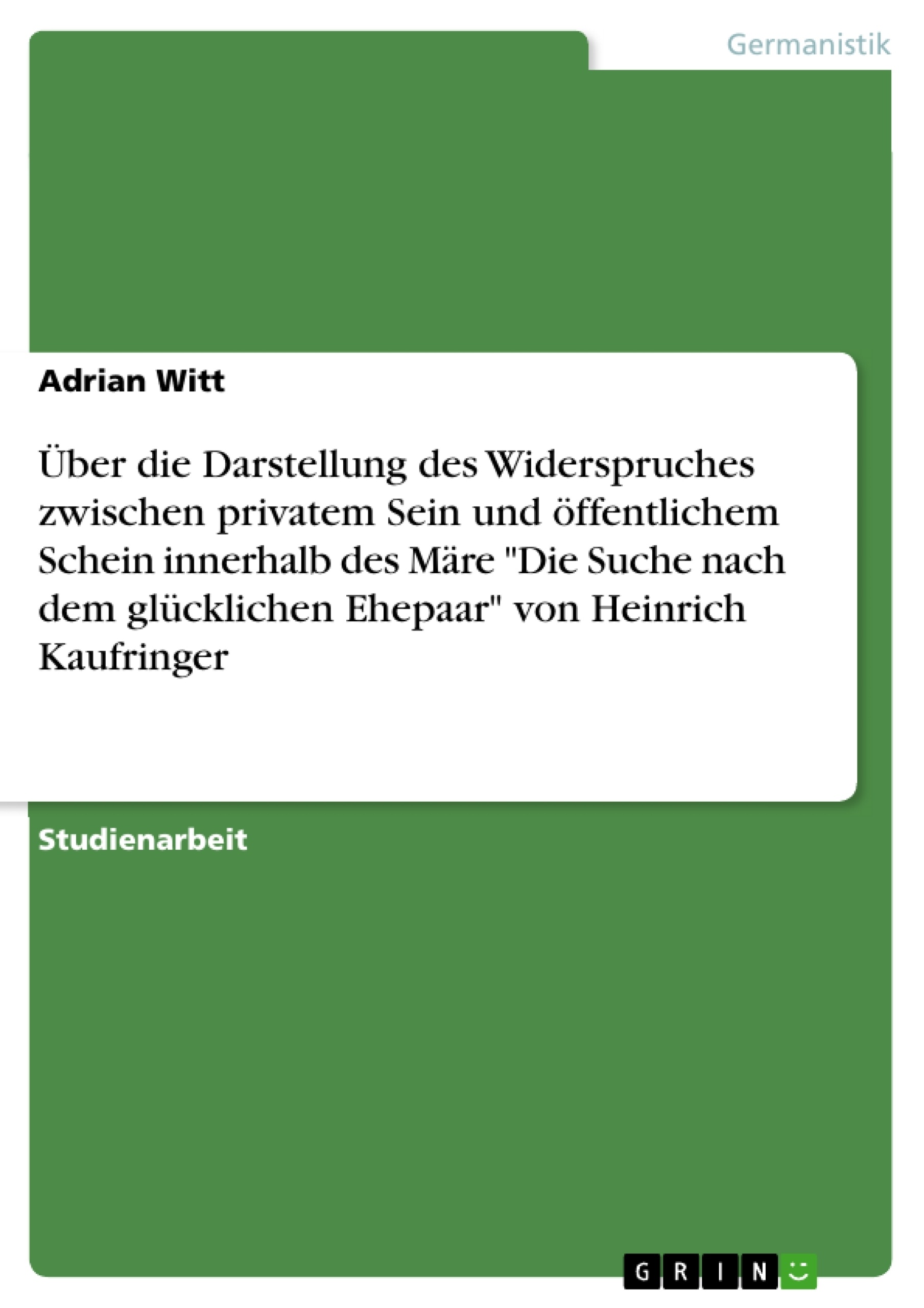Die Thematisierung der Liebe und des Ehebruches darf nicht gänzlich als neuzeitliches Phänomen verstanden werden. Vielmehr haben diese Motive auf Grund ihrer Darstellungsmöglichkeiten im Laufe der Geschichte Einfluss auf diverse Künste genommen oder fanden durch ihren Charakter immer wieder als Themenstoff eine schriftbezogene Verwendung. Insbesondere für die mittelalterlichen Gesellschaften war der Gebrauch der Liebes- und der Ehethematik von fundamentaler Bedeutung, sodass diese zu zentralen Gegenständen der Literatur avancierten. Dabei lässt sich in der Fülle der unterschiedlichen Textsorten der mittelalterlichen Literatur, in denen das Zusammenleben von Mann und Frau behandelt werden, eine durch die Autoren jener Zeit entworfene Eheauffassung erkennen, die sich nicht nur als Institution versteht, sondern zunehmend auch als einzig legitime Lebensform für die Liebesgemeinschaft zwischen beiden Geschlechtern. Doch während die Ehe als ideale Fortsetzung eines Liebesverhältnisses oder als deren einzig tolerierbarer Ort in der Literatur des Mittelalters in Erscheinung tritt, geschieht dies in einer Gesellschaft die durch patriarchalische Strukturen geprägt ist und in der sich die Ehe auf dem Weg in die Neuzeit nur allmählich über die Liebe der Partner zueinander zu definieren beginnt. Neben den großen höfischen Romanen von einzelnen Autoren wie Chrétien de Troyes oder Hartmann von Aue und des Minnesangs bildete sich schon im frühen 13. Jahrhundert eine neue Textgattung, die als relativ kurze novellenartige Verserzählung inhaltlich ein breites Themenspektrum behandelt. Doch trotz der Vielfalt der Themen, auf die diese Kurzerzählungen eingehen, zeigt sich bei näherer Betrachtung ein dominierendes Interesse hinsichtlich des Verhältnisses von Eheleuten zueinander ab, wodurch „das provozierend-revolutionäre Potential des mittelalterlichen Liebesdiskurses“ eine vollkommen neuartige Dimension erfährt. Denn während im höfischen Roman die Minne der Liebenden sich noch einer sittlichen Gesellschaftsordnung unterwirft, wird diese in der Märendichtung durch eine erotisch-sexuelle Darstellung radikalisiert, sodass ein „Einblick in die universelle Macht des Triebes [gewährt] und damit auch das Eingeständnis der menschlichen Schwäche“ thematisiert wird. Exemplarisch hierfür ist das Märe von der Suche nach dem glücklichen Ehepaar von Heinrich Kaufringer zu nennen, in der die christliche Vorstellung einer rechten Ehe der defizitären Wirklichkeit gegenübergestellt wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zur Person des Heinrich Kaufringer
- Klärungsversuch des Terminus Märe
- Die Sonderstellung des Märe Die Suche nach dem glücklichen Ehepaar innerhalb der Sammlung der Münchner Handschrift cgm 270
- Das innereheliche Konfliktpotential zwischen Mann und Frau
- Heinrich Kaufringers Märe Die Suche nach dem glücklichen Ehepaar
- Promythion
- Rahmenhandlung
- Erste Binnenerzählung
- Zweite Binnenerzählung
- Epimythion
- Die Konstruktion der Geschlechter innerhalb des Märe durch Kaufringer
- Schluss
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Märe "Die Suche nach dem glücklichen Ehepaar" von Heinrich Kaufringer, welches in der Münchner Handschrift cgm 270 aus dem Jahr 1464 überliefert ist. Ziel ist es, das Konfliktpotential der Ehebruchthematik innerhalb des Märe zu untersuchen und herauszufinden, wie der Widerspruch zwischen privatem Sein und öffentlichem Schein in Erscheinung tritt. Dabei werden die Person des Heinrich Kaufringer, der Begriff des Märe und die besondere Stellung des Märe innerhalb der Sammlung der Münchner Handschrift cgm 270 beleuchtet.
- Das innereheliche Konfliktpotential zwischen Mann und Frau im Mittelalter
- Die Darstellung des Ehebruchs in der Märendichtung
- Der Widerspruch zwischen privatem Sein und öffentlichem Schein
- Die Konstruktion von Geschlechterbildern in der Märendichtung
- Die Bedeutung des Märe "Die Suche nach dem glücklichen Ehepaar" innerhalb der Sammlung der Münchner Handschrift cgm 270
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die gesellschaftliche Relevanz der Liebes- und Ehebruchthematik im Mittelalter dar und führt in das Märe "Die Suche nach dem glücklichen Ehepaar" von Heinrich Kaufringer ein. Kapitel 2 befasst sich mit der Person des Heinrich Kaufringer und seiner Bedeutung als Märenautor. Kapitel 3 klärt den Begriff des Märe und seine Abgrenzung von anderen literarischen Gattungen. Kapitel 4 untersucht die Sonderstellung des Märe "Die Suche nach dem glücklichen Ehepaar" innerhalb der Sammlung der Münchner Handschrift cgm 270 und beleuchtet die Einrahmung der Mären durch geistliche Texte. Kapitel 5 analysiert das innereheliche Konfliktpotential zwischen Mann und Frau im Mittelalter und stellt die geschlechterspezifischen Zuschreibungen von Wesensmerkmalen dar.
Das sechste Kapitel widmet sich dem Märe "Die Suche nach dem glücklichen Ehepaar" von Heinrich Kaufringer. Im Unterkapitel 6.1 wird das Promythion analysiert, welches das Ideal einer rechten Ehe darstellt und dieses der defizitären Wirklichkeit gegenüberstellt. Kapitel 6.2 behandelt die Rahmenhandlung des Märe, die die Charakterisierung des Ehepaars und die Darstellung ihres gemeinsamen Ehelebens umfasst. Die erste Binnenerzählung (Kapitel 6.3) erzählt die Geschichte eines Ehepaars, das in der Öffentlichkeit als harmonisch wahrgenommen wird, jedoch ein dunkles Geheimnis verbirgt. Die zweite Binnenerzählung (Kapitel 6.4) schildert ein weiteres Ehepaar, bei dem der Mann seine Frau vor dem Ehebruch schützen möchte, indem er heimlich einen Bauer in sein Haus bringt. Das Epimythion (Kapitel 6.5) fasst die Erkenntnisse des Reisenden zusammen und stellt die Frage nach der Bedeutung der sexuellen Verfehlung in der Ehe.
Kapitel 7 untersucht die Konstruktion der Geschlechter innerhalb des Märe durch Kaufringer und stellt die Ambivalenz des Frauenbildes dar. Das Schluss-Kapitel fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und stellt die Bedeutung des Märe "Die Suche nach dem glücklichen Ehepaar" für die mittelalterliche Literatur dar. Das Kapitel stellt zudem einen Vergleich zwischen den innerenhelichen Problemen des Märe und aktuellen Herausforderungen der Gegenwart her.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das Märe, Heinrich Kaufringer, Ehebruch, innereheliche Konflikte, Geschlechterbilder, mittelalterliche Literatur, Münchner Handschrift cgm 270, öffentliches Schein und privates Sein, christliche Ehevorstellung und die gesellschaftliche Relevanz der Liebes- und Ehebruchthematik im Mittelalter.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Märe „Die Suche nach dem glücklichen Ehepaar“?
Das Märe von Heinrich Kaufringer thematisiert die Suche nach einer idealen, glücklichen Ehe und kontrastiert diese mit der defizitären Wirklichkeit von Ehebruch und innerfamiliären Konflikten.
Was bedeutet der Widerspruch zwischen „privatem Sein“ und „öffentlichem Schein“?
Es beschreibt die Diskrepanz zwischen der nach außen hin harmonisch wirkenden Ehefassade und den tatsächlichen, oft moralisch fragwürdigen Zuständen im privaten Leben der Eheleute.
Wer war Heinrich Kaufringer?
Heinrich Kaufringer war ein bedeutender Autor von Verserzählungen (Mären) im Spätmittelalter, dessen Werke vor allem in der Münchner Handschrift cgm 270 überliefert sind.
Wie wird das Frauenbild in Kaufringers Mären dargestellt?
Die Arbeit untersucht die Ambivalenz des Frauenbildes und die Konstruktion von Geschlechterrollen in einer patriarchalisch geprägten mittelalterlichen Gesellschaft.
Welche Rolle spielt die Erotik in der Märendichtung?
Im Gegensatz zum höfischen Roman radikalisiert die Märendichtung die Darstellung durch erotisch-sexuelle Motive, um die universelle Macht des Triebes und menschliche Schwächen aufzuzeigen.
- Quote paper
- B.A. Adrian Witt (Author), 2013, Über die Darstellung des Widerspruches zwischen privatem Sein und öffentlichem Schein innerhalb des Märe "Die Suche nach dem glücklichen Ehepaar" von Heinrich Kaufringer, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/232598