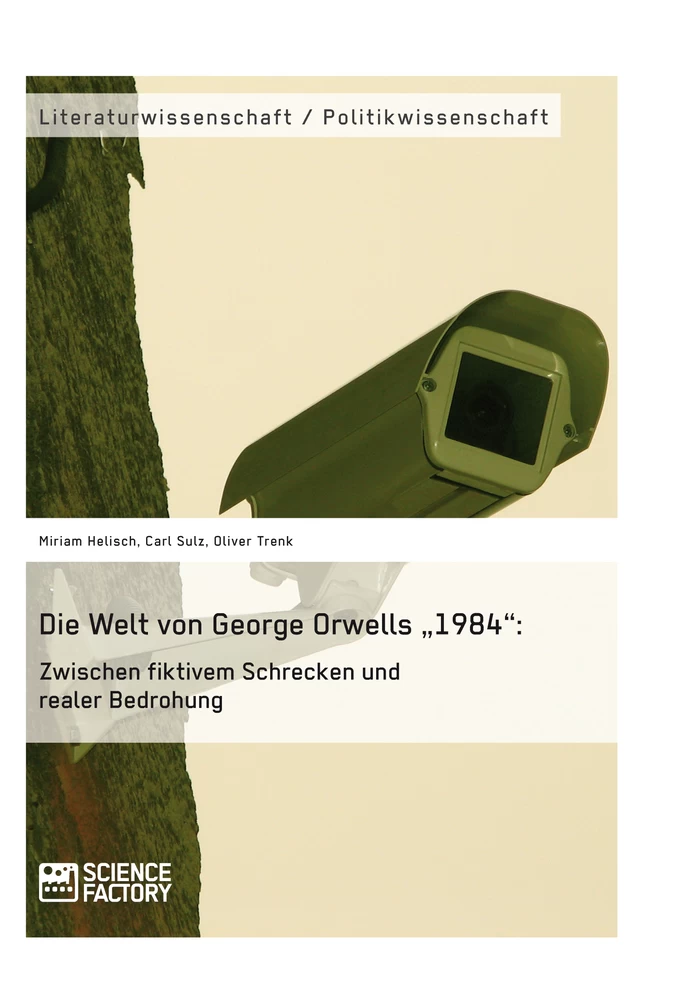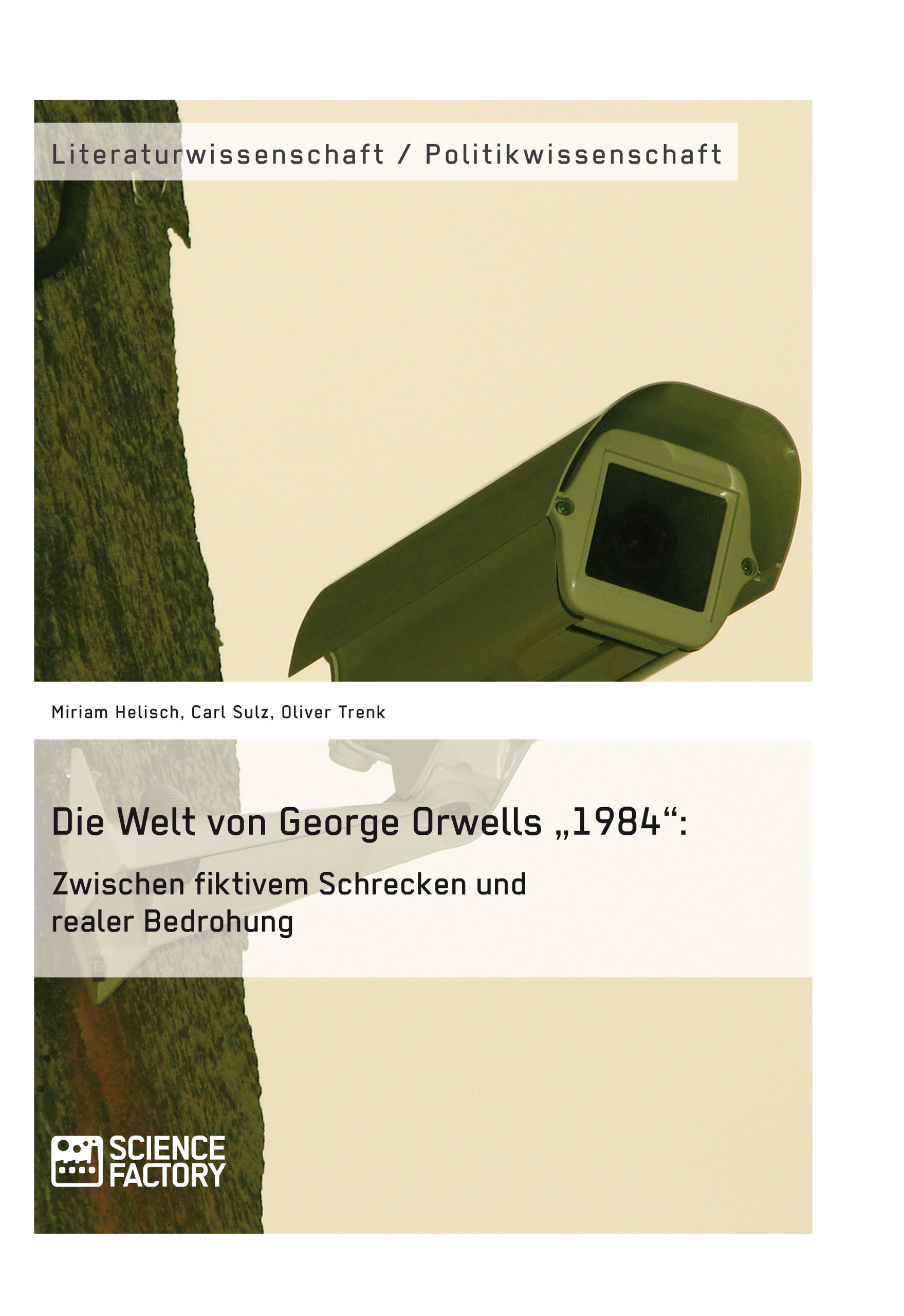Ein totalitärer Staatsapparat, der perfide Methoden zur Unterdrückung und Manipulation seiner Bürger einsetzt – bis heute ist George Orwells berühmter Gesellschaftsentwurf „1984“ der Inbegriff von Terrorherrschaft und Totalüberwachung. Aber wie weit hat sich unsere Realität dieser fiktiven Schreckensvision mittlerweile angenähert?
Die Beiträge in diesem Band erläutern die Hintergründe zu George Orwells gewaltiger Anti-Utopie, setzen sich mit ihren Machtmechanismen auseinander und interpretieren aktuelle politische Entwicklungen vor dem Hintergrund des Romans.
Aus dem Inhalt:
„1984“ als moderne Anti-Utopie; Analyse des sozio-politischen Systems im Roman
Orwell als politischer Schriftsteller; Interpretation und historischer Kontext; Die USA nach dem 11. September – auf dem Weg zur Orwellschen Gesellschaft?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Intention und Rezension des Werkes
- Aufbau und Handlung des Romans
- Der Oligarchische Kollektivismus Ozeaniens
- Der Ursprung: Scheitern des utopischen Ideals
- Das theoretisch-ökonomische Fundament
- Der Unterdrückungs- und Überwachungsstaat
- Die ozeanische Gesellschaftsordnung
- Der Grosse Bruder
- Die Partei
- Die Innere Partei
- Die Äußere Partei
- Exkurs: Geschlechterbeziehung und Familie
- Die Protes
- Manipulation des Geistes: „Doppeldenk" und „Neusprech"
- „Doppeldenk"
- „Neusprech"
- Das Internationale System: „Krieg ist Frieden"
- Macht als Selbstzweck
- Ausblick: Lösung der drei gesellschaftspolitischen Grundprobleme
- Koordination
- Kooperation
- Verteilungsgerechtigkeit
- Fazit
- Bibliographie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der 1949 publizierten Dystopie „1984" von George Orwell, welche nicht nur zu den meistgelesenen, sondern auch zu den am kontroversesten diskutierten Büchern der Weltliteratur zählt. Die Arbeit analysiert die von Orwell beschriebene totalitäre Gesellschaft und untersucht die Elemente der perfekten totalen Herrschaft, die Orwell in seinem Roman beschreibt. Ein besonderer Fokus liegt auf der Analyse der Ideologie der Partei, des fortwährenden Krieges, des neuen Menschen und der Gedankenpolizei.
- Die Ideologie der Partei
- Der fortwährende Krieg als Instrument der Unterdrückung
- Die Schaffung eines neuen Menschen durch Manipulation und Unterdrückung
- Die Gedankenpolizei als Kernstück des totalitären Systems
- Die Rolle der Sprache in der totalitären Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Das Kapitel „Intention und Rezension des Werkes" beleuchtet die Intention Orwells mit seinem Roman „1984". Der Autor war ein politischer Schriftsteller, der sich mit den bestimmenden Kräften des 20. Jahrhunderts auseinandersetzte. Seine Werke tragen autobiografische Züge und spiegeln seine persönlichen Erfahrungen mit Imperialismus, Armut und dem Spanischen Bürgerkrieg wider. Orwell war ein Verfechter früh-sozialistischer Ideale, erkannte aber, dass Faschismus und Kommunismus nur zwei unterschiedliche Erscheinungsformen des Totalitarismus waren. „1984" ist eine Gegenwartsanalyse auf der Basis persönlicher Wahrnehmung und Erfahrung, aber auch eine Schreckens-Version der Zukunft, die eintreten könnte, falls der Totalitarismus weltweit triumphiert.
Das Kapitel „Aufbau und Handlung des Romans" gibt eine Kurzzusammenfassung der Handlung von „1984". Der Roman erzählt die Geschichte aus der Perspektive der „Dritten Person" und spielt im Jahr 1984 in England, genauer gesagt in London. Der Protagonist Winston Smith entwickelt kritische Gedanken gegen die Parteidiktatur. Im ersten Teil des Buches erfährt der Leser, wie die Welt von „1984" aussieht: eine totalitäre Welt, in der eine winzig kleine Oligarchen-Riege alles kontrolliert, sogar die Gedanken und Gefühle der Bürger. Der Roman geht von einem internationalen System aus, das in drei große Machtblöcke zerfällt, die sich in einem permanenten Kriegszustand befinden. Winston arbeitet im „Ministerium für Wahrheit", wo er damit befasst ist, Berichte und Zeitungsartikel der Parteidoktrin entsprechend umzuschreiben.
Im zweiten Teil des Buches entwickelt sich eine Liebes-Affäre zwischen Winston und Julia, einer Parteigenossin, die ebenfalls revolutionärer Gesinnung ist. Das Paar vertraut sich O'Brien, einem Mitglied des inneren Parteikaders, an, den Winston ebenfalls für einen Dissidenten hält. Dieser nimmt sie scheinbar in die Widerstandsgruppe „Die Bruderschaft" auf und händigt Winston das von Emanuel Goldstein, dem Begründer und Anführer der Rebellen-Bewegung, verfasste Buch „Theorie und Praxis des oligarchischen Kollektivismus" aus. Aus der Lektüre erfahren Winston beziehungsweise der Leser, wie das System im Detail funktioniert. An dieser Stelle ist anzumerken, dass es sich hierbei sozusagen um ein Buch im Buch handelt, welches ungefähr zehn Prozent der gesamten Novelle ausmacht. Es ist anzunehmen, dass Orwell diesen Kunstgriff wählte, um sachlich, präzise und direkt über Ideologie, Gesellschaftsstruktur und Herrschaftsmethoden einer totalitär-hierarchischen Welttyrannei aufzuklären.
Bevor Winston Antwort auf die Frage nach dem „Warum" findet, wird er verhaftet. Er war O'Brien, in Wahrheit einer der Chef-Inquisitoren der Inneren Partei, der Winston schon seit sieben Jahren als potentiellen Regimegegner überwachte, in die Falle gegangen. Im Zentrum des dritten Teils steht die Bestrafung Winstons. Unter der von O'Brien geleiteten psychischen und physischen Folter lernt er am eigenen Leib das Wesen der Macht kennen und versteht, dass Macht in der totalitären Diktatur nicht Mittel, sondern Endziel ist. Für das Individuum gibt es letzten Endes kein Entrinnen, in der Schlüsselszene wird Winston dazu gebracht, dies zu akzeptieren. Der dystopische Held wird entmenschlicht und gebrochen, aber als konformes Parteimitglied in den totalitären Alltag entlassen.
Das Kapitel „Der Oligarchische Kollektivismus Ozeaniens" analysiert das politische System von Ozeanien. Der Roman beschreibt die historische Entwicklung, die zur Gesellschafts- bzw. Weltordnung, wie sie 1984 vorherrscht, führte. Orwell nennt Gründe für den dialektischen Umschwung von den klassischen Sozialutopien zu den nach den Zwanziger Jahren dominierenden negativen oder schwarzen Utopien, in deren Tradition er seinen Roman „1984" sah. Die staatstragende Ideologie des Oligarchischen Kollektivismus Ozeaniens trägt die Bezeichnung „Engsoc", was für „Englischer Sozialismus" steht. Der Sozialismus, eine Theorie, die im frühen Neunzehnten Jahrhundert auftauchte, war noch stark infiziert vom Utopismus früherer Epochen. Doch in jeder seiner nach dem Jahr 1900 auftauchenden Varianten ließ der Sozialismus das Ziel, Freiheit und Gleichheit zu schaffen, immer offener fallen. Die neuen Bewegungen, die um die Jahrhundertmitte auftraten, hatten das erklärte Ziel, Unfreiheit und Ungleichheit fortbestehen zu lassen.
Die Abschaffung der privaten Eigentumsverhältnisse, mittels derer sich die Parteioligarchie mühelos die Herrschaft aneignen konnte, diente nur der Befestigung der sozialen Ungleichheit. Die Partei sicherte auf diese Weise den Fortbestand der hierarchischen Gesellschaftsordnung im Interesse ihres eigenen absoluten Machtanspruchs. Das Ziel des oligarchischen Kollektivismus ist daher auch keinesfalls Produktionssteigerung, sondern die Verallgemeinerung des materiellen Mangels. Der Notstand dient vor allem dazu, das Volk weiterhin unmündig zu halten. Durch Angst verdummt und abgestumpft kann es sich nicht heranbilden und lernen selbstständig zu denken. Die breite Masse ist mit der bloßen Existenzsicherung beschäftigt und durch Propaganda und Unterhaltung zu befriedigen. Hier wird evident, warum die Partei „Unwissenheit ist Stärke" als eine ihrer Parolen ausgibt.
Die Partei sichert ihre Macht durch einen lückenlosen und grausamen Unterdrückungs- und Überwachungsapparat. Ein Parteimitglied lebt von der „Wiege bis zur Bahre" „unter den Augen der Gedankenpolizei". Um zu verdeutlichen, dass eben zitierte Aussage durchaus wörtlich zu verstehen ist, möchte ich an dieser Stelle auf die sogenannten „Telescreens" zu sprechen kommen. Es handelt sich dabei um Fernsehgeräte, die in beide Richtungen senden und empfangen und außer in den Proles-Bezirken omnipräsent sind. In jedem Zimmer der Wohnung eines Parteimitglieds ist ein solches Gerät installiert. Es gibt nur einen einzigen Kanal, der ausschließlich Parteipropaganda ausstrahlt und nicht abgeschaltet werden darf. Da der Monitor zudem wie eine Überwachungskamera funktioniert, kann das Parteimitglied jede Sekunde belauscht und beobachtet werden.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Totalitarismus, George Orwell, „1984", die Ideologie der Partei, die Gedankenpolizei, Überwachung, Propaganda, Manipulation, Krieg, Freiheit, Gleichheit, der neue Mensch, das Ende der Geschichte und die Rolle der Sprache in der totalitären Gesellschaft.
- Quote paper
- Miriam Helisch (Author), Carl Sulz (Author), Oliver Trenk (Author), 2013, Die Welt von George Orwells „1984“: Zwischen fiktivem Schrecken und realer Bedrohung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/232681