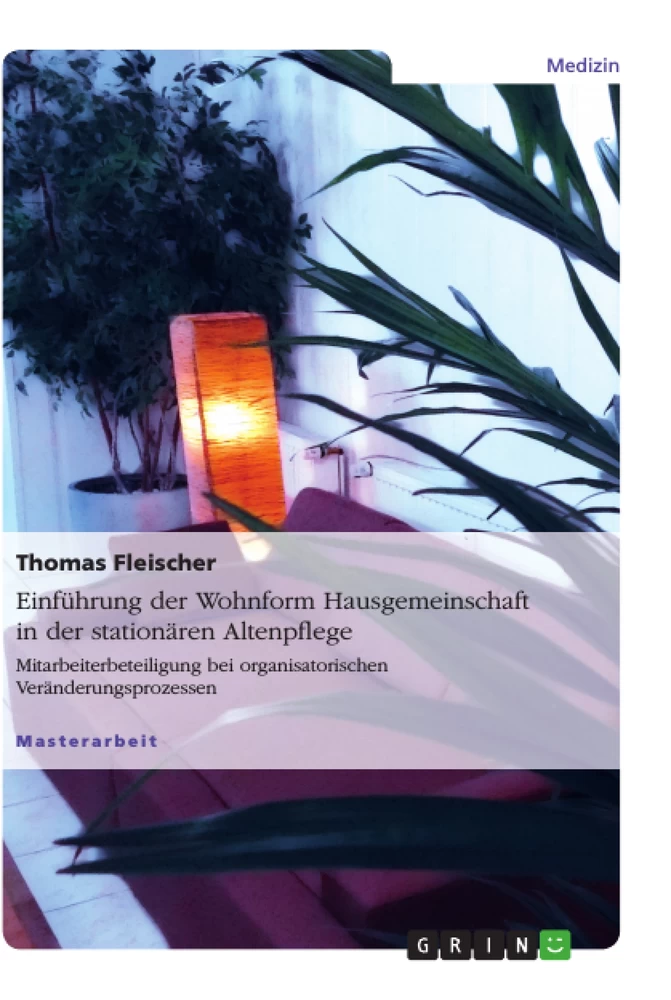Die Master-Thesis befasst sich mit der Einführung der Wohnform Hausgemeinschaft in bestehenden Einrichtungen der stationären Altenpflege. Der Fokus liegt dabei auf dem Mitarbeiter-Aspekt im Wandel. Die Fragestellung, welche der Arbeit zugrunde liegt, lautet: 'Wie können Leitungskräfte Ansätze des Change Management einsetzen, um mit den vorhandenen Mitarbeitern den praktischen Übergang vom Pflegeheim zur Wohnform der Hausgemeinschaft erfolgreich zu gestalten?'. Zunächst erfolgt eine Darstellung der Entwicklung der stationären Altenpflege in der Zeit seit Ende des zweiten Weltkrieges.
Hierin wird das Konzept der stationären Hausgemeinschaft als so genannter 'vierter Generation des Pflegeheimbaus' verortet. Dies erfolgt insbesondere auch in Abgrenzung zu den bisherigen Generationen des Pflegeheimbaus. Es folgt eine Darstellung des Hausgemeinschafts-Konzeptes mit Schwerpunkt auf dem Mitarbeiter-Aspekt. Anschließend werden Aspekte der Organisationsentwicklung und des Change Management in die Arbeit eingeführt. Der 'Umgang mit Widerständen' wird thematisiert sowie die Herstellung der Veränderungsbereitschaft, welche den Wandel begünstigt. Die herausragende Bedeutung der Kommunikation wird erläutert, ebenso die Rolle der Führung im Wandel.
Auf Basis der Literaturstudie werden fünf Voraussetzungen für einen erfolgreichen Wandel herausgearbeitet. Abschließend kommt es zur Anwendung der herausgearbeiteten Erkenntnisse am Beispiel eines Change-Projektes zur Umsetzung des Hausgemeinschafts-Konzeptes (konkrete Hinweise für ein Change-Projekt im Kontext der Fragestellung dieser Arbeit).
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis und Hinweise
Zusammenfassung (Abstract)
1. Einleitung
2. Stationäre Altenpflege im Wandel 7
2.1 Die Generationen des Pflegeheimbaus
2.2 Gründe für veränderte Wohnformen und Standpunkte
2.3 Der Übergang – vorgezeichneter Weg oder Aushandlungsprozess?
3. Das Hausgemeinschafts-Konzept
3.1 Herkunft
3.2 Was sind Hausgemeinschaften?
3.3 Wohn- und Hausgemeinschaften - ambulant und stationär
3.4 Konzeptionelle Aspekte
3.4.1 Anforderungen an die räumliche Gestaltung
3.4.2 Der Aspekt der Dezentralisierung
3.5 Grundlagen zum Personalkonzept
3.5.1 Personalkonzept: Die neue Funktion der Präsenzkraft
3.5.2 Personalkonzept: Die veränderte Rolle der Pflegekräfte
3.6 Kapitel 2 und 3: Zusammenfassung und Ausblick
4. Organisationsentwicklung und Change Management
4.1 Grundlagen und Entwicklung
4.2 Das Change-Projekt
4.3 Die Veränderungsbereitschaft
4.4 Die Bedeutung der Kommunikation
4.5 Der Wandel und die Mitarbeiter
4.6 Die Rolle der Führung
4.7 Komponenten eines erfolgreichen Change-Projektes
5. Change Management im Kontext der Umsetzung des HG-Konzeptes
5.1 Das HG-Konzept und die Mitarbeiter
5.2 Der Umgang mit Widerständen
5.3 Mitarbeitereinbezug
5.4 Teamtransformation
5.5 Mission, Visionen und Ziele
5.6 Spezielle Aspekte des Change-Projektes
5.7 Der Projektverlauf
6. Erfolgreicher Wandel stationärer Altenpflege
Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1, S. 35: Beispielhafte Gegenüberstellung der benötigten Vollzeitkräfte (VZK) im Wohnbereichs- bzw. im HG-Konzept. Modifiziert übernommen aus Arend 2005. S. 120
Hinweise
Zur besseren Lesbarkeit und für verständlichere Formulierungen wird in dieser
Arbeit von folgenden Vereinfachungen Gebrauch gemacht:
Abkürzung häufig wiederkehrender Begriffe
1.) Die Begriffe ‚Hausgemeinschaft‘/‘Hausgemeinschaften‘ werden besonders häufig gebraucht und werden im laufenden Text konsequent mit HG bzw. HGs abgekürzt (vgl. Abkürzungsverzeichnis). Ebenso wird die Abkürzung bei längeren Überschriften verwendet (vgl. Inhaltsverzeichnis).
2.) Der Begriff ‚Organisationsentwicklung‘ wird mit OE abgekürzt, der Begriff ‚Change Management‘ mit CM (vgl. Abkürzungsverzeichnis).
3.) Der Begriff ‚Mitarbeiter‘ wird jeweils mit ‚MA‘ abgekürzt, sofern er in Verbindung mit einem anderen Begriff steht – z. B. ‚MA-Einbezug‘ (vgl. Abkürzungsverzeichnis).
Männliche und weibliche Form
In dieser Arbeit wird durchgängig die männliche Form verwendet, es ist jedoch ausdrücklich immer auch die weibliche Form mit gemeint.
Zusammenfassung (Abstract)
Diese Master-Thesis befasst sich in Form einer Literaturarbeit mit der Einführung der Wohnform Hausgemeinschaft in bestehenden Einrichtungen der stationären
Altenpflege in Deutschland. Der Fokus liegt dabei auf dem Mitarbeiter-Aspekt im Wandel (Change). Hieraus leitet sich die Fragestellung ab: ‚ Wie können Leitungskräfte Ansätze des Change Management einsetzen, um mit den vorhandenen Mitarbeitern den praktischen Übergang vom Pflegeheim zur Wohnform der Hausgemeinschaft erfolgreich zu gestalten?‘. Zunächst erfolgt eine Darstellung der Entwicklung der stationären Altenpflege in der Zeit seit Ende des zweiten Weltkrieges. Hierin wird das Konzept der stationären Hausgemeinschaft als so genannter ‚vierter Generation des Pflegeheimbaus‘ verortet. Dies erfolgt insbesondere auch in
Abgrenzung zu den bisherigen Generationen des Pflegeheimbaus. Es folgt eine Darstellung des Hausgemeinschafts-Konzeptes mit Schwerpunkt auf dem Mitarbeiter-Aspekt. Anschließend werden Aspekte der Organisationsentwicklung und des Change Management in die Arbeit eingeführt. Der ‚Umgang mit Widerständen‘ wird thematisiert, sowie die Herstellung der Veränderungsbereitschaft, welche den Wandel begünstigt. Die herausragende Bedeutung der Kommunikation wird erläutert, ebenso die Rolle der Führung im Wandel. Auf Basis der Literaturstudie werden in dieser Arbeit fünf Voraussetzungen für einen erfolgreichen Wandel im Sinne der Fragestellung herausgearbeitet: A) Vertrauen der Mitarbeiter in die Unternehmensführung, B) Herstellung von Veränderungsbereitschaft, C) ausreichende/geregelte Kommunikation im Wandel, D) ein angemessenes Maß an Mitarbeiterbeteiligung und E) der richtige Umgang mit Widerständen. Hierbei werden immer wieder Verknüpfungen und Querverweise vorgenommen, welche die enge Wechselbeziehung, in der diese fünf Faktoren zueinander stehen, verdeutlichen. Abschließend kommt es zur theoretischen Anwendung der herausgearbeiteten Erkenntnisse am Beispiel eines Change-Projektes zur Umsetzung des Hausgemeinschafts-Konzeptes (Konkrete Hinweise für ein Change-Projekt im Kontext der Fragestellung dieser Arbeit).
1. Einleitung
Das Konzept der stationären Hausgemeinschaften (HGs) wurde vielfach beschrieben. Es finden sich Veröffentlichungen mit Aussagen z. B. zur räumlichen Gestaltung, zur personellen Besetzung, zur rechtlichen Stellung, zu Aspekten der Finanzierung, ebenso wie zur Aufgabenverteilung unter den Mitarbeitern. Einige Publikationen beschäftigen sich mit der Frage, wie bestehende Pflegeeinrichtungen durch bauliche Veränderungen in Richtung HGs umgestaltet werden können.
Nicht speziell beschrieben ist dagegen die Frage der Überleitung eines bestehenden Mitarbeiterteams weg vom ‚klassischen‘ Pflegeheim und hin zum HG-Konzept. Hierauf liegt der Schwerpunkt dieser Arbeit.
Daraus leitet sich die folgende Fragestellung ab:
„Wie können Leitungskräfte Ansätze des Change Management einsetzen, um
mit den vorhandenen Mitarbeitern den praktischen Übergang vom Pflegeheim
zur Wohnform der Hausgemeinschaft erfolgreich zu gestalten?“
Der Begriff Leitungskräfte wurde gewählt, da hier nicht spezifisch die Heimleitung, die Pflegedienstleitung oder die Geschäftsführung gemeint ist. Vielmehr sind alle leitenden Mitarbeiter gemeint, in deren (Mit-)Verantwortung und Kontrolle der entsprechende Umgestaltungsprozess liegt.
Aus der Fragestellung heraus ergibt sich die Gliederung dieser Arbeit:
- Kapitel 2 zeigt die fortlaufende Entwicklung der stationären Altenpflege auf, inklusive Gründen für diesen Wandel und Standpunkten unterschiedlicher Akteure und Interessensgruppen.
- Kapitel 3 befasst sich mit dem HG-Konzept, hierbei im Schwerpunkt mit konzeptuellen, organisatorischen und insbesondere personellen Aspekten. Dies bildet neben Kapitel 4 eine Grundlage für die weiteren Überlegungen.
- Kapitel 4 legt die theoretischen Grundlagen für das Change Management (CM), Change-Projekte und insbesondere den MA-Aspekt im Wandel.
- Kapitel 5 befasst sich mit CM im Kontext des HG-Konzeptes und mit direktem Bezug auf die Mitarbeiter. Zudem gibt es konkrete Hinweise zu einem möglichen Change-Projekt im Sinne der Fragestellung.
- Kapitel 6 nimmt Rückbezug zur Fragestellung, wagt einen Ausblick auf ergänzende Aspekte und Fragestellungen und rundet mit einer abschließenden Stellungnahme diese Arbeit ab.
2. Stationäre Altenpflege im Wandel
Die stationäre Altenpflege war nie statisch, sondern hat sich stetig weiterentwickelt und dabei geänderten gesellschaftlichen Anforderungen angepasst. Die stationären HGs sind Teil dieses Wandels, suchen aber noch ihren festen Platz in dieser fortlaufenden Entwicklung, wie in Kapitel 2.3 festgestellt wird.
2.1 Die Generationen des Pflegeheimbaus
Nicht jeder Akteur in der stationären Altenpflege dürfte mit dem Konzept der vier oder fünf Generationen des stationären Pflegeheimbaus vertraut sein. Dieses wird insbesondere vom Kuratorium Deutsche Altershilfe (KDA) propagiert und wurde von diversen Autoren aufgegriffen, speziell wenn es darum geht, das HG-Konzept in eine logische Abfolge der Entwicklung der stationären Altenpflege zu bringen:
„Folgt man dem Gliederungsvorschlag des Kuratoriums für Deutsche Altershilfe (KDA) in Köln, so kann man in der Moderne, seit 1945, von vier Generationen des Altenpflegeheimbaus in Deutschland sprechen.“[2]
Als übergeordneter Trend sei hierbei „eine Tendenz zur immer spezifischeren, individuellen und ganzheitlichen Betrachtung und Förderung der einzelnen Bewohnerin bzw. des einzelnen Bewohners“[3] festzustellen.
Dieser Trend lässt sich u. a. auch an baulichen Entwicklungen ablesen, so an der Tendenz zum Abbau von Mehrbettzimmern, zu größeren Flächenanteilen pro
Bewohner und zu einer allgemeinen Steigerung der Wohnlichkeit.[4]
Nachfolgend eine Beschreibung der vier bzw. fünf Generationen der stationären
Altenpflege seit 1945:
Die erste Generation – Leitbild: ‚Verwahranstalt‘
Diese Generation des Pflegeheimbaus, welche bis in die 1960er Jahre hinein bestand hatte, zeichnete sich häufig durch eine hohe Belegungsdichte, Mehrbettzimmer für 3 bis 6 Bewohner, lange und funktionale Flure und gemeinsame Sanitäreinrichtungen aus. Es mangelte an Wohnlichkeit und die Mitnahme eigener Einrichtungsgegenstände war i.d.R. nicht möglich.[5]
Dementsprechend auch der Sprachgebrauch:
„Für die Charakterisierung der bis Anfang der 60er Jahre vorherrschenden Pflegeeinrichtungen bietet sich die Bezeichnung „Verwahranstalt“ an. Nicht zufällig sprach man üblicherweise von „Insassen“. Diesen Einrichtungen lag weder ein Wohn- noch ein Pflegekonzept zugrunde.“[6]
Die zweite Generation – Leitbild: ‚Krankenhaus‘
Diese Generation hatte ihren Anfang in den 1960er Jahren und bestand bis in die 1980er Jahre hinein fort, während sie ihren Höhepunkt in den 1970er Jahren hatte.
„Die zweite Generation ist vor allem als Reaktion auf die Mängel der ersten zu verstehen: Es wurden vorrangig Vorkehrungen getroffen, welche die Pflege Bettlägeriger erleichterten.“[7]
Die Technisierung der Pflegeheime nahm erheblich zu, während gleichzeitig die
Belegungsdichte abnahm. Pflegeabläufe wurden unter technischen Gesichtspunkten optimiert (Stichwort: ‚Fäkalienspüle‘). Auch Bäderabteilungen hielten Einzug in die Häuser. Aus der ‚Verwahrung‘ wurde die ‚Behandlung‘, aus dem ‚Insassen‘ der
‚Patient‘. Das Vorbild dieser Generation waren unverkennbar die Krankenhäuser, sowohl in der Ausstattung, als auch in der Architektur. Analog zum Krankenhaus mangelte es jedoch weiterhin an Wohnlichkeit.[8]
Die dritte Generation – Leitbild: ‚Wohnheim‘
Diese Generation existiert seit den 1980er Jahren, ist weiterhin aktuell und entspricht wesentlich unserer heutigen Vorstellung eines Altenpflegeheims mit Wohnbereichskonzept. Der Sprachgebrauch dieser Generation ist nach wie vor zeitgemäß: Man spricht vom ‚Wohnbereich‘ und vom ‚Bewohner‘. Nicht mehr ‚Behandlung‘ steht im Mittelpunkt, sondern ‚Aktivierung‘ – und im hohen Maße hielt Wohnlichkeit Einzug. Dies trägt – anders als noch in der zweiten Generation – der Tatsache Rechnung, dass die Menschen nicht vorübergehend behandelt werden, sondern hier ihren letzten Lebensabschnitt verbringen.
Die Pflege ist nicht mehr vorrangig kompensatorisch tätig, sondern aktivierend, d. h. sie soll die verbleibenden Ressourcen der Bewohner fördern und einbeziehen. Die weiterhin vorhandene Technik tritt dezent in den Hintergrund und es gibt eine
Mischung aus Einzel- und Doppelzimmern. Durch eine Auflockerung der Grundrisse soll eine Abkehr von der sterilen Optik langer Krankenhausflure erreicht werden.[9]
„Es etablierte sich mehr und mehr, Heime als lebendige, soziale Räume zu betrachten mit Möglichkeiten zu Kontakt und Aktivitäten, zu Privatheit und Ruhe.“[10]
Die vierte Generation – Leitbild: ‚Familie‘
Bei dieser Generation handelt es sich um das stationäre HG-Konzept, wobei diese vierte Generation bislang keineswegs die dritte ablösen konnte[11]: Weiterhin werden neue Einrichtungen nach dem Wohnbereichs-Konzept der dritten Generation errichtet. Es ist noch nicht klar, ob die vierte Generation überhaupt die dritte vollständig wird ersetzen können (vgl. Kap. 2.3), auch weil bisher keine Einigkeit darüber besteht, ob HGs für alle Bewohnergruppen gleichermaßen geeignet sind, oder bestimmten Zielgruppen vorbehalten bleiben sollten (vgl. in Kap. 3.4).
Dennoch kann festgehalten werden:
„Als kritische Alternative zu konventionellen Altenpflegeheimen der 2. und 3. Generation gewinnen Hausgemeinschaften der 4. Generation des Altenpflegeheimbaus (…) - besonders in Zusammenhang mit Neubauvorhaben oder bei Totalsanierungen von Heimbeständen – in Deutschland immer mehr an Bedeutung.“[12]
Die genauen Spezifika dieser Generation werden in Kapitel 3 ausführlich beschrieben. Das besondere Wesensmerkmal dieser Generation ist die Abkehr vom Wohnbereich mit seinen mitunter 30 oder 40 Bewohnern. Dieser wird abgelöst durch kleine Wohneinheiten mit i.d.R. acht bis max. zwölf Bewohnern.
Den Bewohnern wird Kleinteiligkeit und Überschaubarkeit geboten in einem Setting, das am Ideal der Großfamilie ausgerichtet ist. Weitere markante Merkmale sind
eine dezentrale Struktur (z. B. keine Großküche – es wird vor Ort in der HG gekocht) und die permanente Anwesenheit einer Präsenzkraft. Außerdem soll die Pflege dezent in den Hintergrund treten.
Das Ideal der ‚Alltagsnormalität‘ steht über allem. Und Alltagsnormalität findet sich nicht in den Tätigkeiten der Pflege, sondern in gelebter Normalität – und hier insbesondere in den hauswirtschaftlichen Verrichtungen.[13]
Die fünfte Generation – Quartierskonzepte
Die fünfte Generation wurde vom KDA in jüngerer Zeit (ca. 2010) ausgerufen und stellt keine Abkehr von der vierten Generation dar:
„Die KDA-Quartiershäuser sind eine konsequente Weiterentwicklung und Bestätigung der 4. Generation, den KDA-Hausgemeinschaften. (…) Der Leitgedanke der Normalität wurde für das Konzept der KDA-Quartiershäuser noch weiter gedacht und um die Prinzipien „Leben in Privatheit“ und „Leben in der Öffentlichkeit“
ergänzt.“[14]
Es geht um eine Öffnung der HGs ins Quartier und um eine Vernetzung der stationären Einrichtungen in ihrem Umfeld (z. B. Stadtteil). Dies steht teilweise im Widerspruch zu großen stationären Pflegeeinrichtungen und spricht eher für dezentral
organisierte kleinere Einheiten, die in lokale Strukturen eingebettet sind.[15]
Jedoch finden sich Hinweise darauf, wie dies auch mit bestehenden stationären Pflegeeinrichtungen gelingen kann: Diese müssten sich mit abgestuften Angeboten ins Quartier öffnen und als Dienstleister in selbigem verstehen.[16]
Gegenüberstellung: Wohnbereichs- und HG-Konzept
Mit der folgenden Gegenüberstellung sollen einige markante Unterschiede im Übergang von der 3. zur 4. und 5. Generation noch einmal verdeutlicht werden:
- Im Wohnbereichs-Konzept (WB-Konzept) existieren in der Einrichtung mehrere Wohnbereiche (WBs) mit je ca. 20-40 Personen. Dagegen leben die Menschen im HG-Konzept in Wohngruppen von 8-12 Personen.[17]
- Die WBs sind mit den zentralen Einrichtungen (z. B. Großküche) zu einer funktionalen Einheit vernetzt. Die HGs dagegen funktionieren teilautonom, kochen z. B. selbst, haben ihren eigenen Speiseplan, kaufen ggf. sogar selbst ein.17
- In der HG ist tagsüber durchgehend eine Präsenzkraft anwesend, die den personellen Dreh- und Angelpunkt für die Bewohner, ebenso wie für Besucher bildet. In den WBs gibt es eine derartige Funktion nicht.17
Besonders greifbar wird der Unterschied anhand des folgenden Aspekts: Die Speisen kommen im HG-Konzept nicht mehr aus einer Zentralküche, sondern werden von der Präsenzkraft direkt in der HG gekocht. Die Bewohner sehen es, sie riechen es – und sie können im Rahmen ihrer Möglichkeiten und Interessen mithelfen.
2.2 Gründe für veränderte Wohnformen und Standpunkte
Wieso muss die stationäre Altenpflege sich überhaupt Gedanken über einen Wandel machen? Wieso kann nicht alles bleiben, wie es ist? Hierfür wurden in der Literaturrecherche zahlreiche Argumente gefunden, die hier nur stark verkürzt wiedergegeben werden können:
Veränderte Bewohnerstruktur
Es gibt eine steigende Anzahl pflegebedürftiger älterer Menschen, die nach einem (verkürzten) Krankenhaus-Aufenthalt nicht mehr in das häusliche Setting zurück können. Ebenso gibt es eine steigende Anzahl von alten und pflegebedürftigen Migranten, die nicht mehr durch familiäre Netze aufgefangen werden. Durch kulturelle und Sprachbarrieren kommen neue Herausforderungen auf die stationäre Pflege zu. Zudem gibt es eine wachsende Zahl pflegebedürftiger älterer Menschen mit geistigen Behinderungen. Die Zusammensetzung der Bewohnerstruktur verändert sich und die stationäre Altenpflege muss sich daran anpassen.[18]
Veränderte Ansprüche
Dieser Anspruchswandel geht sowohl von den potentiellen Bewohnern selbst aus, als auch von ihren Angehörigen und von öffentlichen Stellen. Der Kunde formuliert seine Erwartungen zunehmend mündiger. Der Wunsch nach Selbstbestimmtheit auch nach einem Heimeinzug wächst. Werte wie Geborgenheit, Überschaubarkeit, Wohnlichkeit und Alltagsnormalität werden zunehmend eingefordert.[19]
„Die Ansprüche der Angehörigen und Entscheidungsträger wachsen angesichts noch relativ guter Möglichkeiten in Deutschland und dank eines stetig expandierenden Wettbewerbs in der stationären Versorgung älterer und pflegebedürftiger Menschen.“[20]
Veränderte rechtliche Rahmenbedingungen
Die Föderalismusreform ersetzte das (Bundes-)Heimgesetz (HeimG) durch 16 individuelle Landes-Heimgesetze. Diese wurden vielfach zum Anlass genommen, bisherige Konzepte auf den Prüfstand zu stellen. Auch beinhalten sie oftmals Regelungen (z. B. ‚Experimentierklauseln‘), die die Umsetzung des HG-Konzeptes begünstigen.[21]
Veränderte Situation der Angehörigen
Als Argumente werden z. B. die steigende Zahl von Single-Haushalten, die steigende Bedeutung von Demenz und die damit verbundene psychische Belastung für Angehörige, oder die Notwendigkeit der höheren beruflichen Flexibilität und Mobilität benannt. „Die aus diesen Gründen resultierende Rückläufigkeit potenziell Pflegender führt dazu, dass immer mehr professionelle Hilfe in Anspruch genommen wird und die Ansprüche Angehöriger an entsprechende Angebote steigen.“[22]
(Pflege-)Fachliche Aspekte
Neuere Pflege- und Betreuungskonzepte, die sich auf die wachsende Bedeutung der Demenz und des damit teilweise einhergehenden so genannten ‚herausfordernden Verhaltens‘ auseinandersetzen, setzen auf „kleinteiligere, kleingruppenorientierte Wohnkonzepte, in denen die traditionelle Trennung von Hauswirtschaft, Pflege und sozialer Betreuung räumlich und personell aufgehoben sind.“[23]
Das Streben nach Normalität
Der Mensch möchte sich, auch im Falle eines Selbstfürsorgedefizits, so viel Normalität wie möglich erhalten. Er möchte beispielsweise seinem gewohnten Tagesrhythmus folgen und selbst festlegen, wann er sich in Gemeinschaft aufhält und wann er sich in die Privatsphäre zurückzieht. Dies ist von der Anlage her in HGs weitaus einfacher möglich als im klassischen Wohnbereich.[24]
Aspekt der Lebensqualität
Einige Quellen verweisen darauf, dass der Aspekt der Lebensqualität insbesondere mit Merkmalen wie Selbstständigkeit, Vertrautheit, Geborgenheit, Eigenverantwortlichkeit oder Privatheit einhergeht. Dies sind Attribute, die eher im Konzept der HG beheimatet sind, als im klassischen Wohnbereich.[25]
„Lebensweltorientierung, Hausgemeinschaftswohnungen, De-Institutionalisie-rung, Autonomes Leben im Alter oder Selbstbestimmung, lauten einige zentrale Begriffe der fachöffentlich geführten Heimdiskussion.“[26]
Die wachsende Bedeutung der Demenz
Mit der steigenden Lebenserwartung steigt auch die Zahl der Demenzen kontinuierlich an.
Hochaltrige Menschen mit mittel- bis schwergradiger Demenz werden zunehmend zur dominanten Klientel – schon bei der Aufnahme ins Pflegeheim.[27]
„Seit Mitte der 90er Jahre prägen Hochaltrigkeit und Demenz die Bewohnerschaft stationärer Pflegeeinrichtungen, während jüngere und in ihrer Mobilität eingeschränkte Pflegebedürftige häufiger andere Wohnformen als Alternativen zum Pflegeheim finden.“[28]
Gleichzeitig gibt es Anzeichen dafür, dass klassische Wohnbereiche aufgrund ihrer Größe und ihrer mangelnden Überschaubarkeit dazu beitragen können, Orientierungsstörungen bei dementen Bewohnern zu verstärken und damit Verhaltensauffälligkeiten zu fördern.[29] Hier kann das HG-Konzept seine Vorteile ausspielen.
Eine besondere Rolle spielt der Aspekt der ‚Vertrautheit‘: Je mehr Vertrautheit
geschaffen werde, desto mehr würden Verwirrtheit und das aus der Verwirrtheit
resultierende auffällige Verhalten zurückgehen. Diese Vertrautheit wird in den HGs einerseits durch die Kleinteiligkeit (i.d.R. 8 – 12 Bewohner) und andererseits durch die Anwesenheit einer Bezugsperson (=Präsenzkraft) erreicht.[30]
„Das Prinzip der Vertrautheit, das eine auf pflegebedürftige und/oder demente
ältere Menschen zugeschnittene, familienähnliche Wohnform erzeugt, wird seit rund zwei Jahrzehnten in der französischen Wohnform des „Cantous“ erfolgreich praktiziert.“ (…) „Ähnlich wie in den französischen Cantous geht es bei den deutschen Hausgemeinschaften darum, Lebensqualität für demenziell erkrankte und pflegebedürftige Bewohnerinnen und Bewohner zu schaffen, (…)“[31]
Das Pflegeheim als (schon immer) widernatürliches Umfeld
Barbara Schröder (2000) beschreibt, dass gerade für die Nachkriegsgeneration, die sich selbst etwas aufbauen musste, die Übersiedlung ins Heim wie ein Misserfolg und ein persönliches Versagen erscheinen müsse. Zudem bedeute die Übersiedlung ins Heim die Umstellung auf eine erheblich neue Umwelt, die im Alter entsprechend schwer falle – mit allen daraus erwachsenden Nachteilen.[32]
Palm/Bogert (2007) sprechen von einer ‚misslichen Lage‘ der alten Menschen in der stationären Altenpflege. Diese Lage rechtfertige den Versuch eines generellen Neuanfangs, für die das HG-Konzept wiederum einen viel versprechenden Ansatz darstelle.[33]
Standpunkte unterschiedlicher Akteure
Das Kuratorium Deutsche Altershilfe (KDA), dessen Selbstzweck die Förderung der Lebensqualität älterer Menschen ist, trägt seit Ende der 1990er Jahre maßgeblich zur Etablierung des HG-Konzeptes in Deutschland bei und hat dieses auch als die vierte Generation des Pflegeheimbaus beschrieben (vgl. Kap. 2.1).
„Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Hausgemeinschaften (…) eine deutliche Verbesserung der Versorgungsstrukturen für demenziell Erkrankte
gegenüber herkömmlichen Heimen gewährleisten.“[34]
Im Vierten Bericht zur Lage der älteren Generation wird die steigende Bedeutung der stationären HG anerkannt. Sie stünde „für eine Abkehr von institutionalisierten, vordergründig auf Pflegequalität ausgerichteten Modellen und für eine Hinwendung zu einem an mehr Lebensqualität orientierten Normalitäts-Prinzip.“[35]
Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) hat sich – in Zusammenarbeit mit dem KDA – für ein Modellprogramm engagiert und spielt(e) hierdurch eine aktive Rolle in der Förderung stationärer HG-Konzepte.[36]
Die Verbände der Pflegekassen in Hessen setzen sich in einer Stellungnahme
zumindest differenziert mit dem HG-Konzept auseinander. Sie begrüßen es als
zusätzliche Option/Wahlmöglichkeit in einem sich allmählich pluralisierenden Markt, sprechen ihm jedoch eine generelle Bedeutung als vierte Generation der Pflegeheime (Vgl. Kap. 2.1) ab.[37]
Der Hessische Landkreistrag (u. a. als Kostenträger) verweist darauf, dass die
Befürwortung der Aufnahme in eine HG daran gekoppelt sein muss, dass deren Konzept der Bedürfnislage des Betroffenen entspricht und dass die Kosten verhältnismäßig sind. Sie schließen aber grundsätzlich positiv: „Nach allem setzen sich die örtlichen Träger der Sozialhilfe für den Auf- und Ausbau eines wohnortnahen Angebotes an Hausgemeinschaften und Wohngruppen für Demente ein. Sie sehen darin eine wirksame Ergänzung und Fortentwicklung bestehender Angebote.“[38]
Der Arbeitskreis Hessische Hausgemeinschaften verweist auf die steigende Bedeutung der Diagnose Demenz für die stationäre Altenpflege und kommt zu dem Schluss: „(…) aus heutiger Sicht erscheint das Modell der Hausgemeinschaften am ehesten geeignet, den veränderten Anforderungen gerecht zu werden (…).“[39]
2.3 Der Übergang – vorgezeichneter Weg oder Aushandlungsprozess?
Wie in Kapitel 2.1 aufgezeigt, gab es nach dem zweiten Weltkrieg eine fortlaufende Entwicklung der stationären Altenpflege, die sich in mehreren gut voneinander
abgrenzbaren Generationen darstellen lässt. Wenn insbesondere das KDA das HG-Konzept heute als ‚vierte Generation des Pflegeheimbaus‘ propagiert, bedeutet dies dann zwangsläufig einen vollständigen Übergang auf diese neue Generation? Schließlich impliziert allein der Begriff ‚Generation‘ ja auf lange Sicht eine Ablösung – und nicht etwa ein Nebeneinander auf Dauer. Dennoch ist genau dieses Nebeneinander in der Praxis zu beobachten, da es einerseits bereits zur Jahrtausendwende erste Praxisprojekte nach dem HG-Konzept gab, aber andererseits bis heute bundesweit Pflegeheim-Neubauten entstehen, die klar der dritten Generation zuzuordnen sind.[40]
In aktuelleren Publikationen des KDA wird mittlerweile auf dieses Nebeneinander hingewiesen:
Die dritte und vierte Pflegeheimgeneration – Wohnbereichskonzept und Hausgemeinschaftskonzept – prägen heute die Pflegelandschaft, sind die favorisierten Modelle gegenwärtiger Neubaumaßnahmen, ergänzen sich gegenseitig, basieren jedoch auf unterschiedlichen räumlichen und pflegerischen Grundlagen.“[41]
Nach der gleichen Quelle sei davon auszugehen, dass es keinen vollständigen Übergang geben werde, sondern dass Häuser der dritten und der vierten Generation sich auch in Zukunft gegenseitig ergänzen würden, wodurch sich eine Wahloption für Träger, aber natürlich insbesondere für potentielle Bewohner eröffnet.[42]
Ältere Quellen waren noch von einem vollständigen Übergang ausgegangen:
„Auch wenn die Entwicklung im Pflegeheimbau (…) weg von konventionellen Pflegeheimen auf Hausgemeinschaften als vierter Generation zuläuft, bedeutet das nicht, dass die Ablösung der dritten durch die vierte Generation heute bereits gänzlich vollzogen ist. De facto steht der Umbruch noch bevor, (…)“[43]
Müller/Seidl (2003) betonen, dass das HG-Konzept einen ‚Paradigmenwechsel‘ in der stationären Altenpflege darstelle. Sie betonen insbesondere den Aspekt der ‚Alltagsnormalität‘, der eine Klammer zwischen dem alten und dem neuen Alltag der Bewohner bilden könne.[44]
„Ob Hausgemeinschaften traditionelle Heimstrukturen ablösen, werden die Älteren von morgen entscheiden; hilfreich dafür ist es, sich vorzustellen, wie man im Alter leben und versorgt werden möchte.“[45]
Palm/Bogert (2007) argumentieren besonders drastisch PRO Hausgemeinschaft, indem sie dem klassischen Pflegeheim-Konzept wesentliche Merkmale der ‚Totalen Institution‘ (nach Erving Goffman, 1961) zuordnen:
„(…) es geht um die Abschaffung all dessen, was Heime „hermetisch“ macht, sie mit „Keimen“ der totalen Institution ausstattet: Fremdbestimmte Regeln, hermetische Grenzen, Anregungsarmut durch falsche oder fehlende Handlungsräume, Logik der Institution statt Lebensweltorientierung, Funktion statt Beziehung bei der pflegerischen Begegnung, um nur einige Stichworte zu nennen (vgl. Koch-Straube, 1996).“[46]
Dies würde im Sinne der Autoren bedeuten, dass ‚klassische‘ Pflegeheime generell kein Ort wären, der wichtigen Grundbedürfnissen der Menschen, wie beispielsweise dem Bedürfnis nach individueller Selbstentfaltung, gerecht werden könnte. Das HG-Konzept wäre demnach nur ein folgerichtiger und überfälliger Schritt, um den
Bedürfnissen der Menschen gerecht zu werden. So steht ihre Publikation auch unter dem Titel „Hausgemeinschaften. „Ein“ Ausweg aus dem Irrweg für die stationäre Altenhilfe“. Dieser Logik folgend würde sich ein Nebeneinander von dritter und vierter Generation ausschließen.
Wie könnte der Wandel praktisch geschehen?
Kaiser, Gudrun (2012) verweist darauf, dass heute zahlreiche Häuser der ersten und zweiten Generation in Betrieb seien, die nachträglich saniert und an heutige Bedürfnisse (i.d.R. dritte Generation) angepasst wurden.[47] So könne es auch beim nächsten Übergang geschehen: „Viele Häuser der dritten Generation eignen sich zur Umwandlung in Hausgemeinschaftsprojekte, indem Wohnbereiche in hausgemeinschaftliche Kleingruppen aufgeteilt, Personalkonzepte verändert und Großküche und Wäscherei aufgelöst oder einer anderen Zweckbestimmung zugeführt werden.“[48]
Abschließend ist festzuhalten, dass es zur Frage des (vollständigen?) Überganges von der dritten zur vierten Generation unterschiedliche Meinungen, aber noch keine abschließende Antwort gibt.
3. Das Hausgemeinschafts-Konzept
Kapitel 2 hat das HG-Konzept in der allgemeinen Entwicklung der Landschaft der stationären Altenpflege verortet. Es wurden Gründe aufgezeigt, die für diese neue Form, stationäre Altenpflege zu denken und zu organisieren, sprechen.
In Kapitel 3 geht es darum, das Konzept der stationären Hausgemeinschaften in seinen wichtigsten Elementen darzustellen, wobei solche Aspekte besonders betont werden, die in Hinblick auf die Fragestellung dieser Arbeit relevant sind.
3.1 Herkunft
Die unterschiedlichen Quellen sind sich darin einig, dass insbesondere Vorerfahrungen aus dem europäischen Ausland, namentlich das Cantou -Modell aus Frankreich und die so genannten Hofjes aus den Niederlanden, eine Vorbildfunktion für das HG-Konzept hatten und dann maßgeblich durch das KDA auf die deutschen Verhältnisse angepasst wurden.[49]
„Die Konzeptionen von Hausgemeinschaften wurden anfänglich besonders durch Projekte in den Niederlanden (Anton-Pick-Hofje) und in Frankreich (Cantous) beeinflusst. Das Kuratorium Deutsche Altershilfe (KDA) analysierte diese sehr verheißungsvollen Projekte des benachbarten Auslands und stimmte die dort erfolgreich angewendeten Konzepte auf die deutschen Gegebenheiten und den Bedarf in Deutschland ab.“[50]
Als weitere mögliche Vorbilder werden zudem die Group Living Facilities / Group Homes in Schweden, die Pflegewohnungen in der Schweiz, sowie die Abbeyfield Societies in Großbritannien genannt.[51]
Festzustellen ist hierbei, dass diese Entwicklung im europäischen Ausland mitunter schon Jahrzehnte vor den ersten Ansätzen in Deutschland eingesetzt hat: Während ambulante Ansätze in Deutschland seit den 1990er Jahren, stationäre sogar erst seit der Jahrtausendwende diskutiert werden, setzten die Entwicklungen im europäischen Ausland teilweise bereits in den 1950er und 1960er Jahren ein.[52]
Einige Elemente sind all diesen Modellen im Großen und Ganzen gemeinsam und bilden auch die wesentlichen Eigenschaften der Hausgemeinschaften:
- Es handelt sich um relativ kleine Gruppen für i.d.R. 6 bis 12 Bewohner.
- Nicht die Pflege, sondern die normale Alltagsgestaltung steht im Mittelpunkt.
- Häufig gibt es eine Hauswirtschafts- oder Präsenzkraft, die tagsüber den personellen Dreh- und Angelpunkt dieser Wohnform darstellt.
- I.d.R. verfügt jeder Bewohner über ein Einzelzimmer. Auf der anderen Seite gibt es eine Betonung des Wohn- und Gemeinschaftsbereiches:
à Privatsphäre einerseits und Gemeinschaft andererseits werden gefördert.
- Der Schwerpunkt liegt häufig bei der Demenz.
- Es gibt einen definierten räumlichen Mittelpunkt, um den sich das Leben gruppiert. Im Falle der niederländischen Hofjes ist dies der Innenhof (= Hofje), i.d.R. wird der Mittelpunkt jedoch durch die Wohnküche bzw. die Kochstelle definiert.
- Die Gemeinschaft und die Alltagsnormalität stehen im Vordergrund.
- Der Einbezug der Angehörigen ist oft fester Bestandteil des Konzeptes.[53]
Hiermit sind bereits die wichtigsten Elemente des HG-Konzeptes in verkürzter Form benannt. Noch offensichtlicher werden hierbei auch die elementaren Unterschiede zum ‚klassischen‘ Wohnbereichskonzept: Keiner der benannten Punkte (mit Ausnahme des Schwerpunktes ‚Demenz‘ im Falle segregativer Demenz-Wohnbereiche) ist typisch für das Wohnbereichskonzept.
Besonders elementar ist, dass diese Wohn- und Betreuungsformen (so auch das HG-Konzept) einen Mittepunkt im doppelten Sinne aufweisen:
- Der Mittelpunkt wird in personeller Sicht durch die Hauswirtschafts- oder Präsenzkraft (vgl. oben) gebildet.
- Der Mittelpunkt in räumlicher Hinsicht wird im Falle der Hofjes durch den Innenhof gebildet (siehe oben), im Falle der französischen Cantous durch den Herd: „Cantou bedeutet Feuerstelle im Haus, um die man sich zu versammeln pflegt(e). Um diesen „magischen“ Mittelpunkt herum spielt sich das gemeinsame Leben ab.“[54]
Auch das ‚deutsche‘ HG-Konzept verzichtet nicht auf diese beiden Aspekte:
- Die Rolle der Präsenzkraft ist elementar für das HG-Konzept. Da es sich um eine neue Aufgabenzuschreibung handelt, kommt ihr im Change-Projekt eine besondere Aufmerksamkeit zu (vgl. Kap. 3.5.1).
- Der räumliche Mittepunkt wird im HG-Konzept im Sinne des KDA durch die zentrale Wohnküche gebildet (vgl. Kap. 3.4.1).
3.2 Was sind Hausgemeinschaften?
Das KDA definiert die stationären Hausgemeinschaften in einer frühen Veröffentlichung aus dem Jahr 2000 wie folgt:
„Eine Hausgemeinschaft ist eine räumliche und organisatorische Einheit, in der sechs bis acht ältere und pflegebedürftige Menschen leben.“[55] Und weiter:
„Alle Pflege- und Betreuungsleistungen, die nicht von den Bewohnern selbst, den Angehörigen und/oder Freunden geleistet werden können, werden über die Präsenzkräfte im Zusammenhang mit den Tagesaktivitäten oder/und über den hauseigenen pflegerischen Dienst erbracht.“ 55
Die Zahl von sechs bis acht Bewohnern wurde in frühen Veröffentlichungen als ideale Größe angenommen, in späteren Publikationen wird diese Zahl auf bis zu zwölf Bewohner ausgeweitet,[56] was nicht zuletzt betriebswirtschaftlichen Belangen Rechnung tragen soll.
Deutlich wird im zweiten Teil dieser Definition insbesondere die veränderte Rolle der Pflege (vgl. hierzu ausführlich Kap. 3.5.2): Leistungen der Pflege und Betreuung sollen zunächst einmal von den Bewohnern selbst, nachrangig von Angehörigen
oder Freunden, nachgeordnet von der Präsenzkraft (= keine Pflegekraft, vgl. Kap. 3.5.1) erbracht werden. Erst wenn all dies nicht ausreicht, soll die Berufsgruppe der Pflegenden kompensatorisch tätig werden.
Die Formulierung ‚hauseigener pflegerischer Dienst‘ deutet dabei bereits an, dass dieser Pflegedienst nicht zwangsläufig fester Bestandteil der jeweiligen HG ist, sondern ggf. wie ein externer Dienstleister in die HG kommt, um punktuell seine Dienstleistungen zu erbringen.
Dies ist ein bedeutender Aspekt im Übergang eines bestehenden Teams zum Konzept der Hausgemeinschaften, da sich insbesondere die Pflegekräfte mit einer deutlich veränderten Selbst- und Fremdwahrnehmung ihrer Rolle auseinanderzusetzen haben. Dies bedarf im Zuge eines entsprechenden Change-Projektes besonderer Aufmerksamkeit.
Gemäß Kaiser, Gudrun (2012) sind Hausgemeinschaften „konzeptionell in erster Linie auf Humanität und Lebensqualität, insbesondere auch auf Überschaubarkeit, Geborgenheit, Vertrautheit und Normalität des Wohnmilieus ausgerichtet.“[57]
Dies stelle eine Abkehr vom ‚klassischen‘ institutionalisierten Pflegeheim-Modell (der 3. Generation) dar.[58]
Diese Abkehr wird von Müller/Seidl (2003) als ‚Paradigmenwechsel‘ innerhalb der stationären Pflege bezeichnet, der sich in folgende Aspekte ausdifferenzieren lasse:
1. Deinstitutionalisierung im Sinne von Überschaubarkeit und Kleinräumigkeit und damit insbesondere einem (stationären) Milieu, das förderlich ist für die Aufrechterhaltung der Person-Umwelt-Beziehung dementer Bewohner.
2. Personen- und Alltagsorientierung und damit eine Abkehr von der Defizitorientierung (die im Umkehrschluss der stationären Pflege im klassischen Wohnbereichskonzept unterstellt wird).
3. Abkehr vom maximalen Versorgungsprinzip: Es geht um Alltagsnormalität. Therapeutische Maßnahmen haben in den Hintergrund zu treten.
4. Gestaltung des sozialen Milieus – in erster Linie durch die Präsenzkraft, die (tagsüber) den Alltag in der HG begleitet.[59]
„Bei dem Konzept der heimverbundenen Hausgemeinschaft steht (…) die Aufrechterhaltung von möglichst viel Alltagsnormalität im Vordergrund.“[60]
Der Paradigmenwechsel besteht darin, dass im klassischen Setting stationärer Pflege eben nicht die Aufrechterhaltung der Alltagsnormalität, sondern die Kompensation von pflegefachlich identifizierten Defiziten im Vordergrund stünde.
Es zeigt sich, dass das HG-Konzept immer wieder nicht für sich genommen, sondern in Abgrenzung zum ‚klassischen‘ Wohnbereichs-Setting definiert wird.
Nachfolgend einige originäre Eigenschaften stationärer HGs in stichpunktartiger Zusammenfassung:
- Eine ‚Großwohnung‘ für bis zu zwölf Personen .
- Jeweils ein eigenes Zimmer, idealerweise mit je eigenem Duschbad/WC.
à Bietet Rückzugsmöglichkeit / Privatheit. Eigene Gestaltung erwünscht.
- Betonung der Gemeinschaftsräume: Wohnküche / gemeinsamer Wohn- und Essbereich, idealerweise Terrasse, Garten oder Balkon.
- Gemeinschaftsleben mit dem Herd/Kochstelle als zentralem Bezugspunkt (vgl. französische Cantous) innerhalb der geräumigen Wohnküche.
- Der Tageablauf ist geprägt von den hauswirtschaftlichen Aktivitäten.
- Eine aktive Beteiligung an den hauswirtschaftlichen Aktivitäten ist möglich.
- Es gibt tagsüber eine feste Bezugsperson in Form einer Präsenzkraft.
- Eine vergleichsweise hohe Personalpräsenz wird durch die Verlagerung
dezentraler Strukturen (z. B. Großküche) in die einzelnen HGs erreicht.[61]
3.3 Wohn- und Hausgemeinschaften - ambulant und stationär
Um das HG-Konzept korrekt verorten zu können, erscheint eine Abgrenzung zu eng verwandten Ansätzen sinnvoll, die auf die gleichen ideellen Grundlagen zurückzuführen sind, sich jedoch in Fragen der rechtlichen Verortung und der Finanzierung von den stationären HGs unterscheiden:
Zunächst ist zu unterscheiden zwischen den stationären Hausgemeinschaften (HGs) und den ambulanten Wohngemeinschaften:
„Terminologisch hat sich für Wohngruppen mit ambulanter Anbindung der Begriff: „Wohngemeinschaften“, für solche mit stationärer Anbindung der Begriff „Hausgemeinschaften herausgebildet.“[62]
[...]
[1] Siehe dazu den Hinweis auf S. 4
[2] Arend 2005. S. 9
[3] Kaiser 2012. S. 25
[4] Vgl. ebd.
[5] Vgl. Arend 2005. S. 9 / Vgl. Kleiner 2005. S. 9 / Vgl. Kämmer 2000. S. 12 / Vgl. Blonski 2007.
S. 74 / Vgl. Winter et al. 2000. S. 8
[6] Kaiser 2012. S. 27
[7] Ebd.
[8] Vgl. Kleiner 2005. S. 9 / Vgl. Kämmer 2000. S. 12 / Vgl. Kaiser 2012. S. 27-28 / Vgl. Arend 2005. S. 9 /
Vgl. Blonski 2007. S. 74 / Vgl. Winter et al. 2000. S. 8
[9] Vgl. Arend 2005. S. 11 / Vgl. Kleiner 2005. S. 9 / Vgl. Kaiser 2012. S. 28-29 / Vgl. Blonski 2007. S. 74-75 / Vgl. Winter et al. 2000. S. 8
[10] Kämmer 2000. S. 12
[11] Vgl. Kleiner 2005. S. 10
[12] Gennrich et al. 2004. S. 9
[13] Vgl. Winter et al. 2000. S.9 / Vgl. Kaiser 2012. S. 30 / Vgl. Arend 2005. S. 16-17
[14] Vgl. Kaiser 2012. S. 3 (Vorwort von Dr. Peter Michell-Auli, Geschäftsführer KDA)
[15] Vgl. Michell-Auli et al. (Zeitschrift ProAlter, Nov./Dez. 2010), S. 30-35
[16] Vgl. ebd., S. 32
[17] Vgl. Kaiser 2012. S. 22
[18] Vgl. Kaiser 2012. S. 32-33
[19] Vgl. Baden-Württemberg, Ministerium für Arbeit und Soziales 2006. S. 3 & 7 /
Vgl. Winter et al. 2000. S. 9-10 / Vgl. Arend 2005. S. 30
[20] Blonski 2007. S. 76
[21] Vgl. Planer 2010. S. 20-21
[22] Kaiser 2012. S. 10
[23] Ebd. S. 30
[24] Ebd. S. 40
[25] Vgl. Gennrich et al. 2004. S. 15-21
[26] Palm und Bogert 2007. S. 1
[27] Vgl. Planer 2010. S. 17
[28] Kaiser 2012. S. 30
[29] Vgl. ebd. S. 40
[30] Vgl. Gennrich et al. 2004. S. 17 & 19 / Vgl. Winter et al. 2000. S. 21-22
[31] Winter et al. 2000. S. 21
[32] Vgl. Kämmer 2000. S. 14-17
[33] Vgl. Palm und Bogert 2007. S. 22-23
[34] Gennrich et al. 2004. S. 65
[35] Vierter Bericht zur Lage der älteren Generation vom 18.4.2002 (Dt. Bundestag). Hier:
Planer 2010. S. 21-22
[36] Vgl. Gennrich et al. 2004. S. 5 und Winter et al. 2000. S. 7
[37] Gennrich et al. 2004. Anlage 1 (Stellungnahme), S. 79-82
[38] AK Hessischer Hausgemeinschaften, Oktober 2008 (nicht veröffentlicht), Anlage 4, S. 1-4
[39] Ebd., Hauptteil, S. 1
[40] Vgl. hierzu auch Kaiser 2012. S. 29
[41] Ebd. S. 31
[42] Vgl. ebd. S. 68
[43] Winter et al. 2000. S. 12
[44] Vgl. Müller und Seidl 2003. S. 59
[45] Ebd.
[46] Palm und Bogert 2007. S. 1
[47] Vgl. Kaiser 2012. S. 25-26
[48] Ebd., S. 31
[49] Vgl. Gennrich et al. 2004. S. 5 / Vgl. Müller und Seidl 2003. S. 24-25 / Vgl. Kleiner 2005. S. 10-11 / Vgl. Arend 2005. S. 18
[50] Gennrich et al. 2004. S. 5
[51] Baden-Württemberg, Ministerium für Arbeit und Soziales 2006. S. 18-19
[52] Vgl. ebd. S. 19 / Vgl. Müller und Seidl 2003. S. 25
[53] Vgl. Müller und Seidl 2003. S. 24-25 / Vgl. Kleiner 2005. S. 10-11 / Vgl. Klie S. 130-132 / Vgl. Baden-Württemberg, Ministerium für Arbeit und Soziales 2006. S. 18-19
[54] Winter et al. 2000. S. 21
[55] Winter et al. 2000. S. 20
[56] Vgl. Kaiser 2012. S. 30
[57] Ebd. S. 84
[58] Vgl. ebd.
[59] Vgl. Müller und Seidl 2003. S. 30-31
[60] Ebd., S. 59
[61] Vgl. Kleiner 2005. S. 15-16
[62] Müller und Seidl 2003. S. 29
-
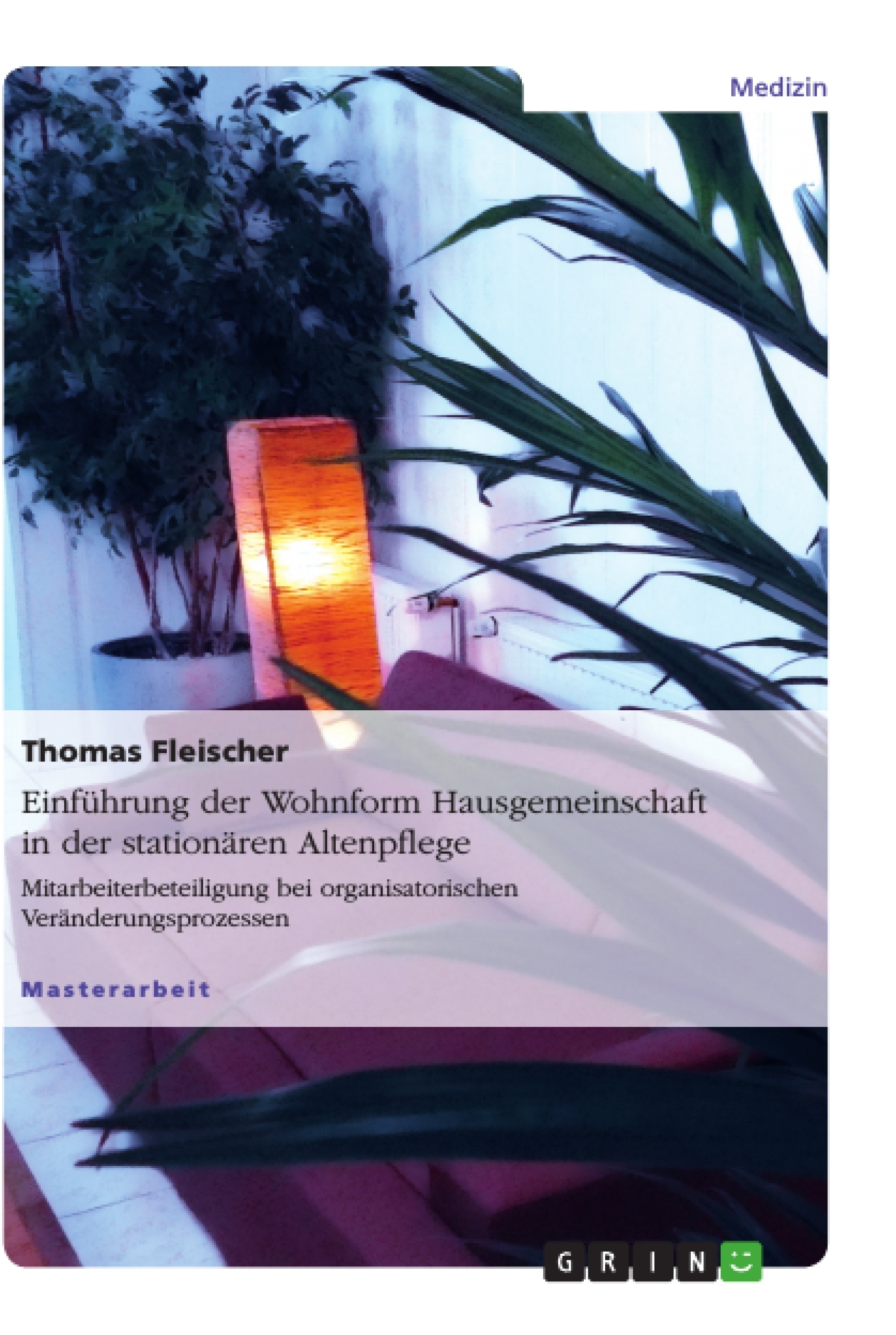
-

-

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen.