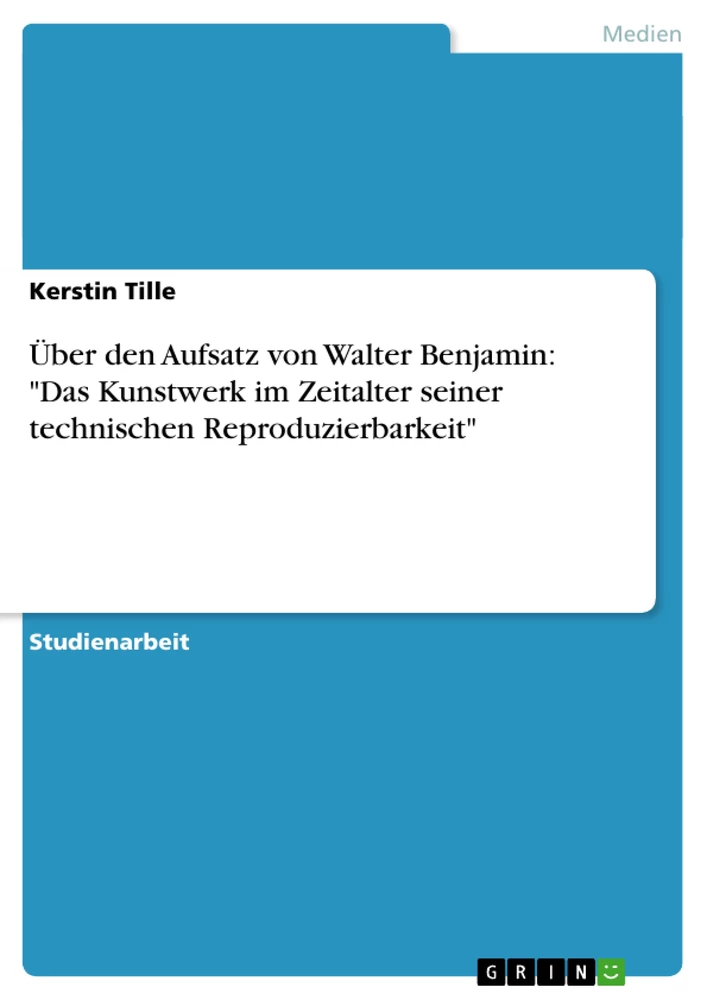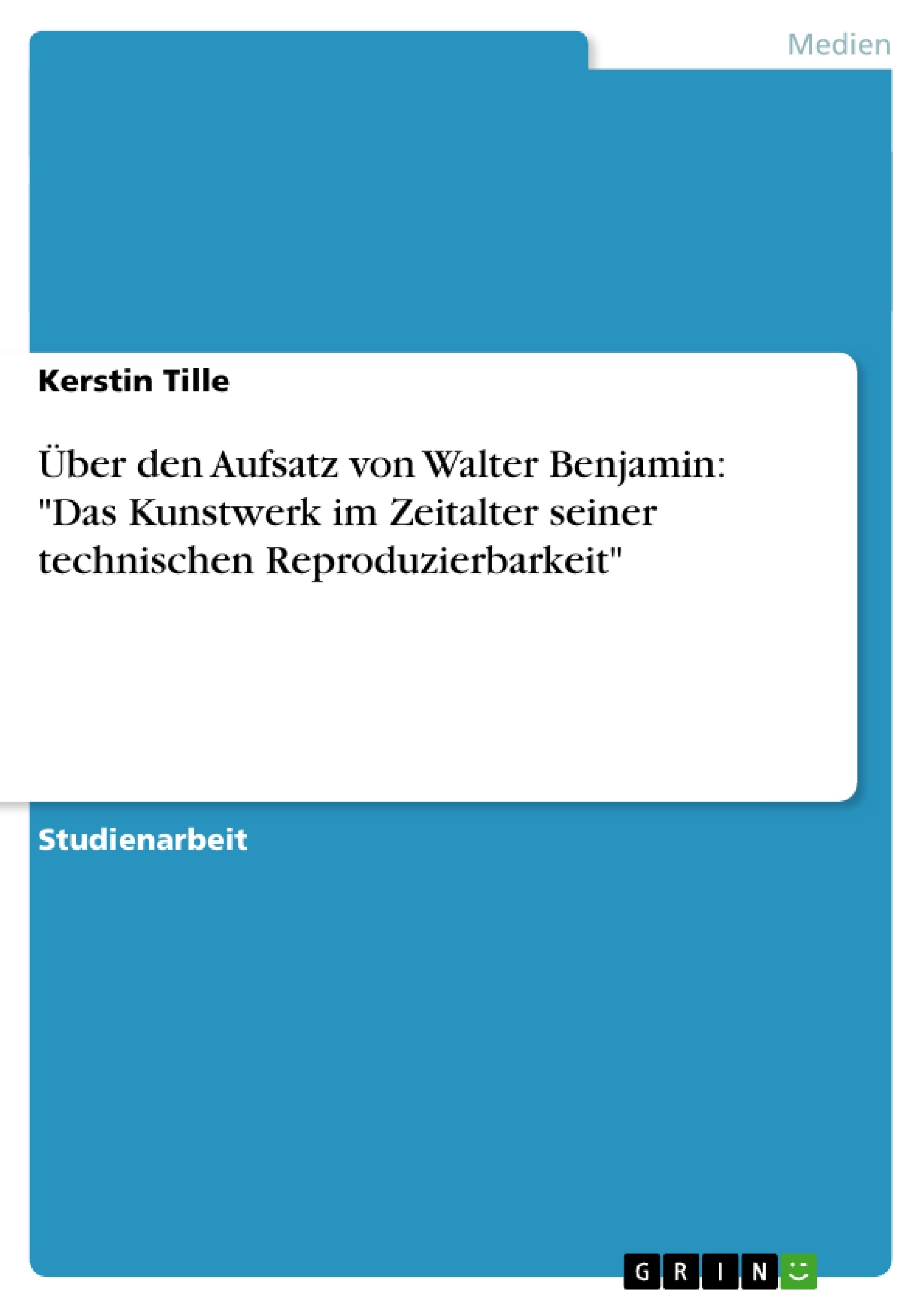Walter Benjamin wird am 15. Juli 1892 in Berlin als Sohn eines jüdischen Kaufmanns geboren. Der aus dem bürgerlichen Milieu stammende Benjamin studiert in Freiburg, München, Berlin und Bern Philosophie, deutsche Literatur und Psychologie. Nach seiner Promotion lebt er als freier Schriftsteller und Übersetzer in Berlin bis er 1933 nach Paris emigriert und dort Mitglied des Instituts für Sozialforschung wird. Als er von Organen der Franco-Regierung im spanischen Grenzort Port Bou gezwungen wird, in den kollaborationistischen Teil Frankreichs zurückzukehren, nimmt Benjamin sich am 27. September 1940 das Leben. Der studierte Philosoph und Literaturkritiker Benjamin ist aber auch Soziologe und Zeitkritiker. Er schreibt Arbeiten in allen genannten Bereichen, die sein weitgefächertes Wissen und Interesse zeigen. Dabei schaut er über die einzelnen Fachgebiete hinaus. Beeinflußt wird er von der Frankfurter Schule, einem Kreis von Sozial- und Kulturwissenschaftlern, die eine kritische Gesellschaftsanalyse betreiben. Dort lernt er auch Adorno kennen, der sich nach Benjamins Tod für die Anerkennung seiner Theorien einsetzt und 1955 den Suhrkamp Verlag als Verleger der Werke des Theoretikers gewinnt.
Zu seinem Hauptwerk zählt auch der 1936 erscheinende Essay „Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“. Der Aufsatz stellt bis heute einen bedeutenden Beitrag zur Kunstphilosophie dieser Zeit dar. Einer Zeit, in der die Weimarer Republik beendet ist, die Faschisten die Macht an sich gerissen haben und nun mit allen Mitteln versuchen, diese in ihren Händen zu behalten. Die genannte Arbeit des Marxisten Benjamin ist geprägt von diesen politischen Zuständen und wendet sich gegen den Nationalsozialismus.
Sein Hauptanliegen ist jedoch: „bestimmte Kunstformen, insbesondere den Film, aus dem Funktionswechsel zu verstehen, dem die Kunst insgesamt im Zuge der gesellschaftlichen Entwicklung unterworfen ist.“1
[...]
1 Unseld, Siegfried (Hrsg.): Zur Aktualität Walter Benjamins, S.54
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Kurze geschichtliche und biographische Einordnung Walter Benjamins und seines Werks
- Walter Benjamin
- Hauptteil: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit
- Entstehungsgeschichte der technischen Reproduzierbarkeit
- Aura des Kunstwerks
- Ausstellungswert verdrängt Kultwert
- Veränderungen in der Rezeptionsweise
- Funktionswechsel der Kunst
- Schluβ
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text bietet eine umfassende Analyse des Essays „Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“ von Walter Benjamin. Der Schwerpunkt liegt auf der Erforschung des Funktionswandels von Kunst im Kontext der technischen Reproduktion und der damit verbundenen Veränderungen in der Rezeptionsweise. Die Arbeit beleuchtet auch die Entstehung und Entwicklung der technischen Reproduzierbarkeit in ihrer historischen Dimension, beginnend mit den frühen Verfahren der Griechen bis hin zur Erfindung der Fotografie.
- Entwicklung und Auswirkungen der technischen Reproduzierbarkeit
- Verlust der Aura des Kunstwerks
- Wandel von Kultwert zu Ausstellungswert
- Funktionswechsel der Kunst in der modernen Gesellschaft
- Rezeption und Bedeutung des Films im Kontext der technischen Reproduzierbarkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Kurze geschichtliche und biographische Einordnung Walter Benjamins
Diese Einleitung stellt Walter Benjamin als Philosophen, Literaturkritiker, Soziologen und Zeitkritiker vor. Sie skizziert seine Lebensgeschichte, seine akademische Laufbahn und die wichtigsten Einflüsse auf sein Werk. Besonderes Augenmerk liegt auf Benjamins politischer Haltung, seiner Kritik am Nationalsozialismus und seiner Auseinandersetzung mit der Frankfurter Schule.
Hauptteil: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit
Entstehungsgeschichte der technischen Reproduzierbarkeit
In diesem Abschnitt wird die Entwicklung der technischen Reproduzierbarkeit von ihren Anfängen bei den Griechen bis zur Erfindung der Fotografie nachgezeichnet. Benjamin betrachtet verschiedene Verfahren wie Prägung, Guß, Holzschnitt, Radierung und Lithographie und ihre Bedeutung für die Massenproduktion von Kunstwerken.
Aura des Kunstwerks
Dieser Abschnitt analysiert den Begriff der „Aura“ im Kontext der technischen Reproduzierbarkeit. Die Aura des Kunstwerks, die mit seiner Einzigartigkeit und Authentizität verbunden ist, wird durch die Reproduktion zunehmend geschwächt. Benjamin argumentiert, dass die technische Reproduktion zu einer Entzauberung des Kunstwerks führt.
Ausstellungswert verdrängt Kultwert
In diesem Abschnitt wird die Veränderung des Kunstwerts von einem Kultwert zu einem Ausstellungswert untersucht. Der Kultwert bezieht sich auf die Einzigartigkeit und die spirituelle Bedeutung eines Kunstwerks, während der Ausstellungswert auf seine Zugänglichkeit und Reproduzierbarkeit durch die Massenmedien hinweist.
Veränderungen in der Rezeptionsweise
Dieser Abschnitt behandelt die Auswirkungen der technischen Reproduzierbarkeit auf die Art und Weise, wie Kunst rezipiert wird. Die Reproduktion ermöglicht eine größere Verbreitung und Zugänglichkeit von Kunstwerken, was zu einer Veränderung des Rezeptionsverhaltens führt.
Funktionswechsel der Kunst
Dieser Abschnitt widmet sich dem Funktionswechsel der Kunst im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit. Benjamin untersucht, wie die Kunst ihre traditionelle Rolle verliert und neue Funktionen im Kontext der Massenmedien übernimmt. Der Film spielt dabei eine zentrale Rolle.
Schlüsselwörter
Walter Benjamin, technische Reproduzierbarkeit, Kunstwerk, Aura, Kultwert, Ausstellungswert, Rezeption, Funktionswandel, Film, Massenmedien, Gesellschaft, Geschichte, Moderne, Kritik, Nationalsozialismus, Frankfurter Schule, Marxismus.
- Arbeit zitieren
- Kerstin Tille (Autor:in), 1998, Über den Aufsatz von Walter Benjamin: "Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/23450