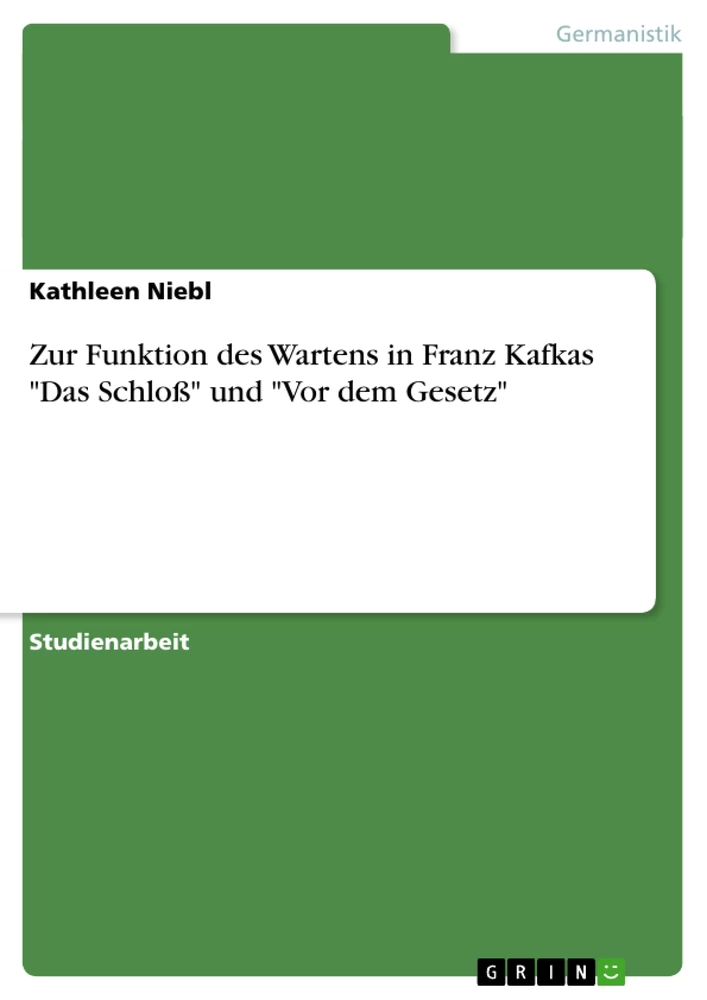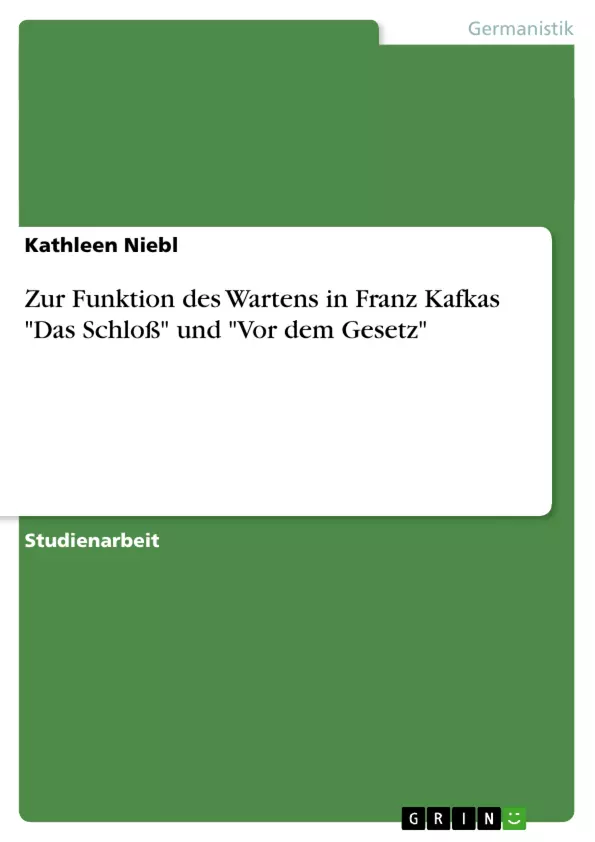Obwohl Zeit immer schon zu den herausragenden Interessenfeldern der Literaturwissenschaft und Philosophie gehörte, gewinnen Zeitbeobachtung und Zeitreflexion in den wissenschaftlichen Diskursen des 20. Jahrhunderts eine besondere B edeutung. Im Zuge naturwissenschaftlicher, vor allem physikalischer Entdeckungen, insbesondere die der Relativität der Zeit durch Albert Einstein, kommt es zur endgültigen Auflösung der traditionellen Vorstellung von Zeit als einer universalen, homogenen und gleichsam objektiven Größe. Bedingt durch die zunehmende Industrialisierung und die fortschreitende Ausdifferenzierung der modernen Gesellschaft, lässt sich auch auf gesamtgesellschaftlicher Ebene eine erhöhte Aufmerksamkeit und Sensibilisierung gegenüber Zeitphänomenen beobachten. So ist es das erklärte Ziel moderner Philosophen wie Henri Bergson oder Paul Valéry die „Brüchigkeit einer ehemals angenommenen homogenen Zeiterfahrung offenzulegen, die in ontologischen, religiösen oder transzendentalen Denksystemen angesiedelt und durch diese verbürgt war.“ Während das Problem der Zeit in der Forschung immer wieder in Angriff genommen wird, beschränken sich die Untersuchungen zum Warten, der wohl intensivsten Zeiterfahrung, auf eine überschaubare Anzahl an Veröffentlichungen. Dieses Defizit ist durchaus erstaunlich, beschäftigen sich doch eine Vielzahl an Autoren der Moderne mit diesem Phänomen. So schreibt etwa Friedrich Nietzsche in „Jenseits von Gut und Böse“, dass „in allen Winkeln der Welt [...] Wartende [sitzen], die es kaum wissen, in wiefern sie warten, noch weniger aber, dass sie umsonst warten.“ „Glücksfä lle“, so meint er, seien dazu nötig, dass „ein höherer Mensch [...] noch zur rechten Zeit zum Handeln kommt...“.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Warten im Schloß-Fragment
- Warten und Macht
- Das Warten auf Klamm
- Das Warten der Familie des Barnabas
- Warten und Warten lassen
- Die Leidenschaft des Wartens
- Das Warten auf Wahrheit
- Das Warten "[v]or dem Gesetz"
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Motiv des Wartens in Franz Kafkas Werk, insbesondere in den Texten "Das Schloß" und "Vor dem Gesetz". Die Analyse zielt darauf ab, die Funktion des Wartens im Kontext von Macht und Wahrheit in Kafkas Erzählungen zu untersuchen. Dabei wird auf die spezifischen Bedingungen und Auswirkungen des Wartens für die einzelnen Figuren eingegangen.
- Die Rolle des Wartens im Zusammenhang mit Machtstrukturen und Autoritäten in Kafkas Werken
- Die Funktion des Wartens für die einzelnen Figuren und die Auswirkungen auf ihr Verhalten und ihre Beziehungen zueinander
- Die Ambivalenz des Wartens als Ausdruck von Hoffnung und Ohnmacht
- Die Suche nach Wahrheit und Erkenntnis im Kontext des Wartens
- Die Bedeutung von Kommunikation und Schriftlichkeit für die Darstellung des Wartens in Kafkas Werken
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema des Wartens ein und beleuchtet die Relevanz dieser Zeiterfahrung in der Literaturwissenschaft und Philosophie des 20. Jahrhunderts. Sie skizziert die Entwicklung der Zeitauffassung im Laufe des 20. Jahrhunderts und verweist auf die Bedeutung des Wartens als eines prägnanten Zeitphänomens. Darüber hinaus wird auf die spezifischen Ausführungen der Arbeit zum Motiv des Wartens in Kafkas Werk eingegangen.
Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Warten im Romanfragment "Das Schloß". Hierbei wird untersucht, wie Machtverhältnisse im Schloß durch das Warten der Figuren konstituiert und geprägt werden. Es werden verschiedene Formen des Wartens analysiert, die von der passiven Unterwerfung bis hin zur leidenschaftlichen Hingabe reichen. Der Fokus liegt auf den Figuren Klamm, Barnabas und der Dorfgemeinschaft.
Das dritte Kapitel behandelt das Warten in der Erzählung "Vor dem Gesetz". Hier wird die Geschichte des Mannes vom Lande analysiert, der sein ganzes Leben vor dem Eingang zum Gesetz verbringt. Das Warten wird in dieser Erzählung als Ausdruck von Hoffnungen und Enttäuschungen, aber auch von Ohnmacht und Resignation gedeutet.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe, die im Zentrum dieser Arbeit stehen, sind Warten, Macht, Wahrheit, Autorität, Kommunikation und Schriftlichkeit. Diese Begriffe werden im Zusammenhang mit Kafkas Romanfragment "Das Schloß" und der Erzählung "Vor dem Gesetz" untersucht und analysiert. Darüber hinaus werden wichtige theoretische Konzepte aus der Philosophie und Literaturwissenschaft des 20. Jahrhunderts, wie z.B. die Zeitwahrnehmung und -reflexion, in die Untersuchung einbezogen.
- Quote paper
- Kathleen Niebl (Author), 2003, Zur Funktion des Wartens in Franz Kafkas "Das Schloß" und "Vor dem Gesetz", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/23543