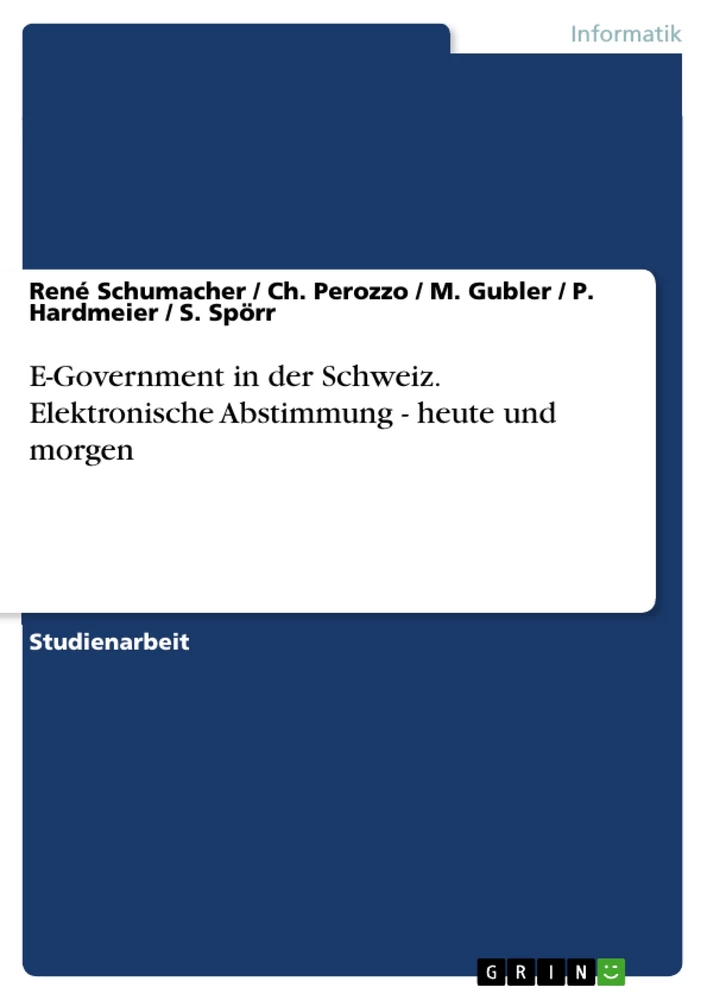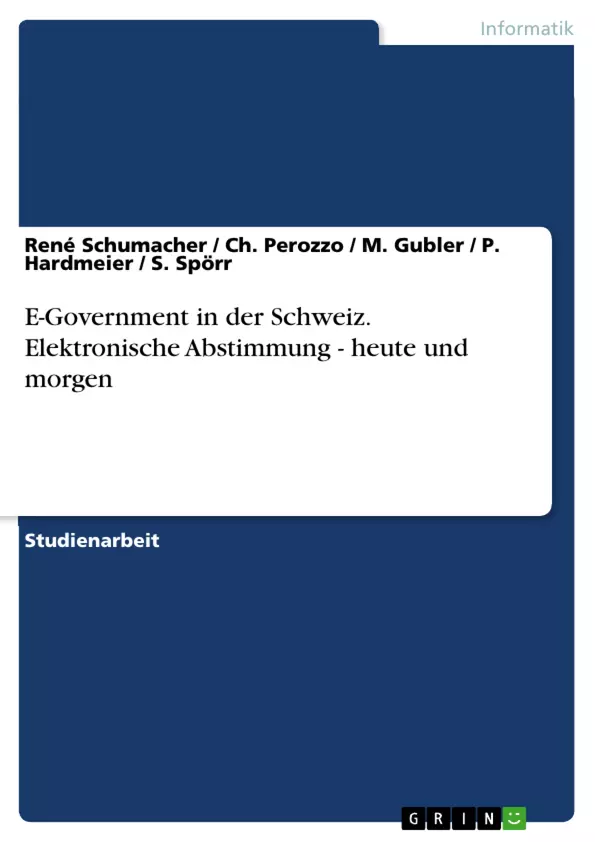Einleitung
Electronic Government ist in den letzten Jahren immer mehr zum Schlagwort geworden. Zusammen mit all den anderen „E-Begriffen“ wie E-Business oder E-Banking hat der Ausdruck E-Government Eingang in den Wortschatz vieler Politiker, Medienleute, Informatiker oder interessierter Bürger gefunden.
Was aber wird genau unter E-Government verstanden? Genügt das Bereitstellen einer Homepage mit den Öffnungszeiten der lokalen Verwaltung bereits, um von E-Government zu sprechen? Ist die per E-Mail zwischen Bürger und Gemeinde kommunizierte Anfrage über einen Aufschub beim Einreichen der Steuererklärung Ausdruck von E-Government? Oder rechtfertigt erst eine hochkomplexe
Technologie, welche elektronische Abstimmungen ermöglicht, die Verwendung des Begriffes Electronic Government?
In einem ersten Kapitel soll diesen Fragen nachgegangen werden. Dabei wird aufgezeigt, welch breiten Bedeutungsinhalt der Begriff E-Government aufweist. Danach wird ein Teilaspekt des Electronic Government herausgegriffen: Bezogen auf die Schweiz wird E-Voting, das elektronische Abstimmen, thematisiert. Mit einer Diskussion
von E-Voting können anhand eines konkreten Beispiels alle wichtigen Aspekte des E-Government gestreift werden. Eine umfassende Behandlung sämtlicher Teilgebiete von Electronic Government würde den Rahmen dieser Arbeit bei weitem sprengen.
In einem nächsten Kapitel nach der Definition von E-Government wird der aktuelle Stand in Sachen elektronischer Abstimmung in der Schweiz aufgezeigt. Wo steht man heute, welche Versuche laufen, welche Erfahrungen wurden bereits gesammelt?
Danach soll ein weiteres Kapitel über Chancen und Risiken elektronischer Abstimmungen für unterschiedliche Zielgruppen Auskunft geben. Die Vor- und Nachteile eines EVoting
werden dabei aus diversen Blickwinkeln beleuchtet, bevor in einem nächsten Kapitel konkreter und vertiefter auf die technischen Aspekte von elektronischen Abstimmungsverfahren eingegangen wird. Unter anderem werden die heute einsetzbaren Verfahren sowie die noch immer bestehenden Sicherheitsprobleme in diesem Bereich erörtert. Ein letztes Kapitel liefert schlussendlich einen möglichen Ausblick bezüglich EGovernment und E-Voting in der Schweiz.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- Definitionen E-Government und E-Voting ...
- Definition E-Government.............
- Verschiedene Interpretationen des Begriffes E-Government.
- Definition der Hochschule Speyer
- Definition von Gisler und Spahni.
- Konsolidierung
- Definition E-Voting
- 2 E-Voting in der Schweiz.
- Strategie des Bundes....
- Projekt E-Voting
- Aspekte der digitalen Signatur..
- E-Voting in Kantonen und Gemeinden.
- St. Galler Pilotprojekt.
- Genfer Pilotprojekt..
- Neuenburger Pilotprojekt
- Zürcher Pilotprojekt..
- 3 Chancen und Risiken des E-Voting.
- Chancen.....
- Stimmbeteiligung - Wählerschichten
- Software ......
- Auswertung
- Informationsverteilung.
- Risiken.......
- Akzeptanz und Sicherheit
- Beeinflussung des Wählerverhaltens
- Föderalismus.......
- Meinungsfindung.
- Digital divide..
- Vor- und Nachteile für Bürger und Verwaltung
- Bürger...
- Verwaltung
- Fazit...
- 4 E-Voting Technologien
- Anforderungen an ein E-Voting System........
- Erwartungen der Stimmbürger ..
- Bedrohungsformen..........\nIdentifikation, Authentifizierung.
- Identifikation
- Verfahren der Authentifizierung.
- Datenschutz….........
- Politische und rechtliche Anforderungen.
- Technische Anforderungen.....
- Verfügbarkeit...........
- Mögliche Architektur......
- E-Voting-System-Architektur
- Legende zu Architektur.
- Umgang mit dem Risiko.......
- Technologische Entwicklung...\n
- 5 Ausblick...........
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt zwei Ziele: Zum einen soll sie aufzeigen, was sich hinter dem Begriff des Electronic Government verbirgt. Zum anderen soll am konkreten Beispiel der elektronischen Abstimmung in der Schweiz ein aktueller und umfassender Einblick in die Vielseitigkeit und Komplexität der Thematik vermittelt werden.
- Definition und verschiedene Interpretationen von E-Government
- E-Voting in der Schweiz: Strategie des Bundes, Pilotprojekte in Kantonen und Gemeinden
- Chancen und Risiken von E-Voting für Bürger, Verwaltung und das politische System
- Technische Aspekte von E-Voting: Anforderungen, Verfahren und Sicherheitsprobleme
- Ausblick auf die zukünftige Entwicklung von E-Government und E-Voting in der Schweiz
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit der Definition des Begriffs E-Government. Es werden verschiedene Interpretationen des Begriffes aus unterschiedlichen Kontexten vorgestellt und zwei Arbeiten zur Definition von Electronic Government detaillierter erläutert. Anschliessend wird eine mögliche Konsolidierung verschiedener Aspekte des E-Government aufgezeigt.
Im zweiten Kapitel wird der aktuelle Stand in Sachen elektronischer Abstimmung in der Schweiz aufgezeigt. Es werden die Strategie des Bundes und verschiedene Pilotprojekte in Kantonen und Gemeinden vorgestellt, die bereits Erfahrungen mit E-Voting gesammelt haben.
Das dritte Kapitel untersucht die Chancen und Risiken elektronischer Abstimmungen für unterschiedliche Zielgruppen. Die Vor- und Nachteile von E-Voting werden dabei aus diversen Blickwinkeln beleuchtet.
Schlüsselwörter
E-Government, E-Voting, elektronische Abstimmung, digitale Signatur, Sicherheit, Datenschutz, Akzeptanz, Föderalismus, Schweiz, Pilotprojekte, Chancen, Risiken, Technologie, Digital Divide, Bürgerbeteiligung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist E-Government?
E-Government bezeichnet die Nutzung elektronischer Medien zur Abwicklung von Behördengängen und zur Kommunikation zwischen Verwaltung und Bürgern.
Wie weit ist E-Voting in der Schweiz fortgeschritten?
Die Schweiz hat verschiedene Pilotprojekte in Kantonen wie Genf, Zürich und Neuenburg durchgeführt, um elektronische Abstimmungen sicher und benutzerfreundlich zu ermöglichen.
Welche Vorteile bietet E-Voting?
Es kann die Stimmbeteiligung erhöhen, die Auswertung beschleunigen und den Zugang für Auslandschweizer oder Menschen mit Behinderungen erleichtern.
Was sind die größten Risiken von elektronischen Abstimmungen?
Die Hauptrisiken liegen in der Datensicherheit (Hacking), dem Schutz des Stimmgeheimnisses und der Akzeptanz sowie dem Vertrauen der Bürger in die Technik.
Was bedeutet „Digital Divide“ im Kontext von E-Government?
Es bezeichnet die digitale Kluft zwischen Bevölkerungsschichten, die Zugang zu moderner Technik haben, und jenen, die aufgrund von Alter oder Bildung davon ausgeschlossen sind.
- Quote paper
- René Schumacher (Author), Ch. Perozzo (Author), M. Gubler (Author), P. Hardmeier (Author), S. Spörr (Author), 2002, E-Government in der Schweiz. Elektronische Abstimmung - heute und morgen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/2378