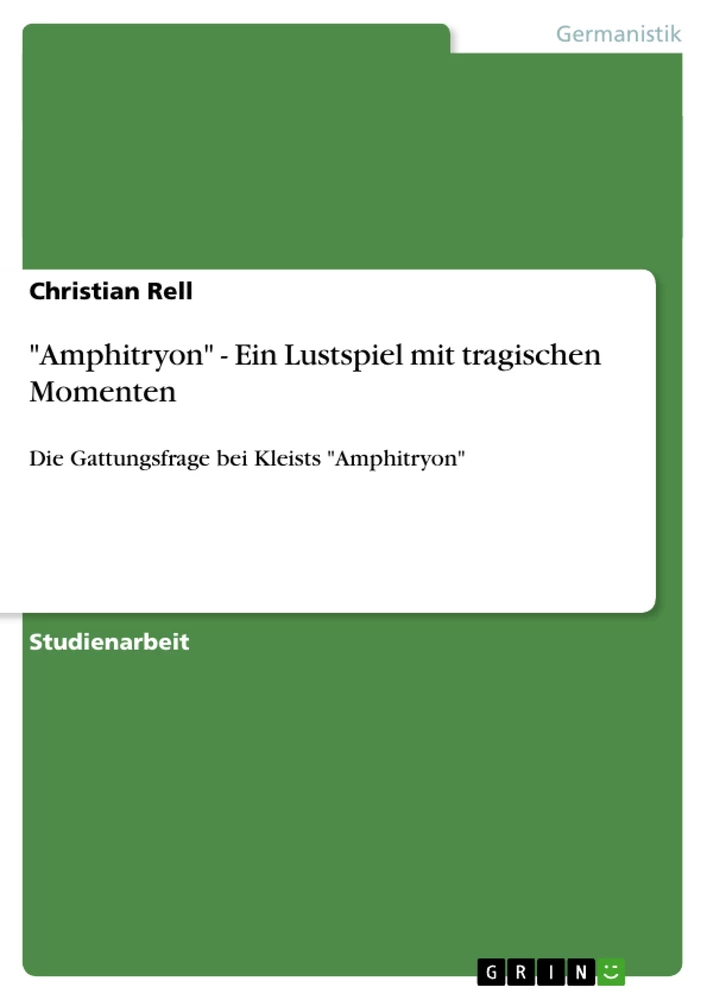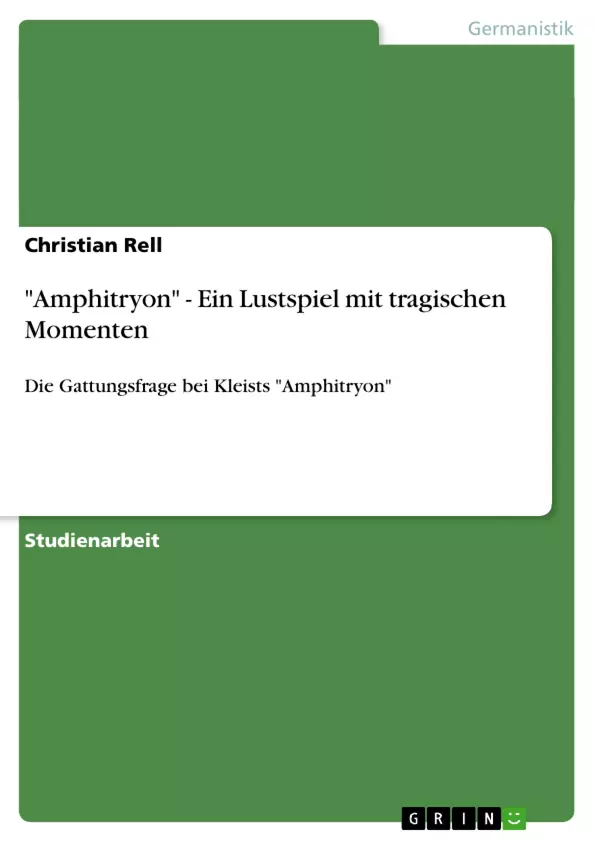Oftmals erachteten es Autoren für notwendig einem Stück einen neuen Namen zu geben, wenn sie bei ihrer Arbeit auf ein historisches Werk zurückgriffen. Vielleicht hielt Kleist bei seiner Wiederaufnahme des Stoffs den Namen für dermaßen sinnig und treffend, dass er ihn – wie vor ihm bereits Molière – beibehielt. Denn der Name „Amphitryon“ entspringt dem Griechischen und weist – bevor das Stück überhaupt beginnt - auf das handlungserzeugende Merkmal des Stückes hin. Es scheint im Stück irgendetwas „doppelt“ vertreten zu sein. Der Präfix „Amphi-“ bedeutet soviel wie „auf beiden Seiten“ oder auch „doppelt“. Gleichzeitig weist der Name auf die Amphe, eine Droge mit halluzinogener Wirkung, hin bei welcher man glaubt „doppelt zu sehen“.
Doch nicht alles was seine Vorgänger vorlegten, wurde von Kleist übernommen. Vielmehr unterzog er den Stoff einer Anpassung an den neuen, deutschen gesellschaftlichen Kontext. Viele der von Molière geschaffenen komischen Elemente waren für die Kleistsche Fassung überarbeitungsbedürftig.
In dieser Arbeit werden die besondere Kleistsche Komik - aber auch tragische Elemente - im Lustspiel Amphitryon dargestellt, und das Stück wird gattungstechnisch eingeordnet. Nach einer Betrachtung der Weltversöhnung, über den komischen Fehler, bis hin zur Ständeklausel kommt Christian Rell zum Schluss: Kleists Amphitryon ist ein Lustspiel mit tragischen Momenten.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung: Amphitryon – „der Doppelte“.
- 1.1 Das „Spiel im Spiel“
- 1.2 Übernahme und Anpassung des Stoffes
- 2 Merkmale der Komödie - ein Definitionsversuch
- 2.1 Merkmale nach Ralf Simon
- 2.2 Unschädlichkeitsklausel
- 2.3 Die Weltversöhnung
- 3 Komödientypologische Einordnung des Amphitryon
- 3.1 Von der Schwierigkeit der Typologisierung
- 3.2 Komödientypologie nach Ralf Simon
- 4 Komische und tragische Elemente in Kleists Amphitryon
- 4.1 Grundsätzliches
- 4.2 Tragische Elemente
- 4.3 Die Ständeklausel in Kleists Amphitryon
- 4.4 Komödienelemente
- 4.4.1 Prügel
- 4.4.2 Wortwitz
- 4.4.3 Komik in den Verwirrungen und der Suche nach der eigenen Identität
- 4.4.4 „Bei Jupiter!\" - Das Verweisen auf die Götter
- 4.4.5 Entblößung in der Öffentlichkeit
- 5 Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert Kleists Lustspiel „Amphitryon“ und untersucht die besondere Kleistsche Komik, sowie tragische Elemente. Ziel ist es, das Stück gattungstechnisch einzuordnen und die Frage zu beantworten, inwiefern „Amphitryon“ als Lustspiel mit tragischen Momenten betrachtet werden kann.
- Komödienmerkmale nach Ralf Simon im Kontext von Kleists „Amphitryon“
- Tragische Elemente in Kleists „Amphitryon“
- Die Ständeklausel in Kleists „Amphitryon“
- Gattungstechnische Einordnung von Kleists „Amphitryon“
- Untersuchung der komischen und tragischen Elemente im Stück
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit beleuchtet die besondere „Doppelheit“ im Stück „Amphitryon“ und führt den Begriff „Amphitryon“ auf seine griechischen Wurzeln zurück. Es wird zudem erläutert, wie Kleist den Stoff des Dramas an den deutschen gesellschaftlichen Kontext angepasst hat. Das zweite Kapitel widmet sich der Definition der Komödie, wobei insbesondere die Kriterien von Ralf Simon herangezogen werden. In diesem Kontext werden die „Unschädlichkeitsklausel“ sowie die „Weltversöhnung“ als wesentliche Merkmale der Komödie betrachtet.
Das dritte Kapitel befasst sich mit der komödientypologischen Einordnung des Amphitryon und beleuchtet die Schwierigkeiten der Typologisierung. Die Komödientypologie nach Ralf Simon wird im Detail vorgestellt. Das vierte Kapitel untersucht die komischen und tragischen Elemente in Kleists Amphitryon. Die Ständeklausel in Kleists „Amphitryon“ wird als tragische Komponente diskutiert. Im Folgenden werden unterschiedliche komische Elemente, wie Prügel, Wortwitz, Verwirrungen und Entblößung in der Öffentlichkeit, analysiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse von Kleists Lustspiel „Amphitryon“, insbesondere die gattungstechnische Einordnung des Stückes. Die Schlüsselwörter beinhalten daher „Amphitryon“, „Komödie“, „Lustspiel“, „tragische Elemente“, „Ständeklausel“, „Ralf Simon“, „Komödientypologie“ und „Gattungstheorie“.
Häufig gestellte Fragen
Warum heißt Kleists Stück „Amphitryon“?
Der Name stammt aus dem Griechischen; die Vorsilbe „Amphi-“ bedeutet „doppelt“ und weist auf das zentrale Motiv der Verwechslung und Identitätsverdopplung hin.
Ist „Amphitryon“ eine reine Komödie?
Obwohl es als Lustspiel bezeichnet wird, enthält es tiefgreifende tragische Elemente, insbesondere in der existentiellen Verzweiflung der Charaktere über ihre Identität.
Was besagt die Ständeklausel in diesem Stück?
Die Ständeklausel wird durch die parallele Handlung von Göttern/Adel und Dienern thematisiert, wobei Kleist die Grenzen zwischen Komik und Tragik verwischt.
Welche komischen Elemente nutzt Kleist?
Kleist verwendet klassischen Wortwitz, Situationskomik durch Verwechslung, Prügelszenen und die öffentliche Entblößung der Figuren.
Wie unterscheidet sich Kleists Fassung von Molières Vorlage?
Kleist passte den Stoff an den deutschen gesellschaftlichen Kontext an und vertiefte die psychologische und tragische Dimension der Identitätssuche.
- Arbeit zitieren
- Christian Rell (Autor:in), 2004, "Amphitryon" - Ein Lustspiel mit tragischen Momenten, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/24191