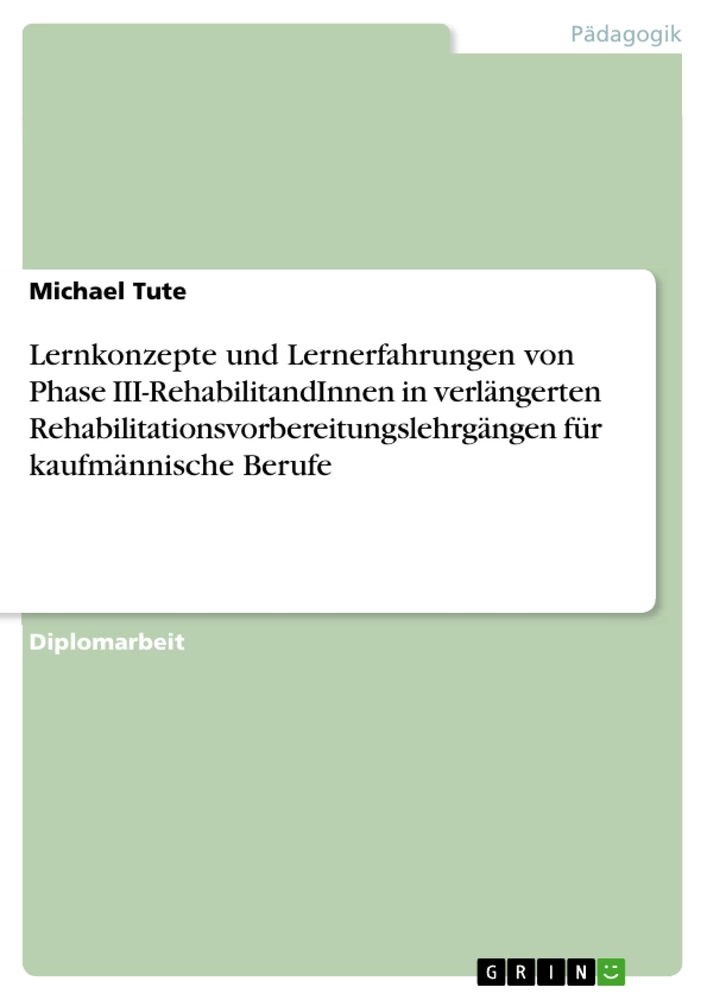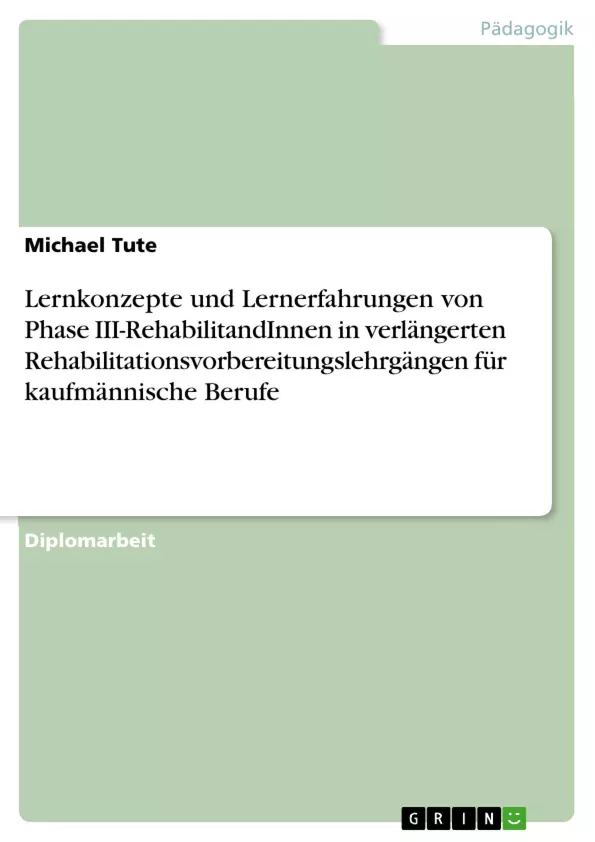Das Thema und die Fragestellung der vorliegenden Arbeit entwickelten sich während
der Ausübung meiner Tätigkeit als Lehrkraft für Menschen in
Rehabilitationsmaßnahmen im Berufsförderungswerk Bremen-Lesum.
Zunächst interessierte mich die Frage, was die RehabilitandInnen unter "Lernen"
überhaupt verstehen, welche Lernerfahrungen sie bisher gemacht haben und wie
diese heute noch wirken. Daraus folgte als weitere Frage, wie sie selber ihren
Lernprozess gestalten wollen.
Meine Annahme ist, daß das Wissen über das eigene Lernen den Lernprozess des
Lernenden günstig beeinflusst. Aus der Motivation heraus, diese Annahme zu
überprüfen, entsteht die vorliegende Arbeit und wird wie folgt umgesetzt.
Im empirischen Teil dieser Arbeit werden Menschen, die einen Vorbereitungskurs für
ihre Umschulung im Kontext einer Rehabilitationsmaßnahme nutzen, von ihren
Lernerfahrungen zweimal erzählen. Zum einen zu Beginn des Vorbereitungskurses
zu ihrer Umschulung und zum anderen am Ende, ungefähr acht Wochen später. Aus
ihren Erzählungen werden die DialogpartnerInnen mit mir ihr Wissen über ihre
Lernerfahrungen zusammenfassen, ordnen und strukturieren. Damit soll die Frage
dieser Arbeit, ob sich Subjektive Theorien des Lernens in der Schulungssituation
verändern, ein stückweit erhellt werden.
Zuvor jedoch, um für den empirischen Teil der Arbeit Blickwinkel erarbeitet und
nachvollziehbar gemacht zu haben, die als Werkzeuge für die konkrete Durchführung
der Empirie dienen können, konstituiere ich theoretisch die verschiedenen Aspekte
des Forschungsgegenstandes, die in Verbindung mit dem Thema oder der
Fragestellung stehen. Dazu bediene ich mich der kognitiven und
subjektwissenschaftlichen Betrachtungsweise, die ich ergänzend verbinde. Die Arbeit
ist in zwei Teile untergliedert. Im Teil I erfolgt die theoretische Konstituierung des
Forschungsgegenstandes. Im Teil II die Darstellung des Untersuchungsfeldes und -
personen, der Erhebungs- und Auswertungsmethoden sowie die Erhebung,
Auswertung und Interpretation des Textmaterials selbst.
Durch diese Arbeit erhoffe ich einen Erkenntnisgewinn, der Menschen mit
unterschiedlichsten Lernerfahrungen in Organisationen für Umschulungsmaßnahmen
zugute kommt und ihnen durch vielfältige Anknüpfpunkte und Verständnis Chancen
einräumt.
8
- Quote paper
- Michael Tute (Author), 1995, Lernkonzepte und Lernerfahrungen von Phase III-RehabilitandInnen in verlängerten Rehabilitationsvorbereitungslehrgängen für kaufmännische Berufe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/24741