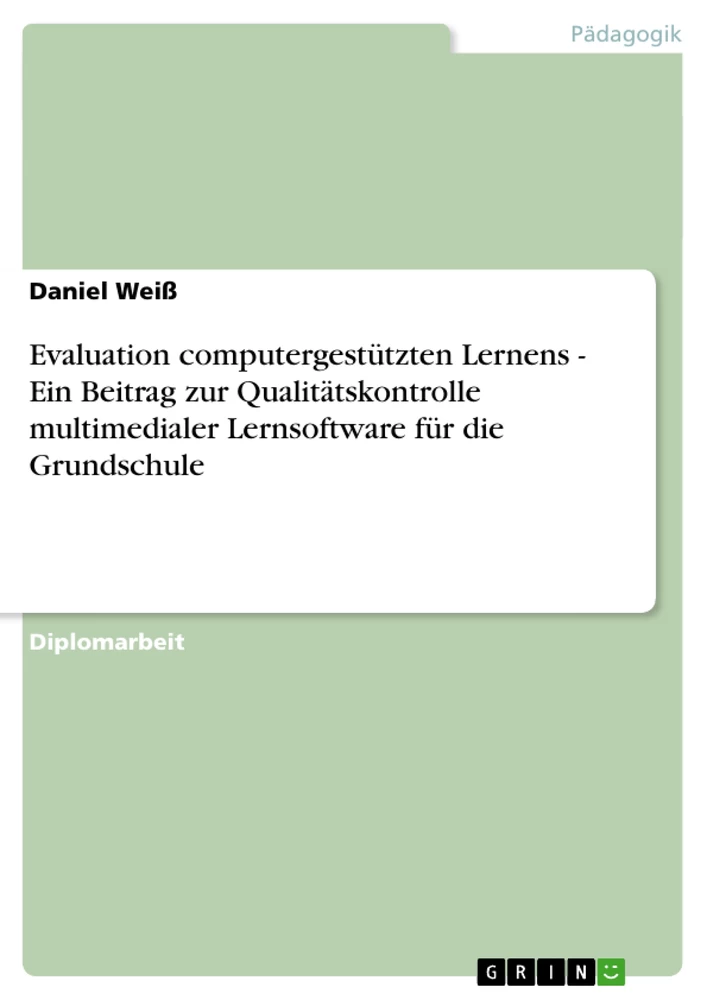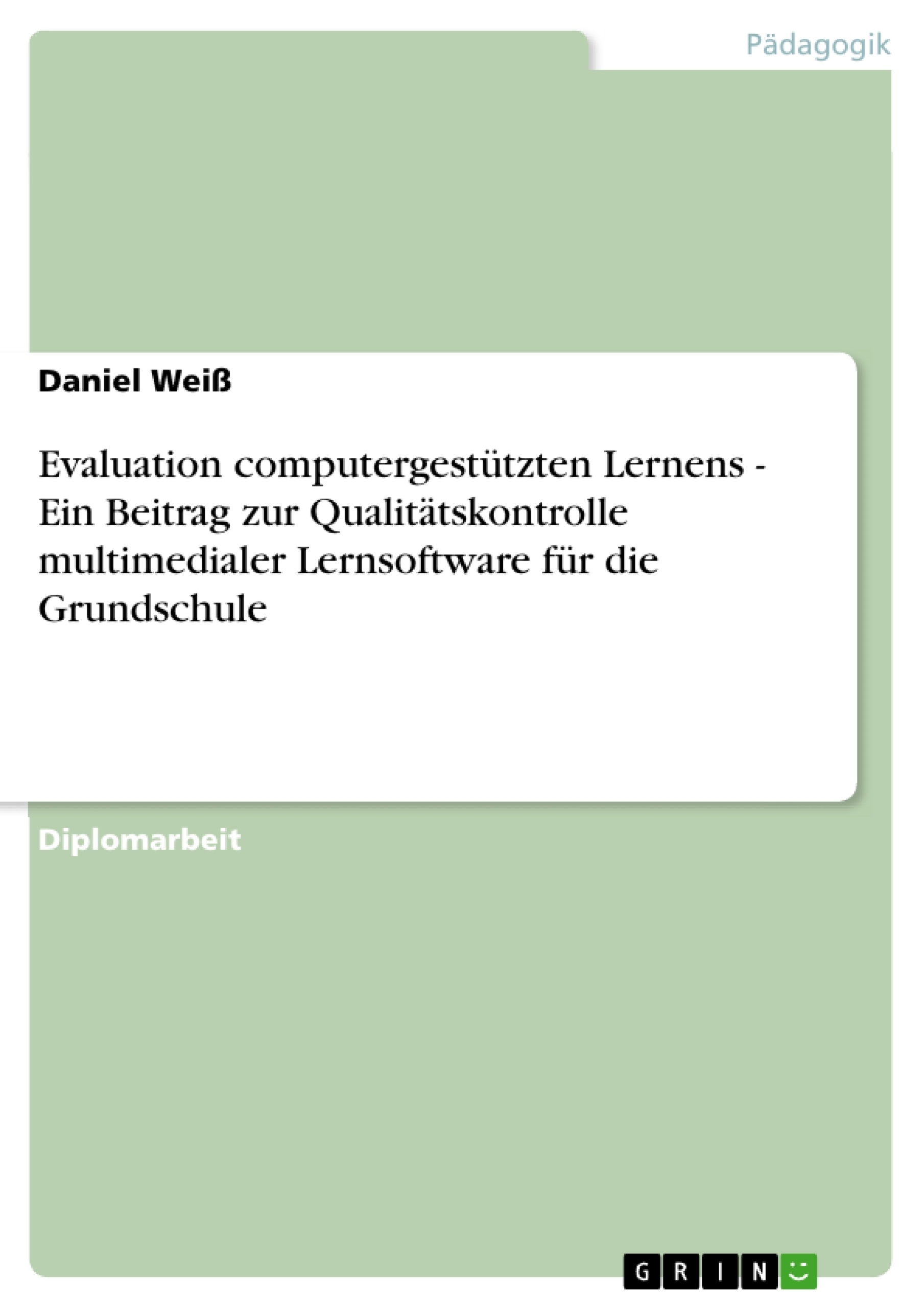Aufgrund des rasanten technischen Fortschritts in den letzten Jahren findet der Computer zunehmend Einsatz zu Lehr- und Lernzwecken in Schule, Hochschule und Weiterbildung. Ergänzend zu traditionellen Lehr- und Lernmedien erfolgt Unterrichtsgestaltung nun auch mit Hilfe multimedialer Lernsoftware. „Firmen [...] kommen verstärkt mit Lernsoftware auf den Markt, die den Anspruch erhebt, das schulische Wissen auf neue Wege verteilen zu können“ (Aufenanger, 1999, S. 73). Das hohe technische Potenzial heutiger Hardwaresysteme ermöglicht es, Informationen in unterschiedlichen Kodierungsarten (Sprache, Bilder etc.) zu präsentieren, um verschiedene Sinneskanäle (auditiv, visuell) gleichzeitig anzusprechen oder sogar mit dem Lerner zu interagieren. Bei vielen Lehr- und Lernarrangements werden die technischen Möglichkeiten viel zu wenig, aber vor allem zu wenig zielorientiert genutzt. Nicht jede Software mit der Etikettierung „Multimedia“ stellt gleichzeitig eine viel versprechende und angemessene Lernsoftware dar und eignet sich für den Einsatz im und ergänzend zum Unterricht. Unter der beinahe unendlichen Vielfalt an Lernsoftware auf dem heutigen Multimediamarkt stößt man nicht selten auf für den Unterricht unzureichend gestaltete Software. Dies wird häufig zum Problem, wenn es um die Auswahl angemessener Lernsoftware für Lehre und Unterricht geht.
Aber nicht nur das zahlreiche Angebot multimedialer Lernsoftware stellt eine Schwierigkeit dar, sondern auch die Frage nach dem Einsatz multimedialer Software im Unterricht. Ob der Computer Einzug in den Unterricht an Grundschulen erhält, ist auf jeden Fall mit einem deutlichen „Ja“ zu beantworten. Es geht mehr um das „Wie“ des Einsatzes des „neuen Mediums“. Der Wandel des Lehr- und Lernverständnisses weg vom lehrerzentrierten Unterricht zu einer offenen Unterrichtsform, bei der die Lernenden in den Mittelpunkt rücken, bringt neue Perspektiven mit sich. Wissen soll nicht mehr vom Lehrer „eingetrichtert“ werden. Vielmehr erarbeitet sich der Lernende in projektorientierter Unterrichtsgestaltung Wissensinhalte selbsttätig und eigenständig. In diesem Zusammenhang eignet sich besonders multimediale und hypermediale Lernsoftware. Sie beinhaltet Potenziale wie kein anderes Medium. Komplexe Sachverhalte können vereinfacht auf dem Bildschirm veranschaulicht werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Aufbau der Arbeit
- 1.2 Klärung zentraler Begriffe
- 1.2.1 Medienkompetenz
- 1.2.2 Multimedia
- 1.2.3 Hypertext und Hypermedia
- 1.2.4 Klassifizierung verschiedener Softwaretypen
- 1.3 Lerntheorien – Vom Behaviorismus zum Konstruktivismus
- 1.3.1 Behaviorismus
- 1.3.2 Grenzen behavioristisch gestalteter Lernsoftware
- 1.3.3 Kognitivismus
- 1.3.4 Grenzen kognitivistisch gestalteter Lernsoftware
- 1.3.5 Träges Wissen
- 1.3.6 Konstruktivismus und situiertes Lernen
- 1.3.7 Konstruktivistische Theorien situierten Lernens
- 1.3.8 Grenzen situierten Lernens
- 1.4 Grundschule und Computer
- 1.4.1 Rückblick
- 1.4.2 Computer in der Grundschule – Der didaktische Kontext
- 1.4.3 Einsatzmöglichkeiten des Computers im Unterricht
- 1.4.4 Perspektiven und Grenzen des Computereinsatzes in der Unterrichtsgestaltung
- 1.5 Evaluation
- 1.5.1 Begriffsbestimmung
- 1.5.2 Formen der Evaluation
- 2 Fragestellungen und Hypothesen
- 2.1 Fragestellungen
- 2.2 Hypothesen
- 2.2.1 Lernerfolg
- 2.2.2 Akzeptanz
- 2.2.3 Technische Vorkenntnisse
- 2.2.4 Motivation
- 2.2.5 Generelle Lernfähigkeit
- 3 Methode
- 3.1 Die Lernsoftware „Die Waldameise Lilli – Die aufregende Welt der Pilze“
- 3.1.1 Technische Voraussetzungen und Installation
- 3.1.2 Beschreibung des Aufbaus der Software
- 3.1.3 Kategorisierung der Software und Zuordnung zu einem didaktischen Konzept
- 3.2 Design der Studie und Erhebungsinstrumente
- 3.2.1 Interviewleitfaden
- 3.2.2 Leistungstest
- 3.2.3 Fragebogen
- 3.2.4 Beschreibung der Stichprobe
- 3.2.5 Auswertung der Daten
- 4 Ergebnisse
- 4.1 Aussagen der Lehrkräfte
- 4.2 Deskriptive Auswertung
- 4.3 Hypothesenprüfende Auswertung
- 5 Diskussion
- 5.1 Aussagen der Lehrkräfte
- 5.2 Diskussion der empirischen Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit evaluiert computergestütztes Lernen, speziell multimediale Lernsoftware für die Grundschule. Ziel ist die Qualitätskontrolle solcher Software und die Untersuchung ihres Einflusses auf Lernerfolg, Akzeptanz und Motivation. Die Arbeit untersucht den didaktischen Kontext des Computereinsatzes in der Grundschule.
- Qualitätssicherung multimedialer Lernsoftware
- Einfluss auf Lernerfolg und Akzeptanz
- Didaktische Konzepte und der Einsatz von Computern in der Grundschule
- Analyse verschiedener Lerntheorien im Kontext von computergestütztem Lernen
- Evaluation computergestützter Lernprozesse
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beschreibt den zunehmenden Einsatz von Computern und multimedialer Lernsoftware im Bildungsbereich und die damit verbundenen Herausforderungen. Es wird auf die Notwendigkeit einer Qualitätskontrolle hingewiesen, da nicht jede Software den didaktischen Anforderungen entspricht. Der Wandel des Lehr- und Lernverständnisses hin zu einer schülerzentrierten, projektorientierten Unterrichtsgestaltung wird betont, wobei multimediale Software ein großes Potential bietet, komplexe Sachverhalte zu veranschaulichen. Die Arbeit skizziert die Forschungsfrage und den Aufbau der Arbeit. Der Abschnitt klärt wichtige Begriffe wie Medienkompetenz, Multimedia, Hypertext, Hypermedia und verschiedene Software-Typen. Zudem werden relevante Lerntheorien (Behaviorismus, Kognitivismus, Konstruktivismus) und ihre Bedeutung für die Gestaltung von Lernsoftware diskutiert, sowie die spezifischen Herausforderungen des Computereinsatzes in der Grundschule beleuchtet.
2 Fragestellungen und Hypothesen: Dieses Kapitel formuliert die zentralen Forschungsfragen der Arbeit. Es wird untersucht, wie sich der Einsatz der Lernsoftware auf den Lernerfolg, die Akzeptanz bei Schülern und Lehrern, die technischen Vorkenntnisse der Schüler, deren Motivation und die generelle Lernfähigkeit auswirkt. Konkrete Hypothesen zu diesen Aspekten werden aufgestellt, die im weiteren Verlauf der Arbeit empirisch überprüft werden.
3 Methode: Dieses Kapitel beschreibt die verwendete Lernsoftware ("Die Waldameise Lilli"), die technischen Voraussetzungen und den Aufbau der Software. Es detailliert das Studiendesign, die eingesetzten Erhebungsinstrumente (Interviewleitfaden, Leistungstest, Fragebogen) und die Stichprobenbeschreibung. Die Methoden der Datenanalyse werden erläutert.
4 Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der durchgeführten Studie. Es beinhaltet sowohl die deskriptive Auswertung der Daten (z.B. Aussagen der Lehrkräfte, Vor- und Nachtest-Ergebnisse, Akzeptanz, Motivation) als auch die hypothesenprüfende Auswertung, welche die im Kapitel 2 aufgestellten Hypothesen überprüft.
5 Diskussion: Dieses Kapitel diskutiert die im Kapitel 4 präsentierten Ergebnisse im Detail. Die Ergebnisse werden im Kontext der relevanten Literatur und Lerntheorien interpretiert, und die Bedeutung der Ergebnisse für die Praxis wird erläutert. Die Stärken und Schwächen der Studie werden reflektiert und mögliche Limitationen werden diskutiert.
Schlüsselwörter
Computergestütztes Lernen, Multimediale Lernsoftware, Grundschule, Evaluation, Qualitätskontrolle, Lerntheorien (Behaviorismus, Kognitivismus, Konstruktivismus), Lernerfolg, Akzeptanz, Motivation, Didaktik, Medienkompetenz, Hypermedia.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Evaluation computergestützten Lernens in der Grundschule
Was ist das Thema der Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit evaluiert computergestütztes Lernen, speziell multimediale Lernsoftware für die Grundschule. Der Fokus liegt auf der Qualitätskontrolle solcher Software und der Untersuchung ihres Einflusses auf Lernerfolg, Akzeptanz und Motivation der Schüler. Die Arbeit analysiert auch den didaktischen Kontext des Computereinsatzes in der Grundschule.
Welche Lerntheorien werden behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Lerntheorien, darunter Behaviorismus, Kognitivismus und Konstruktivismus. Es wird untersucht, wie diese Theorien die Gestaltung von Lernsoftware beeinflussen und welche Grenzen behavioristisch und kognitivistisch gestaltete Lernsoftware aufweisen. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Konstruktivismus und situierten Lernen.
Welche Fragestellungen und Hypothesen werden untersucht?
Die zentrale Forschungsfrage untersucht den Einfluss der Lernsoftware auf Lernerfolg, Akzeptanz bei Schülern und Lehrern, technische Vorkenntnisse der Schüler, deren Motivation und generelle Lernfähigkeit. Konkrete Hypothesen zu diesen Aspekten werden aufgestellt und empirisch überprüft.
Welche Methode wurde verwendet?
Die Studie verwendet die Lernsoftware „Die Waldameise Lilli – Die aufregende Welt der Pilze“. Das Studiendesign beinhaltet Interviewleitfäden, Leistungstests und Fragebögen. Die Stichprobe wird detailliert beschrieben und die Methoden der Datenanalyse werden erläutert.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Arbeit präsentiert sowohl deskriptive Auswertungen (Aussagen der Lehrkräfte, Vor- und Nachtest-Ergebnisse, Akzeptanz, Motivation) als auch hypothesenprüfende Auswertungen, welche die im Kapitel 2 aufgestellten Hypothesen überprüfen.
Wie werden die Ergebnisse diskutiert?
Die Ergebnisse werden im Kontext der relevanten Literatur und Lerntheorien interpretiert. Die Bedeutung der Ergebnisse für die Praxis wird erläutert, Stärken und Schwächen der Studie werden reflektiert, und mögliche Limitationen werden diskutiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Computergestütztes Lernen, Multimediale Lernsoftware, Grundschule, Evaluation, Qualitätskontrolle, Lerntheorien (Behaviorismus, Kognitivismus, Konstruktivismus), Lernerfolg, Akzeptanz, Motivation, Didaktik, Medienkompetenz, Hypermedia.
Welche Software wird in der Studie verwendet?
Die verwendete Lernsoftware heißt "Die Waldameise Lilli – Die aufregende Welt der Pilze". Die Arbeit beschreibt die technischen Voraussetzungen, den Aufbau und die didaktische Kategorisierung dieser Software.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Fragestellungen und Hypothesen, Methode, Ergebnisse und Diskussion. Die Einleitung beinhaltet die Klärung zentraler Begriffe, einen Überblick über relevante Lerntheorien und den didaktischen Kontext des Computereinsatzes in der Grundschule. Die weiteren Kapitel beschreiben die Forschungsmethodik, die Ergebnisse und deren Interpretation.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Ziel der Arbeit ist die Qualitätskontrolle multimedialer Lernsoftware für die Grundschule und die Untersuchung ihres Einflusses auf Lernerfolg, Akzeptanz und Motivation. Ein weiterer Fokus liegt auf der Analyse des didaktischen Kontexts des Computereinsatzes in der Grundschule.
- Quote paper
- Daniel Weiß (Author), 2004, Evaluation computergestützten Lernens - Ein Beitrag zur Qualitätskontrolle multimedialer Lernsoftware für die Grundschule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/26022