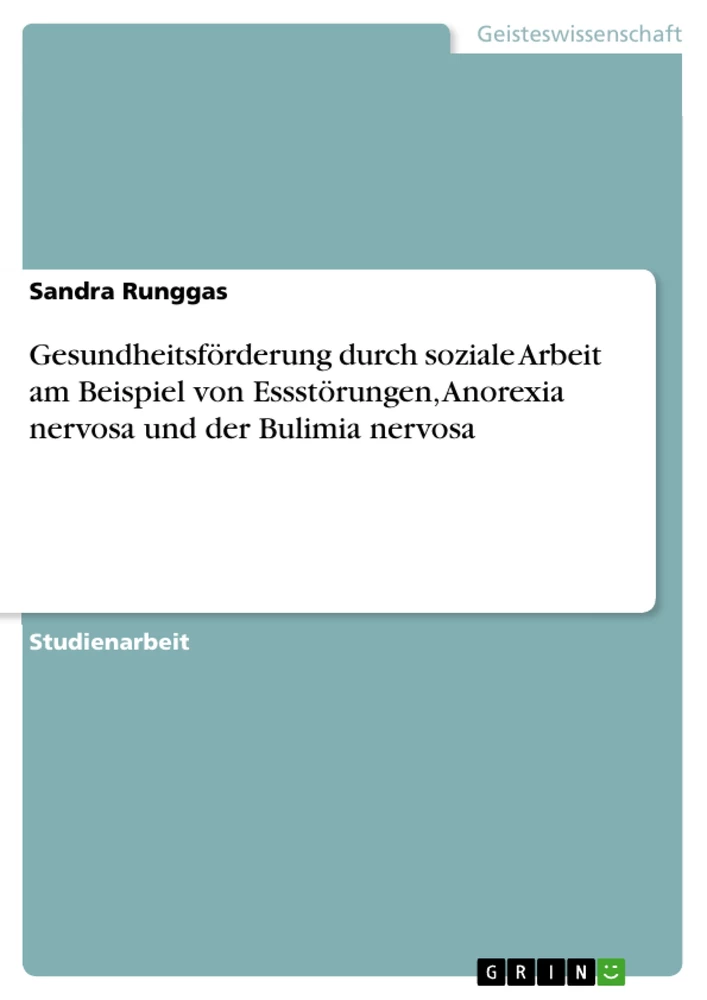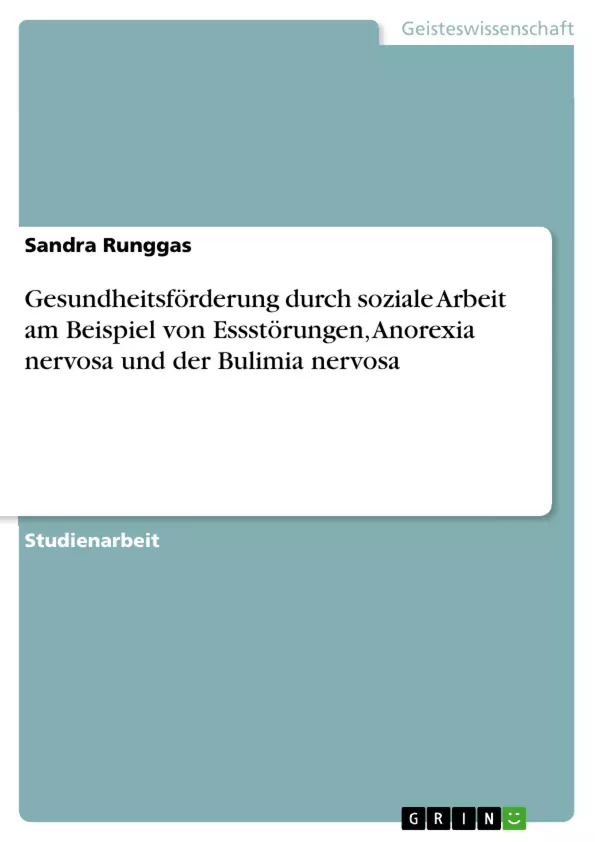Die vorliegende Arbeit bezieht sich auf das Thema „Gesundheitsförderung durch soziale Arbeit am Beispiel von Essstörungen, Anorexia nervosa und der Bulimia nervosa“ mit der Fragestellung, wie ist Präventionsarbeit bei Kindern und Jugendlichen möglich.
Krankheiten die in Verbindung mit Essen stehen, sind hauptsächlich Anorexia nervosa (Magersucht) und Bulimia nervosa (Ess-Brech-Sucht), daher werde ich im weiteren Verlauf dieser Hausarbeit nicht auf die sogenannten atypischen Essstörungen, wie zum Beispiel Binge-Eating-Störung eingehen.
Bevor man sich mit dem Thema der Präventionsarbeit intensiv beschäftigen kann, muss zunächst verstanden werden, was es bedeutet an einer Magersucht oder einer Bulimie zu leiden. Ich werden die einzelnen Krankheitsbilder beschreiben und auch die körperlichen Folgeschäden, die aufgrund der Erkrankung entstehen können benennen. Dabei muss beachtet werden, dass Essstörungen keine körperlichen Erkrankungen sind, sondern psychisch bedingt. Die Entstehung, die Behandlung und der Verlauf bei jeder Essstörung ist abhängig von der eigenen Persönlichkeit. Daher habe ich mich mit der Fragestellung beschäftigt, durch welche verschiedenen Faktoren Essstörungen ausgelöst werden können.
Über 90% der an einer Essstörung erkrankten Patienten sind weiblichen Geschlechts. Die Essstörung ist eine schwerwiegende, seelisch-körperliche Erkrankung die, wenn sie nicht rechtzeitig und fachgerecht behandelt wird oft ein Leben lang mit erheblichen Schädigungen des Körpers, der Psyche und der Zwischenmenschlichen Beziehung besteht. Oftmals ist das Leiden an einer Essstörung ein unbewusster Hilfeschrei und die Betroffenen streben nach dem perfekten Schönheitsideal.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Definition von Essstörungen
2.1 Anorexia nervosa (Magersucht)
2.1.1 Körperliche Folgeschäden der
Anorexia nervosa
2.2 Bulimia nervosa (Ess-Brech-Sucht)
2.2.1 Körperliche Folgeschäden der
Bulimia nervosa
3. Faktoren für Essstörungen
3.1 Psychologische Faktoren
3.2 Familiäre Faktoren
3.2.1 Anorexia: hohe Norm und Leistungs-
orientierung
3.2.2 Bulimie: starke Betonung von Aussehen,
Figur und Gewicht
3.3 Gesellschaftlicher Hintergrund
4. Prävention
4.1 Prävention von Essstörungen im Rahmen
gesundheitsförderlichen Maßnahmen
4.2 Präventionsprogramme
4.2.1 PriMa
4.2.2 Topp für Jungs
4.2.3 Torera
4.3 Schönheitsideal
4.4 Selbstwertgefühl
4.5 Soziale Kompetenzen
4.6 Essverhalten
5. Fazit
6. Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Unterschiede zwischen Anorexia nervosa und Bulimia nervosa?
Anorexia (Magersucht) ist durch extreme Nahrungsverweigerung geprägt, während Bulimie (Ess-Brech-Sucht) durch Essanfälle mit anschließendem Erbrechen gekennzeichnet ist.
Welche Faktoren begünstigen die Entstehung von Essstörungen?
Es spielen psychologische Faktoren, gesellschaftliche Schönheitsideale und familiäre Einflüsse (z. B. hoher Leistungsdruck) eine zentrale Rolle.
Wie kann soziale Arbeit bei der Prävention von Essstörungen helfen?
Durch gezielte Präventionsprogramme wie „PriMa“ oder „Torera“, die das Selbstwertgefühl und die soziale Kompetenz von Kindern und Jugendlichen stärken.
Sind Essstörungen rein körperliche Erkrankungen?
Nein, Essstörungen sind primär psychisch bedingte Erkrankungen, die jedoch schwerwiegende körperliche Folgeschäden nach sich ziehen können.
Warum sind überwiegend Mädchen und Frauen betroffen?
Über 90 % der Betroffenen sind weiblich, was oft mit dem gesellschaftlichen Druck zur Erreichung perfekter Schönheitsideale zusammenhängt.
- Quote paper
- Sandra Runggas (Author), 2013, Gesundheitsförderung durch soziale Arbeit am Beispiel von Essstörungen, Anorexia nervosa und der Bulimia nervosa, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/262500