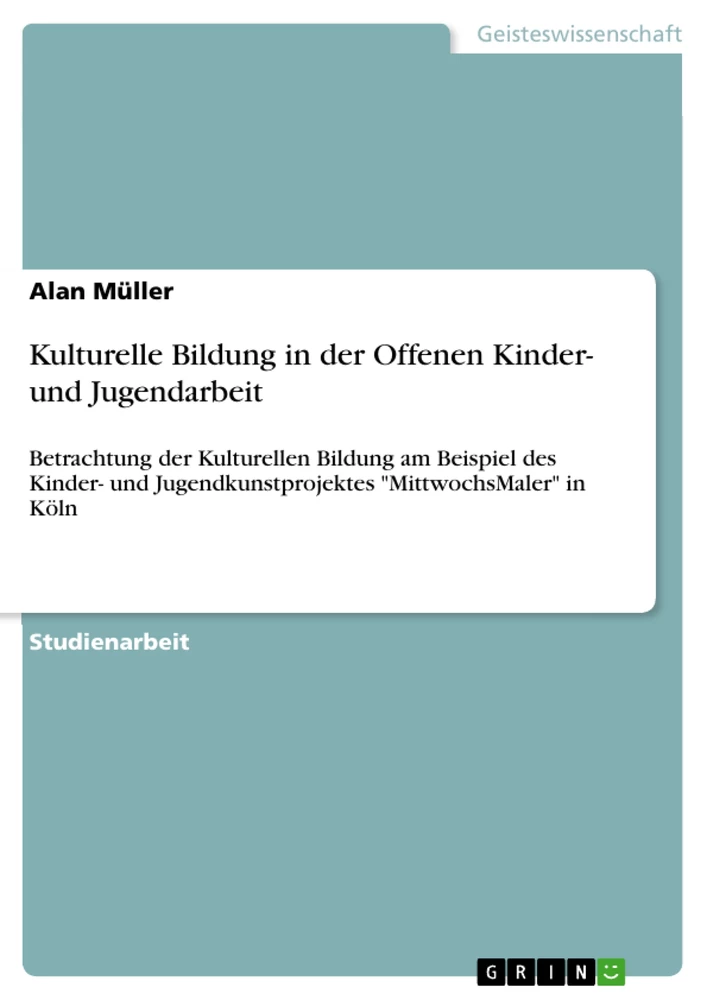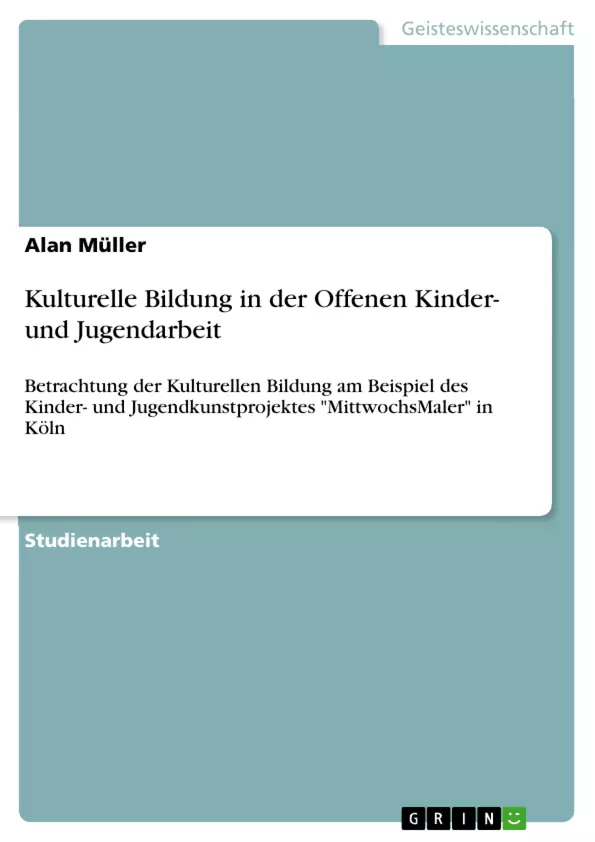„Kunst und Kultur sind Motoren gesellschaftlicher Entwicklungen – das macht
kulturelle Bildung so bedeutsam.“ (BPB, 2013)
Was unter dem Begriff Kulturelle Bildung verstanden wird, ist oft unklar. Der Begriff ist zu neu um allgemein bekannt oder gar gängig zu sein und obwohl er auf politischer Ebene in Deutschland bereits lange gebraucht wird, ist es selbst für Fachkundige nicht leicht, den Begriff zu definieren. Dies liegt unter anderem daran, dass die beiden Einzelbegriffe Kultur und Bildung bereits so vielfältig ausgelegt werden können. Und doch klingt der Begriff „Kulturelle Bildung“ so vielversprechend und ungekünstelt.
Kulturelle Angebote gibt es schon sehr lange im sozialen Bereich und in unterschiedlichster Art und Weise, vom Tanzworkshop bis hin zum Museumsbesuch.
Was steckt hinter dem vielsagenden Begriff? Und was bedeutet er für die Profession Soziale Arbeit?
Durch das Absolvieren eines Praxissemesters in einer Jugendeinrichtung Offene Tür Lucky´s Haus in Köln und dem dort angeschlossenen Jugendkunst- und Graffitiprojekt MittwochsMaler, habe ich die Erfahrung gemacht, wie schwierig es für ein Projekt der Sozialen Arbeit sein kann, eine Basisfinanzierung und eine ausreichende Legitimation des Arbeitsansatzes zu erlangen. Diese Schwierigkeit ergibt sich in diesem Fall durch die spezielle Ausrichtung: Das Projekt arbeitet ausschließlich mit Jugendlichen aus der Graffitiszene. Solche Projekte gibt es in Deutschland nur wenige. Das Projekt der MittwochsMaler ist in seinem Fortbestehen nicht gesichert, immer wieder müssen Projektmittel organisiert werden und es gibt keine fortlaufende Basisfinanzierung.
Hinzu kommt, dass die Stadt Köln Kürzungen im Bereich der Sozialen Arbeit vornimmt und bereits Einrichtungen geschlossen werden mussten. Dies passiert unter anderem daher, da der Erfolg kultureller Angebote schwerer messbar ist und somit Projekte und Einrichtungen unter Druck geraten. Die Bundesregierung in Deutschland vergibt Gelder für Projekte der Kulturellen Bildung. Wenn das Projekt MittwochsMaler der Kulturellen Bildung zugeordnet werden kann, könnte sich die Finanzielle Lage des Projektes möglicherweise verbessern. Es ergeben sich demnach folgende Fragen: Was bedeutet Kulturelle Bildung? Und kann das Projekt MittwochsMaler dieser zugeordnet werden?
Ziel dieser Arbeit ist es, den Begriff Kulturelle Bildung näher zu beleuchten und ein Projekt darzustellen, welches aufzeigt, wie die Kulturelle Bildung in der Praxis aussehen kann.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Begriffsklärung - Offene Kinder- und Jugendarbeit
3. Annäherung an den Begriff Kulturelle Bildung
3.1 Viele Begriffe - eine Bedeutung?
3.2 Entwicklungslinien
3.3 Eine allgemeine Definition
3.4 Kultur und Bildung in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
3.4.1 Kultur
3.4.2 Bildung
4. Kulturelle Bildung in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
5. Kulturelle Bildung in der Praxis
5.1 Offene Tür Lucky´s Haus
5.2 Die MittwochsMaler - ein Jugendkunst- und Graffitiprojekt
6. Konklusion
7. Fazit
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptziel dieser Arbeit zur Kulturellen Bildung?
Das Ziel ist es, den Begriff „Kulturelle Bildung“ theoretisch zu beleuchten und am Praxisbeispiel des Kölner Graffiti-Projekts „MittwochsMaler“ aufzuzeigen, wie dieser Ansatz in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit umgesetzt wird.
Warum ist der Begriff „Kulturelle Bildung“ schwer zu definieren?
Die Schwierigkeit ergibt sich daraus, dass sowohl „Kultur“ als auch „Bildung“ bereits sehr vielfältig ausgelegt werden können und der zusammengesetzte Begriff in der Fachwelt noch relativ neu und uneinheitlich gebraucht wird.
Was ist das Projekt „MittwochsMaler“?
Es handelt sich um ein Jugendkunst- und Graffitiprojekt in Köln (Lucky’s Haus), das speziell mit Jugendlichen aus der Graffitiszene arbeitet und soziale Arbeit mit künstlerischem Ausdruck verbindet.
Welche Rolle spielt die Finanzierung für solche Projekte?
Die Arbeit untersucht, wie schwierig die Legitimation und Basisfinanzierung für Projekte der Kulturellen Bildung ist, da Erfolge oft schwerer messbar sind als in anderen Bereichen der Sozialen Arbeit.
Welche Bereiche der Offenen Kinder- und Jugendarbeit werden thematisiert?
Die Arbeit behandelt die Begriffsklärung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, die Entwicklungslinien der Kulturellen Bildung sowie deren praktische Umsetzung in Jugendeinrichtungen.
- Quote paper
- Alan Müller (Author), 2013, Kulturelle Bildung in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/262526