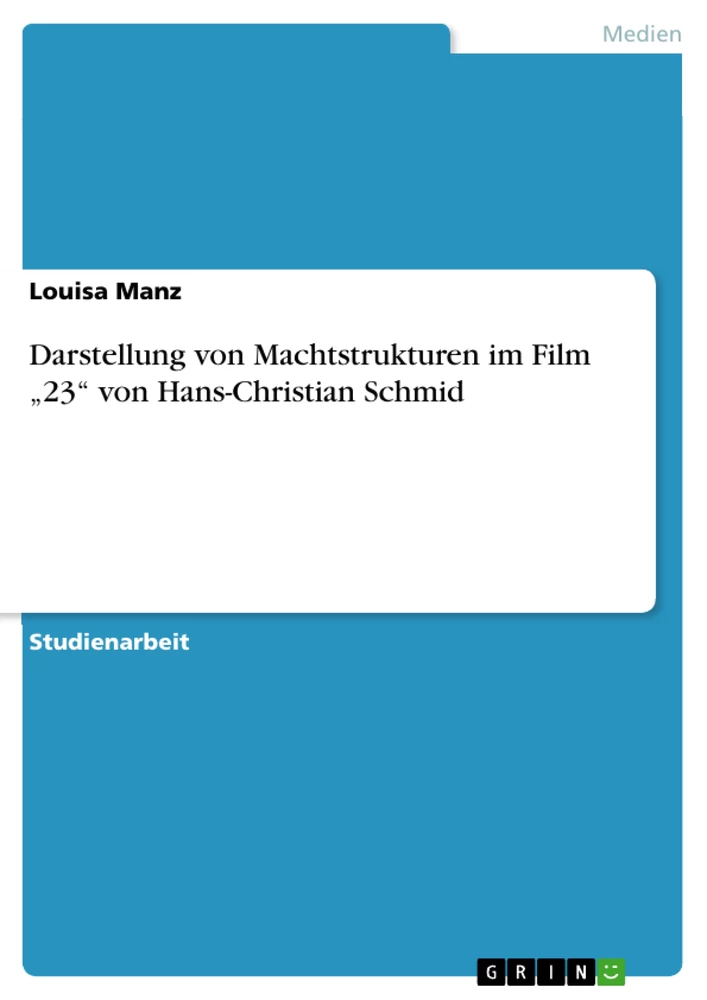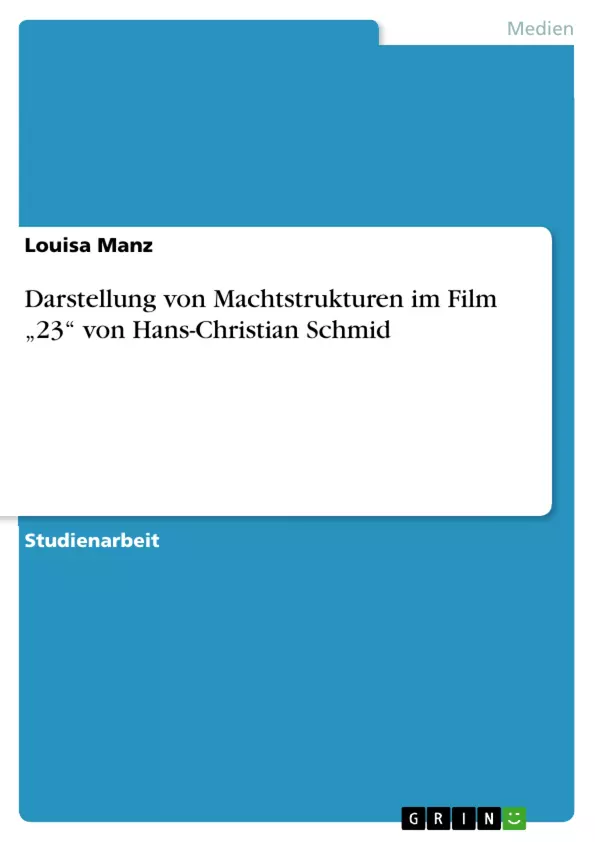1998 kommt der Film „23 – Nichts ist so wie es scheint“ in die Kinos. Im Film, den man als Drama und als Thriller einordnen kann, machen sich Regisseur Hans-Christian Schmid und Drehbuchautor Michael Gutmann auf die Suche nach der Geschichte des Hackers Karl Koch.
Diese Arbeit wird sich ausschließlich auf die Filmfigur beziehen.
Im Folgenden wird die Darstellung von verschiedenen Machtstrukturen im Film anhang von kurzen Sequenzanalysen untersucht.
Hans-Christian Schmids Spielfilme haben einen dokumentarischen Anspruch und verhandeln auf eigene Weise den Begriff der Wirklichkeit. Der Untertitel von „23“ lautet „Nichts ist so wie es scheint“ und der Film spielt mit dem Wechsel von historischen, fiktiven und fiktiv-subjektiven Wirklichkeiten. Das wirft die Frage nach dem Verhältnis von Sein, Schein und Authenzität auf. Außerdem hängt es von der Glaubwürdigkeit des Films ab, wie viel Macht er über den Zuschauer ergreifen kann. All diese Fragen möchte Schmid filmisch beantworten. Wie dies geschieht, soll im Folgenden ausgeführt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Machtebenen und Interpretationsansätze
- Macht des Geheimbundes, Macht durch Symbole
- Politische Macht: Beobachtungsverhältnisse
- Macht der Medien
- „Alte" Medien: Zeitung und Fernsehen
- Neue Medien: Internet, Hacker und Hackerethik
- Karls Hackerkarriere beginnt
- Freiheit und Internet
- Macht der Wissenschaft: Drogen und psychische Störungen
- Macht, Einbildung und Wirklichkeit
- Wirklichkeit, Wahrnehmung und Schein
- Wirklichkeit und Dokumentarismus
- Fazit und Ausblick
- Anhang
- Bibliographie
- Filmographie
- Sequenzprotokoll
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Darstellung von Machtstrukturen im Film „23 — Nichts ist so wie es scheint" von Hans-Christian Schmid. Der Fokus liegt auf verschiedenen Machtbegriffen und -dimensionen, die im Film anhand von Symbolen, Beobachtungsstrukturen, Medien und psychischen Störungen veranschaulicht werden. Die Arbeit untersucht, wie Schmid verschiedene Formen von Macht und ihre Verstrickung im Kontext des Films verhandelt.
- Die Macht des Geheimbundes „Illuminaten" und die Bedeutung von Symbolen
- Politische Macht und Überwachung durch den Verfassungsschutz
- Macht der Medien und die Rolle von Fernsehen und Internet
- Die Macht der Wissenschaft: Drogenkonsum und psychische Störungen
- Das Verhältnis von Einbildung und Wirklichkeit im Film
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Machtstrukturen im Film „23" ein und stellt die Figur Karl Koch sowie die verschiedenen Machtbegriffe von Max Weber und Michel Foucault vor. Es wird erläutert, wie der Film die verschiedenen Ebenen der Wirklichkeit verhandelt und die Frage nach dem Verhältnis von Sein und Schein aufwirft.
Im zweiten Kapitel werden die verschiedenen Machtebenen im Film analysiert. Der Geheimbund „Illuminaten" wird als eine Machtinstanz dargestellt, die durch Symbole und die Zahl 23 Einfluss auf Karl Koch ausübt. Die politische Macht des Staates wird durch den Verfassungsschutz, der Karl überwacht, deutlich. Die Medien spielen eine wichtige Rolle, indem sie die Sicht der Dinge beeinflussen und Karl in ihren Bann ziehen. Schließlich wird die Macht der Wissenschaft anhand von Drogenkonsum und psychischen Störungen untersucht, die Karls Wahrnehmung und sein Verhalten beeinflussen.
Das dritte Kapitel befasst sich mit dem Verhältnis von Einbildung und Wirklichkeit im Film. Es wird gezeigt, wie Karls subjektive Wahrnehmung von der Realität der anderen Figuren abweicht und wie der Film mit dem Wechsel von historischen, fiktiven und fiktiv-subjektiven Wirklichkeiten spielt. Die Verwendung von Dokumentarfilm-Elementen und Fernseharchivbildern verstärkt den Anspruch des Films, die Wirklichkeit darzustellen.
Das vierte Kapitel bietet ein Fazit und einen Ausblick. Es wird zusammengefasst, wie die verschiedenen Machtebenen im Film miteinander verwoben sind und wie der Film die Frage nach dem Verhältnis von Macht und Information aufwirft. Schließlich wird die Bedeutung des Films im Kontext von Schmids Gesamtwerk und die Relevanz der Themen für die heutige Zeit beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Darstellung von Machtstrukturen im Film „23", die Machtbegriffe von Max Weber und Michel Foucault, die Illuminaten, den Verfassungsschutz, die Medien, die Rolle von Fernsehen und Internet, Drogenkonsum und psychische Störungen sowie das Verhältnis von Einbildung und Wirklichkeit. Der Text beleuchtet die verschiedenen Ebenen der Wirklichkeit im Film und die Frage nach dem Verhältnis von Sein und Schein.
- Quote paper
- Louisa Manz (Author), 2012, Darstellung von Machtstrukturen im Film „23“ von Hans-Christian Schmid, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/262696