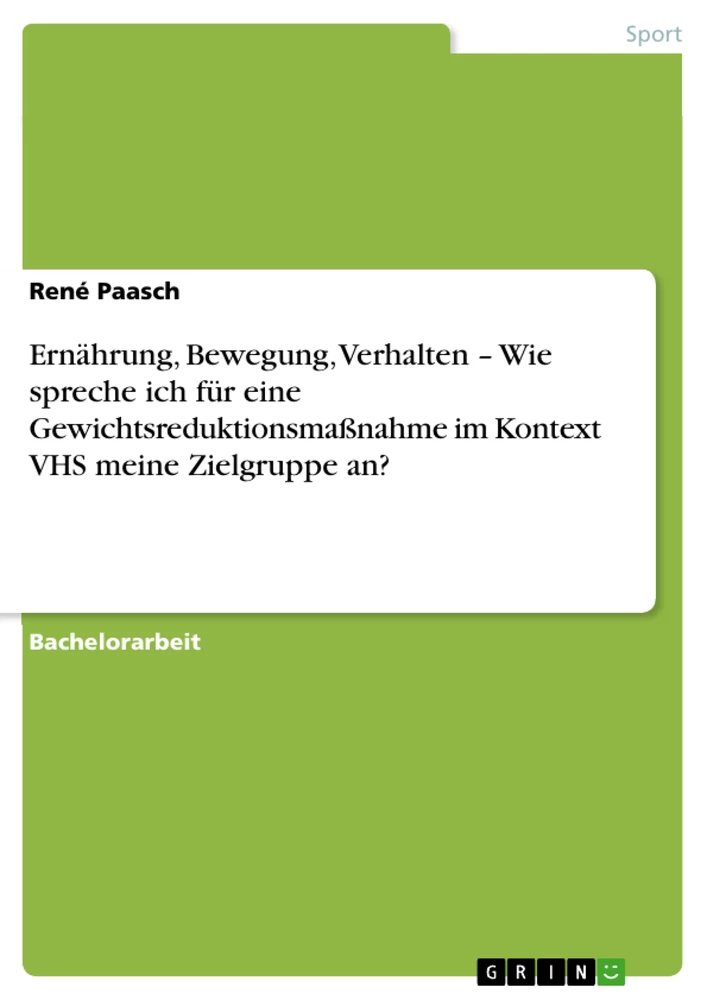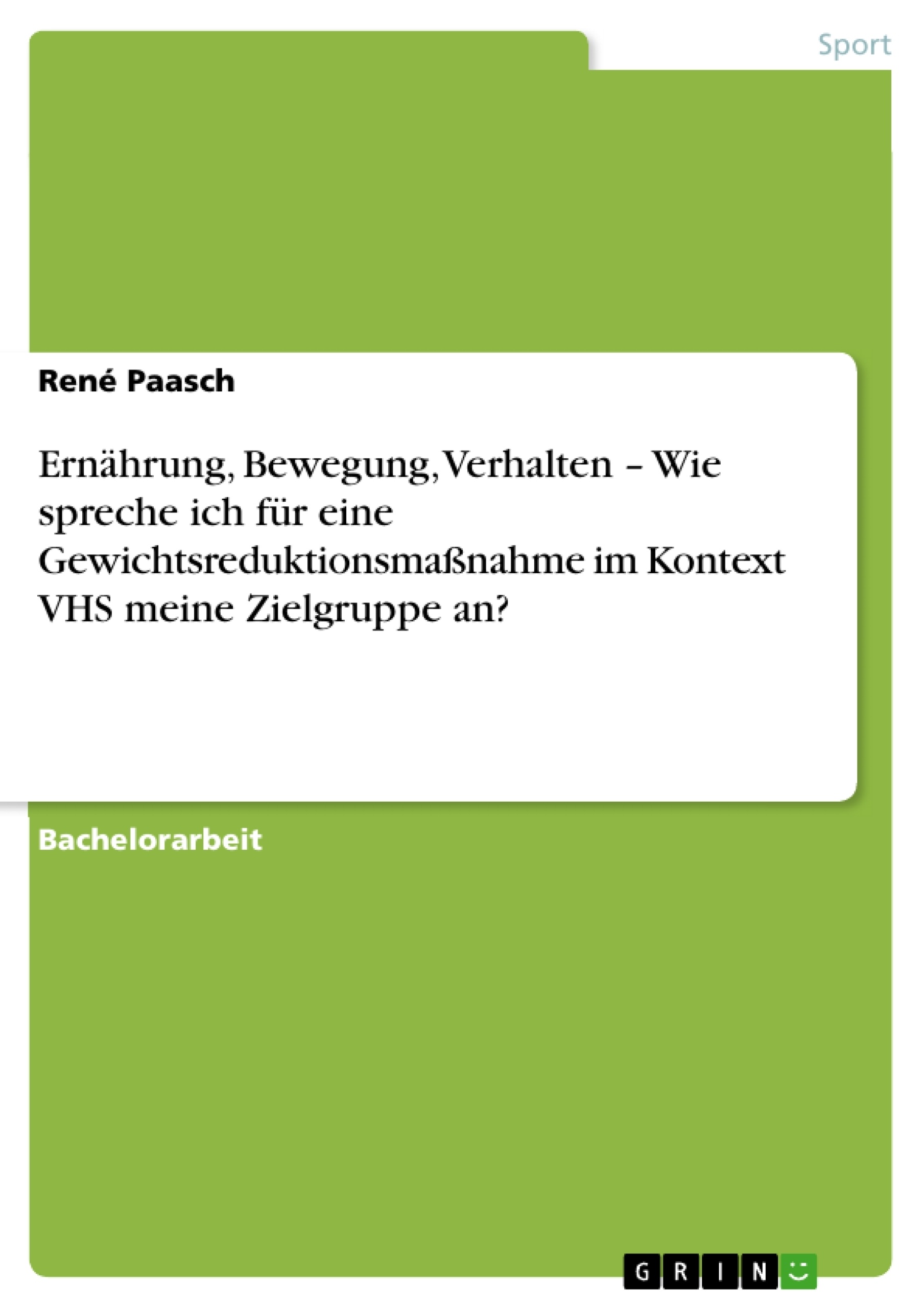Vor dem Hintergrund dieses bundesweiten und sicher auch noch über unsere Grenzen hinausgehenden Problems soll hier mit einer kleinen regionalen Feldarbeit versucht werden zu erforschen, was getan werden könnte, um die Bevölkerung eines kleinstädtischen Gebietes erfolgreich und nachhaltig für eine gesunde Lebensführung mit Gewichtsabnahme zu sensibilisieren.
Zielsetzung:
Ziel dieser Arbeit ist es, für ein noch zu entwickelndes VHS-Programm zur Gewichtsreduzierung an der Volkshochschule Flensburg die geeignete Ansprache der diesbezüglichen Zielgruppe zu erforschen, damit übergewichtige Menschen einerseits besser dafür gewonnen werden können und ihnen dann andererseits auch besser zu einer nachhaltigen Gewichtsabnahme und einer gesunden Lebensführung verholfen werden kann. Die zentrale Frage zur Zielsetzung ist: Wie spreche ich die ausgewählte Zielgruppe erfolgreich an?
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- 1 Einleitung und Problemstellung
- 2 Zielsetzung
- 3 Gegenwärtiger Kenntnisstand
- 3.1 Der Body-Mass-Index
- 3.2 Soziodemografische Merkmale
- 3.3 ErnährungsverhaltenÆrnährungswissen
- 3.4 Bewegungskenntnis/ -verhalten
- 3.5 Wie erleben wir Stress?
- 3.6 Gesundheitsprogramme in der VHS
- 3.7 Das Unternehmen Stadt inForm
- 4 Methodik
- 4.1 Entwurf des Fragebogens
- 4.2 Entwurf des Ernährungstagebuches
- 4.3 Online-Datenbankerstellung
- 4.4 Auswahl der Kooperationspartner
- 4.5 Zeitplanung der Feldarbeit
- 4.6 Datenschutz
- 4.7 Öffentlichkeitsarbeit/ Medieninformation
- 5 Ergebnisse
- 5.1 Fragen 1-7 - Anthropometrische Daten und Bildung
- 5.2 Fragen 8-29 - Ernährungsverhalten und Ernährungswissen
- 5.3 Fragen 30—32 - Stress-Check
- 5.4 Fragen 33—41 - Bewegungswissen/Bewegungsverhalten
- 5.5 Beurteilung VHS
- 5.6 Auswertung Ernährungstagebuch
- 6 Diskussion
- 6.1 Die Zielgruppe — Information, Motivation: Bewusstmachung
- 6.1.1 Informieren und Wissenslücken åillen
- 6.1_2_ Motivieren und Begleiten
- 6.1.3 Bewusstmachung und Selbstverantwortung
- 6 _ 2 _ Kooperationspartner — Informieren und Netzwerke pflegen
- Panner infomlieren und gewinnen
- Netzwerke pflegen und erweitern
- Bereichsübergreifende Arbeit
- 6.3 Gewinnung der VHS
- 6.4. Online-Programme nutzen
- 6 _ 5 _ Demografische Entwicklung
- 6.1 Die Zielgruppe — Information, Motivation: Bewusstmachung
- 7 Zusammenfassung
- 8 Literatur (thematisch geordnet)
- Ernährung und Übergewicht
- Europäische Charta zur Bekämpåung der Adipositas
- Europäische Strategie zur Prävention und Bekämpfung nichtübertragbarer Krankheiten
- Global Strategy on Dietz Physical Activity and Health
- weitere Internetquellen
- Online-Befra gung
- Demografie
- Stress
- Verhalten und Gesundheit
- Bewegung und Gesundheit
- 9 Abbildungen und Tabellen
- 10 Anlagen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit der Entwicklung eines Gewichtsreduktionsprogramms an der Volkshochschule Flensburg. Die Arbeit untersucht die geeignete Ansprache der Zielgruppe, um übergewichtige Menschen zu motivieren und ihnen zu einer nachhaltigen Gewichtsabnahme und einer gesunden Lebensführung zu verhelfen. Die zentrale Frage ist: Wie spreche ich die ausgewählte Zielgruppe erfolgreich an?
- Die Zielgruppe: Übergewichtige Menschen in Flensburg, insbesondere ältere Frauen.
- Die Ansprache der Zielgruppe: Informationen, Motivation, Bewusstmachung.
- Kooperationspartner: Aufbau und Pflege von Netzwerken mit verschiedenen Institutionen.
- Die Rolle der Volkshochschule: Herausforderungen und Möglichkeiten der Zusammenarbeit.
- Die demografische Entwicklung: Anpassung des Programms an die Bedürfnisse der alternden Gesellschaft.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Problematik von Übergewicht und die Notwendigkeit von Maßnahmen zur Gewichtsreduktion beleuchtet. Die Zielsetzung des Projekts wird im zweiten Kapitel erläutert. Das dritte Kapitel präsentiert den aktuellen Kenntnisstand zu den Themen Ernährung, Bewegung, Stress und Verhalten. Die Methodik der Arbeit, die einen Fragebogen und ein Ernährungstagebuch beinhaltet, wird im vierten Kapitel beschrieben. Die Ergebnisse der Befragung werden im fünften Kapitel zusammengefasst und analysiert. Das sechste Kapitel diskutiert die gewonnenen Erkenntnisse und gibt Empfehlungen für die erfolgreiche Ansprache der Zielgruppe. Die Arbeit endet mit einer Zusammenfassung und einem Ausblick auf zukünftige Forschungsarbeiten.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Gewichtsreduktion, Volkshochschule, Zielgruppenansprache, Übergewicht, Adipositas, Ernährung, Bewegung, Stress, Verhalten, Demografie, Kooperation, Netzwerk, Gesundheitsprogramm, Informationsvermittlung, Motivation.
Häufig gestellte Fragen
Wie spricht man die Zielgruppe für Abnehmkurse an der VHS richtig an?
Erfolgreiche Ansprache basiert auf Empathie, Information über Wissenslücken und Motivation zur Selbstverantwortung, statt auf reiner Belehrung.
Welche Rolle spielt der BMI bei der Zielgruppendefinition?
Der Body-Mass-Index dient als objektives Kriterium zur Identifizierung von Übergewicht und Adipositas, sollte aber durch soziodemografische Daten ergänzt werden.
Warum ist Stressmanagement wichtig für die Gewichtsreduktion?
Stress ist ein häufiger Auslöser für ungünstiges Ernährungsverhalten. Ein ganzheitliches Programm muss daher auch Strategien zur Stressbewältigung vermitteln.
Wie können Kooperationspartner die VHS unterstützen?
Netzwerke mit Krankenkassen, Ärzten oder Betrieben helfen dabei, die Zielgruppe direkt zu erreichen und die Nachhaltigkeit der Programme zu erhöhen.
Welchen Einfluss hat die Demografie auf Gesundheitsprogramme?
Durch die alternde Gesellschaft müssen Kurse speziell auf die Bedürfnisse älterer Menschen (z.B. gelenkschonende Bewegung, Ernährung im Alter) angepasst werden.
- Citation du texte
- René Paasch (Auteur), 2008, Ernährung, Bewegung, Verhalten – Wie spreche ich für eine Gewichtsreduktionsmaßnahme im Kontext VHS meine Zielgruppe an?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/262700