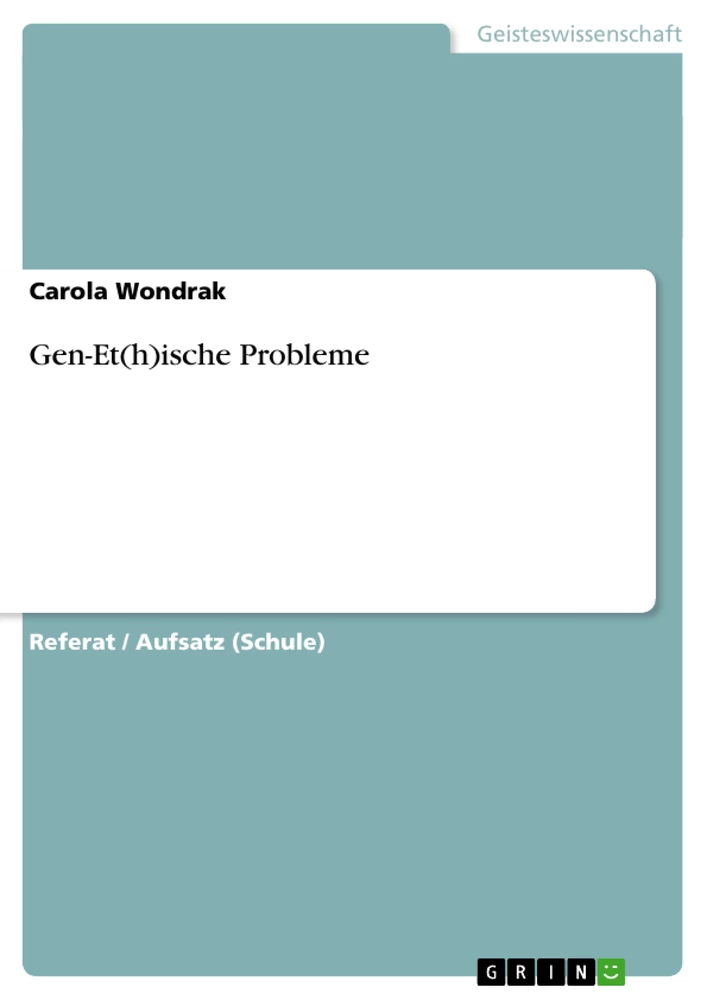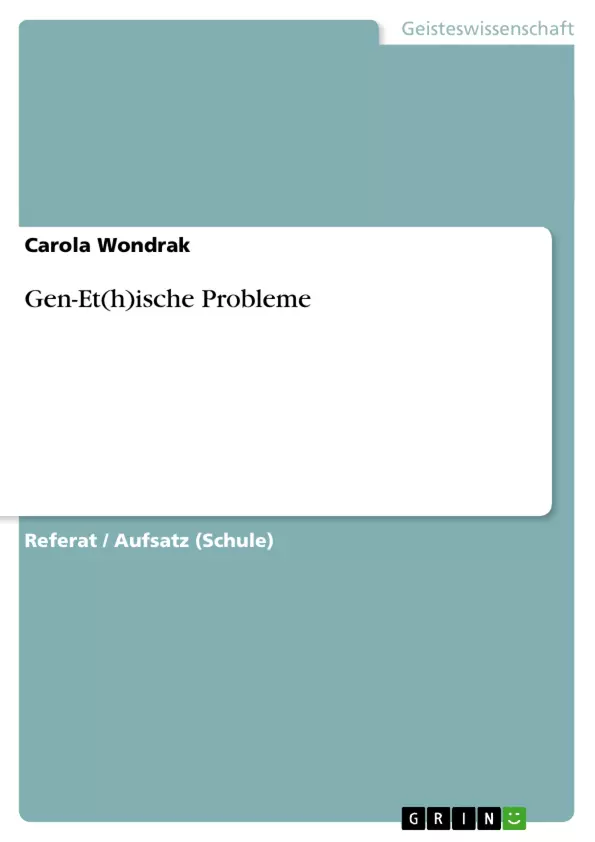Als am 26.Juni 2000 bekannt wurde, das nun das menschliche Genom bis zu 99% untersucht wäre, gab es viele verschiedene Reaktionen auf diese Ankündigung. Die einen sahen in dem Fortschritt der Technik einen enormen Vorteil und hatten Illusionen von einer Heilung der genbedingten Krankheiten, wie die Bluterkrankheit oder Mucoviszidose. Sie stellten sich vor, dass die defekten Stücke im Erbgut ausgetauscht oder repariert werden könnten. Doch kann man die naturgegebenen Krankheiten eines Menschen so sehr beeinflussen, ihn sogar heilen? Die Skeptiker dagegen halten diese Entdeckung für ein hohes Risiko. Ein Großteil des Menschen kann nun durch die Entschlüsselung seiner Genome vorhergesagt werden. Vielleicht könnte es bald Pflicht werden, einen Pass bei seinem Arbeitgeber vorzuzeigen, in dem die Ergebnisse eines Gentests festgehalten sind? Menschen mit erblich bedingter Kahlheit oder angeborenem Hang zum Alkoholismus könnten diskriminiert werden. Es könnte passieren, dass der Arbeitgeber lieber einen Menschen anstellt, dessen Gene ihn als sehr sozialen oder widerstandsfähigen Menschen auszeichnen. Der Vorteil für den Chef scheint klar auf der Hand zu liegen: Lieber den gesunden einstellen, es gibt weniger Fehltage und für das gesamte Unternehmen wäre dieser Arbeitnehmer effizienter. Doch was ungeachtet bleibt: Es bedeutet nicht, dass der andere zwangsläufig zum Säufer werden muss. Die Gene zeigen hier Veranlagungen auf, und keinen perfekt konstruierten Lebenslauf. Es gibt weltweit viele Trinker, die ihre Angewohnheit nicht angeboren bekommen haben. Genauso, wie der eigentlich widerstandsfähige Arbeiter auch krank werden kann. Natürlich kommt es auch da auf die äußeren Umstände an. Ich halte es für falsch, dass jeder Mensch meine besonderen Begabungen und Veranlagungen sofort lesen kann. Dadurch wird die Freiheit des Einzelnen viel mehr eingeschränkt und meiner Meinung nach werden die Auswahlverfahren für alle möglichen Dinge strenger. Zum Beispiel Schulen und Universitäten, die statt Einstellungstests, eine Genanalyse des Bewerbers durchlesen. Ein noch schwerwiegenderes Beispiel: Krankenkassen, die nur Kunden aufnehmen, bei denen es keine genetischen Defekte oder veranlagte Missstände gibt. Das wäre ein schlimmes Ausleseverfahren, denn schon zu jetzigen Zeit gibt es einige Versicherer, die Schwerbehinderte oder Patienten mit einer Krankheit, aus der sich Folgekrankheiten ergeben, nicht nehmen wollen. Und sie müssen nicht.
Inhaltsverzeichnis
- Als am 26. Juni 2000 bekannt wurde, dass das menschliche Genom bis zu 99% untersucht wäre
- Die Skeptiker halten diese Entdeckung für ein hohes Risiko
- Das Thema der Sterbehilfe
- Die PID ist der Begriff für die genetische und zytologische Untersuchung eines Embryos bei der In-vitro-Fertilisation
- Die wohl bekannteste und provokativste Position in der Debatte ist die Position Peter Singers
- Komplett unvertretbar ist auch, dass man aus Kindern ein gentechnologisches Projekt macht
- Aus dem Grunde, dass mein Kind mit viel weniger Anstrengung besser wäre, als alle anderen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text analysiert ethische Probleme im Zusammenhang mit den Fortschritten in der Genforschung und -technologie. Er untersucht die gesellschaftlichen Auswirkungen der Genomforschung, insbesondere die potenziellen Risiken von Diskriminierung und die ethischen Fragen der Sterbehilfe und der Präimplantationsdiagnostik (PID).
- Die ethischen Implikationen der Genomforschung
- Die Risiken von Diskriminierung aufgrund genetischer Informationen
- Die Debatte um Sterbehilfe und die Definition von "lebenswertem" Leben
- Die ethischen Herausforderungen der PID und der genetischen Selektion
- Die gesellschaftlichen Konsequenzen der gentechnischen Optimierung von Kindern
Zusammenfassung der Kapitel
Als am 26. Juni 2000 bekannt wurde, dass das menschliche Genom bis zu 99% untersucht wäre: Dieses Kapitel beschreibt die unterschiedlichen Reaktionen auf die Bekanntgabe der weitgehenden Entschlüsselung des menschlichen Genoms. Während die einen die Heilung von Erbkrankheiten erhofften, sahen die Skeptiker die Gefahr der Diskriminierung aufgrund genetischer Informationen. Der Text beleuchtet die potenziellen Missbräuche, wie z.B. die Benachteiligung von Menschen mit genetischen Vorbelastungen bei der Arbeitsplatzsuche oder der Krankenversicherung. Die Ambivalenz der Situation wird herausgestellt: Gene zeigen Veranlagungen an, garantieren aber keine bestimmten Lebensläufe. Die individuelle Freiheit wird als bedroht angesehen, da die Kenntnis genetischer Informationen zu einer stärkeren Selektion in verschiedenen Lebensbereichen führen könnte.
Die Skeptiker halten diese Entdeckung für ein hohes Risiko: Dieses Kapitel erweitert die Diskussion um die Risiken der Genomforschung. Es wird die Angst vor einer gesellschaftlichen Spaltung aufgrund genetischer Unterschiede thematisiert, verschärft durch Faktoren wie Inflation, Arbeitslosigkeit und Hunger. Die Autorin argumentiert, dass die Solidarität in einer solchen Situation brüchig werden könnte und zu einem verschärften Konkurrenzkampf führen würde. Die Problematik von Krankenkassen, die Personen mit hohen Behandlungskosten ablehnen könnten, wird im Kontext der möglichen Zunahme von genetisch bedingten Erkrankungen wie Alzheimer diskutiert.
Das Thema der Sterbehilfe: Dieses Kapitel beleuchtet die ethische Debatte um Sterbehilfe. Die Autorin präsentiert unterschiedliche Standpunkte, u.a. den religiösen Standpunkt von Jürgen Moltmann, der die Bedeutung der menschlichen Vielfalt betont, und den Standpunkt von Politikern, die die Präimplantationsdiagnostik kritisch sehen. Es wird die Komplexität der Situation aufgezeigt: einerseits der mögliche politische Nutzen durch geringere Kosten im Rentensystem, andererseits die emotionalen Bindungen der Angehörigen an die Sterbenden.
Die PID ist der Begriff für die genetische und zytologische Untersuchung eines Embryos bei der In-vitro-Fertilisation: Dieses Kapitel beschreibt die Präimplantationsdiagnostik (PID) und ihre ethischen Implikationen. Es wird erklärt, wie die PID funktioniert und welche Informationen sie liefern kann. Die Zerstörung der Embryonenzelle bei der Untersuchung und die damit verbundene ethische Frage nach dem Beginn des Lebens werden hervorgehoben. Die gegenwärtige Rechtslage in Deutschland wird ebenfalls angesprochen.
Die wohl bekannteste und provokativste Position in der Debatte ist die Position Peter Singers: Dieses Kapitel stellt Peter Singers Position zur Sterbehilfe und zur Abgrenzung zwischen lebenswertem und lebensunwertem Leben dar. Singer argumentiert, dass bei schweren, unheilbaren Krankheiten der Tod eine Erlösung sein kann. Die Autorin kritisiert Singers Ansicht und betont den Wert jedes menschlichen Lebens, auch mit Behinderungen. Die Problematik der Abtreibung aufgrund von genetischen Defekten wird thematisiert.
Komplett unvertretbar ist auch, dass man aus Kindern ein gentechnologisches Projekt macht: Dieses Kapitel befasst sich mit den ethischen Bedenken der gentechnischen Optimierung von Kindern. Es wird die Möglichkeit der Auswahl von Eigenschaften wie Haar- und Augenfarbe, sowie die Beseitigung von genetischen Defekten thematisiert. Die Autorin kritisiert die Idee der genetischen Optimierung als einen "Rüstungswettlauf", der zu einer gesellschaftlichen Spaltung führen könnte, mit normal geborenen Kindern die in der Gesellschaft benachteiligt wären.
Aus dem Grunde, dass mein Kind mit viel weniger Anstrengung besser wäre, als alle anderen: In diesem Kapitel wird die Perspektive der Eltern, die ihre Kinder gentechnisch optimieren lassen würden, beleuchtet. Der Wunsch nach einem besseren und erfolgreicheren Leben für das Kind und der gesellschaftliche Druck werden als Gründe genannt. Die Autorin zeigt jedoch auch die potenziellen negativen Folgen auf, wie z.B. die Entstehung eines neuen Ungleichgewichts in der Gesellschaft.
Schlüsselwörter
Genforschung, Genom, Gentechnologie, ethische Probleme, Sterbehilfe, Präimplantationsdiagnostik (PID), genetische Diskriminierung, gesellschaftliche Auswirkungen, Lebensqualität, genetische Selektion, Kinderwunsch, menschliche Würde.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Ethische Probleme der Genforschung
Was ist das Thema des Textes?
Der Text analysiert ethische Probleme im Zusammenhang mit den Fortschritten in der Genforschung und -technologie. Er untersucht die gesellschaftlichen Auswirkungen der Genomforschung, insbesondere die potenziellen Risiken von Diskriminierung und die ethischen Fragen der Sterbehilfe und der Präimplantationsdiagnostik (PID).
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt folgende Themenschwerpunkte: die ethischen Implikationen der Genomforschung, die Risiken von Diskriminierung aufgrund genetischer Informationen, die Debatte um Sterbehilfe und die Definition von "lebenswertem" Leben, die ethischen Herausforderungen der PID und der genetischen Selektion sowie die gesellschaftlichen Konsequenzen der gentechnischen Optimierung von Kindern.
Wie wird die Bekanntgabe der weitgehenden Entschlüsselung des menschlichen Genoms dargestellt?
Das Kapitel beschreibt die unterschiedlichen Reaktionen auf die Bekanntgabe: Hoffnung auf Heilung von Erbkrankheiten versus die Angst vor Diskriminierung aufgrund genetischer Informationen. Es werden potenzielle Missbräuche und die Ambivalenz der Situation beleuchtet: Gene zeigen Veranlagungen an, garantieren aber keine bestimmten Lebensläufe. Die individuelle Freiheit wird als potenziell bedroht angesehen.
Welche Risiken der Genomforschung werden hervorgehoben?
Die Angst vor gesellschaftlicher Spaltung aufgrund genetischer Unterschiede, verschärft durch Faktoren wie Inflation, Arbeitslosigkeit und Hunger, wird thematisiert. Die Autorin argumentiert, dass die Solidarität brüchig werden könnte und zu einem verschärften Konkurrenzkampf führen würde. Die Problematik von Krankenkassen, die Personen mit hohen Behandlungskosten ablehnen könnten, wird im Kontext der möglichen Zunahme von genetisch bedingten Erkrankungen diskutiert.
Wie wird die Debatte um Sterbehilfe dargestellt?
Das Kapitel präsentiert unterschiedliche Standpunkte, u.a. den religiösen Standpunkt von Jürgen Moltmann und den Standpunkt von Politikern, die die Präimplantationsdiagnostik kritisch sehen. Es wird die Komplexität der Situation aufgezeigt: möglicher politischer Nutzen durch geringere Kosten im Rentensystem versus die emotionalen Bindungen der Angehörigen an die Sterbenden.
Was ist die Präimplantationsdiagnostik (PID) und welche ethischen Implikationen hat sie?
Das Kapitel beschreibt die PID, ihre Funktionsweise und die Informationen, die sie liefern kann. Die Zerstörung der Embryonenzelle bei der Untersuchung und die damit verbundene ethische Frage nach dem Beginn des Lebens werden hervorgehoben. Die gegenwärtige Rechtslage in Deutschland wird ebenfalls angesprochen.
Welche Position vertritt Peter Singer und wie wird sie kritisiert?
Peter Singers Position zur Sterbehilfe und zur Abgrenzung zwischen lebenswertem und lebensunwertem Leben wird dargestellt. Singer argumentiert, dass bei schweren, unheilbaren Krankheiten der Tod eine Erlösung sein kann. Die Autorin kritisiert Singers Ansicht und betont den Wert jedes menschlichen Lebens, auch mit Behinderungen. Die Problematik der Abtreibung aufgrund von genetischer Defekte wird thematisiert.
Welche ethischen Bedenken bestehen gegen die gentechnische Optimierung von Kindern?
Das Kapitel thematisiert die Möglichkeit der Auswahl von Eigenschaften wie Haar- und Augenfarbe sowie die Beseitigung von genetischen Defekten. Die Autorin kritisiert die Idee der genetischen Optimierung als einen "Rüstungswettlauf", der zu einer gesellschaftlichen Spaltung führen könnte, mit normal geborenen Kindern die in der Gesellschaft benachteiligt wären.
Wie wird die Perspektive der Eltern, die ihre Kinder gentechnisch optimieren lassen würden, beleuchtet?
Der Wunsch nach einem besseren und erfolgreicheren Leben für das Kind und der gesellschaftliche Druck werden als Gründe genannt. Die Autorin zeigt jedoch auch die potenziellen negativen Folgen auf, wie z.B. die Entstehung eines neuen Ungleichgewichts in der Gesellschaft.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Text?
Genforschung, Genom, Gentechnologie, ethische Probleme, Sterbehilfe, Präimplantationsdiagnostik (PID), genetische Diskriminierung, gesellschaftliche Auswirkungen, Lebensqualität, genetische Selektion, Kinderwunsch, menschliche Würde.
- Quote paper
- Carola Wondrak (Author), 2007, Gen-Et(h)ische Probleme, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/262988