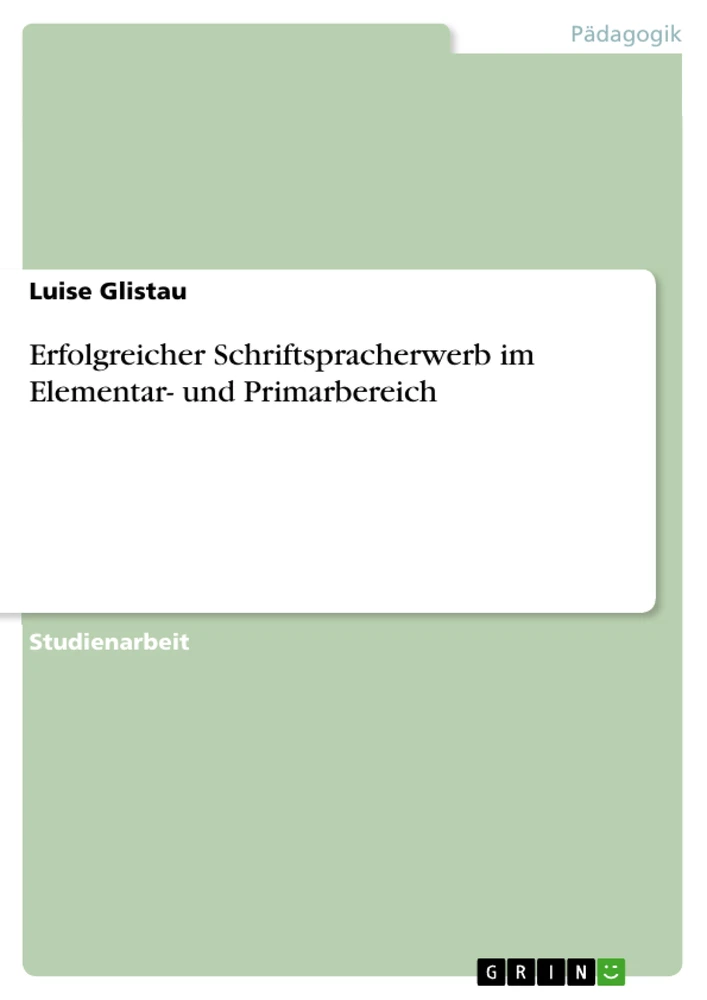"Die Lehrerin beschloß, das Rechnen jetzt aufzugeben. Sie meinte, daß es Pippi vielleicht mehr Spaß machen würde, lesen zu lernen. Sie holte ein kleines, hübsches Bild hervor, das einen Igel vorstellte. Vor der Nase des Igels stand der Buchstabe i. „Jetzt, Pippi, sollst du etwas Lustiges zu sehen bekommen“, sagte sie schnell. „Hier siehst du einen Iiiigel, und dieser Buchstabe vor dem Iiiigel heißt i.“ „Ach, das glaube ich im Leben nicht“, sagte Pippi. „Ich finde, das sieht aus wie ein gerader Strich mit einem kleinen Fliegenpunkt drauf. Aber ich möchte wirklich gern wissen, was der Igel mit dem Fliegenpunkt zu tun hat." (Lindgren 1997, S. 63)
Dieser Dialog aus Astrid Lindgrens berühmter Erzählung Pippi geht in die Schule macht deutlich, was man sich als Schriftkundiger nur noch selten vor Augen führt: in Alphabetschriften sind die einzelnen Buchstaben nicht durch Ähnlichkeit sondern durch Konvention mit dem, was sie bezeichnen, verbunden und lassen dadurch keinen direkten Schluss auf die Bedeutung des gemeinten Wortes zu. Das Erlangen eben dieser Erkenntnis ist nur eine von zahlreichen Hürden, welche Kinder im Verlauf des Schriftspracherwerbs überwinden müssen. Vor allem die Eltern der Schulanfänger „erleben häufig mit Verwunderung, wie mühsam sich die ersten Schritte beim Lesen und Schreiben gestalten“ (Andresen 2005, S. 11).
Neben der Darstellung dieser sowie weiterer Schwierigkeiten, denen Kinder auf ihrem Weg des Lesen- und Schreibenlernens begegnen, soll im Rahmen der vorliegenden Arbeit gezeigt werden, wie komplex der Prozess des Schriftspracherwerbs ist, vor allem aber, welche Faktoren ihn begünstigen, woran sich Schulanfänger beim Schreiben orientieren und welche Handlungsempfehlungen aus den jeweiligen Erkenntnissen für die Arbeit der Pädagogen im Elementar- und Primarbereich abgeleitet werden können.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Charakteristika der Schrift
- 3. Voraussetzungen für einen erfolgreichen Schriftspracherwerb
- 3.1 Zur sprachlichen Bildung durch Literacy
- 3.2 Anregungen für Literacy-Aktivitäten im Elementar- und Primarbereich
- 3.3 Das phonologische Bewusstsein
- 3.4 Begriffsbildungen von Kindern zum Lesen und Schreiben
- 4. Woran sich Schulanfänger beim Schreiben orientieren
- 5. Zusammenfassung
- 6. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem komplexen Prozess des Schriftspracherwerbs im Elementar- und Primarbereich. Ziel ist es, die Herausforderungen zu beleuchten, denen Kinder auf ihrem Weg zum Lesen und Schreibenlernen begegnen und gleichzeitig die Faktoren zu identifizieren, die diesen Prozess begünstigen.
- Schwierigkeiten beim Schriftspracherwerb
- Bedeutung des phonologischen Bewusstseins
- Rolle der frühen Sprachförderung und Literacy-Aktivitäten
- Orientierungspunkte für Schulanfänger beim Schreibenlernen
- Handlungsempfehlungen für Pädagogen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt mit einem Zitat aus Astrid Lindgrens „Pippi geht in die Schule“ die zentrale Frage nach dem Wesen der Schrift und ihrer Beziehung zur gesprochenen Sprache ein. Sie beleuchtet die Herausforderungen des Schriftspracherwerbs aus der Perspektive der Kinder und der Eltern. Die Arbeit setzt sich zum Ziel, die Komplexität des Prozesses zu beleuchten, die begünstigenden Faktoren herauszuarbeiten und konkrete Handlungsempfehlungen für Pädagogen im Elementar- und Primarbereich zu entwickeln.
Im zweiten Kapitel werden die Charakteristika der Schrift als Zeichensystem erläutert. Dabei werden die Vorteile und Herausforderungen der schriftlichen Fixierung von Sprache, insbesondere im Hinblick auf das Abstraktionsvermögen von Kindern, aufgezeigt. Es wird die Bedeutung der Erkenntnis des Aufbaus der Schrift und ihrer Funktion in der Kommunikation betont. Das Kapitel endet mit einem Blick auf die verschiedenen Ansätze der Schriftforschung und deren Bedeutung für das Verständnis des Schriftspracherwerbs.
Kapitel drei fokussiert auf die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Schriftspracherwerb. Es werden die zentralen Komponenten wie Feinmotorik, Sprachverständnis und phonologisches Bewusstsein hervorgehoben und deren Bedeutung für das Lesen- und Schreibenlernen erläutert. Die frühe Teilhabe an schriftsprachlich orientierten kulturellen Praktiken und die Bedeutung von Literacy-Aktivitäten im Elementar- und Primarbereich werden als wichtige Faktoren für einen gelungenen Schriftspracherwerb betrachtet.
Kapitel vier befasst sich mit der Frage, woran sich Schulanfänger beim Schreiben orientieren. Es werden verschiedene Strategien und Orientierungspunkte, die Kinder beim Schreibenlernen nutzen, vorgestellt und analysiert. Die Bedeutung von visuellen und auditiven Merkmalen, aber auch die Rolle des Kontextes und der eigenen Erfahrungen werden im Hinblick auf die Entwicklung des Schriftspracherwerbs diskutiert.
Schlüsselwörter
Schriftspracherwerb, Elementarbereich, Primarbereich, Literacy, phonologisches Bewusstsein, Sprachanalyse, Schriftkultur, Schriftspracherwerbstheorien, Handlungsempfehlungen für Pädagogen.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist der Schriftspracherwerb für Kinder eine so große Hürde?
In Alphabetschriften sind Buchstaben nur durch Konvention mit Lauten verbunden, nicht durch Ähnlichkeit. Kinder müssen erst erkennen, dass ein Zeichen wie ein „i“ abstrakt für einen Laut steht.
Was bedeutet der Begriff „Literacy“ in diesem Zusammenhang?
Literacy bezeichnet die sprachliche Bildung und die frühe Teilhabe an einer schriftsprachlich orientierten Kultur, was den späteren Lernerfolg maßgeblich begünstigt.
Welche Rolle spielt das phonologische Bewusstsein?
Es ist eine zentrale Voraussetzung für das Lesen- und Schreibenlernen, da es das Erkennen und Manipulieren der Lautstruktur gesprochener Sprache ermöglicht.
Woran orientieren sich Schulanfänger beim ersten Schreiben?
Kinder nutzen oft visuelle und auditive Merkmale, aber auch den Kontext und eigene Erfahrungen mit Schrift in ihrem Alltag.
Welche Handlungsempfehlungen gibt die Arbeit für Pädagogen?
Die Arbeit empfiehlt gezielte Literacy-Aktivitäten im Elementar- und Primarbereich sowie die Förderung des phonologischen Bewusstseins durch spielerische Anregungen.
- Arbeit zitieren
- Luise Glistau (Autor:in), 2013, Erfolgreicher Schriftspracherwerb im Elementar- und Primarbereich, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/263073