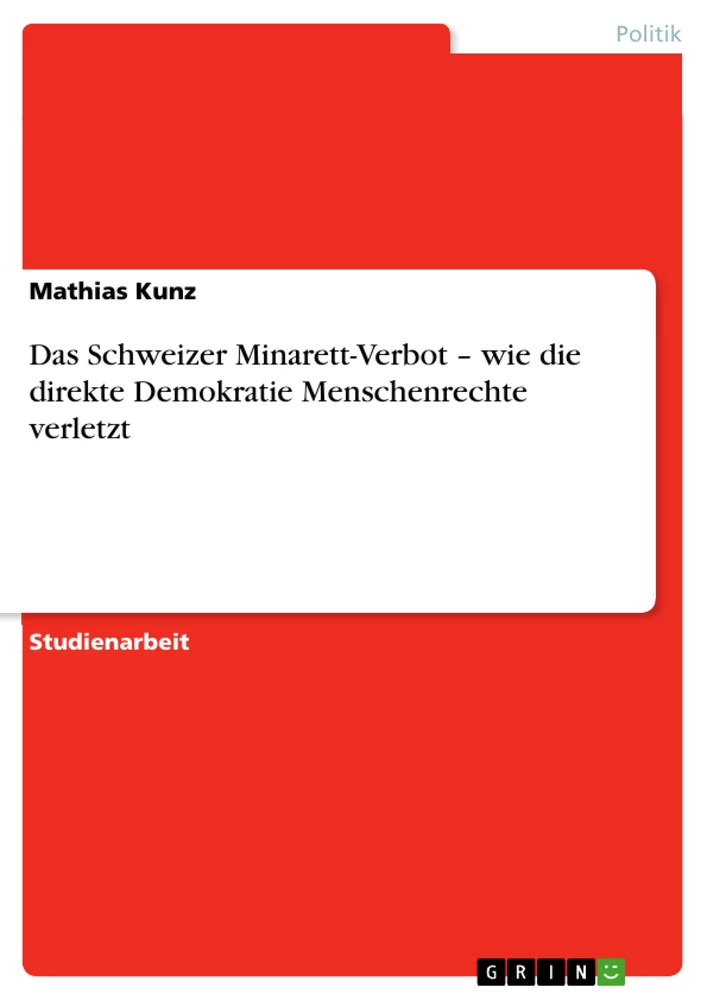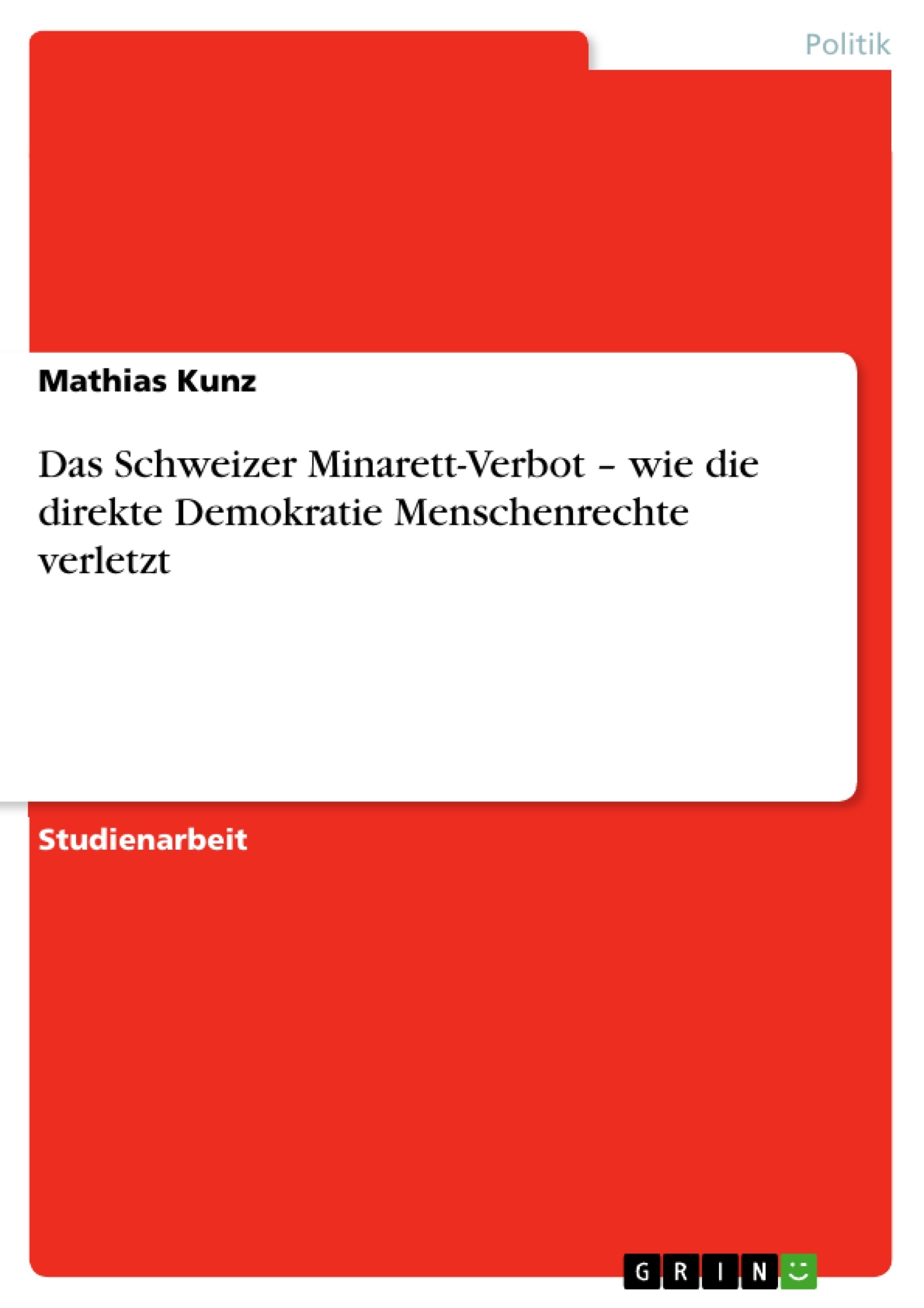Der 29. November 2009 ging zweifelsohne als besonderer Tag in die Geschichte der Schweiz ein, welcher weltweite Empörung, aber auch Jubelschreie bei Europas rechtspopulistischen Parteien hervorrief. An diesem Datum entschieden die Eidgenossen über die Initiative „Gegen den Bau von Minaretten“ und stimmten dieser mit eindeutigen 57,5 Prozent zu. Seitdem gilt in der Schweiz ein generelles Bauverbot von Minaretten, von welchen der sogenannte „Gebetsrufer“ oder auch Muezzin das islamische Gebet verkündet.
National wie international rief dieses Abstimmungsergebnis vor allem Empörung, Unverständnis sowie Besorgnis hervor. Bis auf die Schweizerische Volkspartei (SVP), die zusammen mit der Eidgenössischen Demokratischen Union (EDU) diese Initiative lanciert hatte, distanzierten sich alle etablierten Parteien sowie die Regierung der Schweiz vom Ergebnis dieser Abstimmung. Im Vorfeld warnten Parteien wie die Sozialdemokratische Partei (SP) sogar vor den Folgen dieser Abstimmung, weshalb aus nationaler Sicht überwiegend Besorgnis über die weitere Entwicklung nach der Abstimmung existierte.
International hagelte es überwiegend Kritik an der Schweiz. Europäische Staaten, die Vereinigten Staaten von Amerika (USA), die arabische Welt, die Vereinten Nationen (VN) sowie viele Weitere kritisierten das Ergebnis und bezeichneten es als „klar diskriminierend“ , da es das Menschenrecht der Religionsfreiheit eindeutig einschränke. Einige Länder wie die Türkei und Pakistan forderten sogar eine Rücknahme dieser Entscheidung. Wieder andere wie die rechtspopulistischen Parteien Front National (FN) in Frankreich, die Partei für die Freiheit (PVV) in den Niederlanden sowie die italienischen Regierungspartner von Lega Nord und Popolo della Libertà (PdL) begrüßten das Schweizer Ergebnis und forderten in ihren Ländern ähnliche Beschlüsse.
Es blieb in der Folgezeit allerdings offen, wie in einem demokratischen Land wie der Schweiz, das weltweit als Vorzeigemodell der direkten Demokratie galt, Menschenrechte so eklatant eingeschränkt werden konnten?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die direkte Demokratie – eine Begriffsdefinition.
- Die Menschenrechte – eine mögliche Definition.
- Die Vorgeschichte zum Schweizer Minarett-Verbot
- Mögliche Erklärungen für das Abstimmungsverhalten
- Fazit..
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht das Schweizer Minarett-Verbot von 2009 und analysiert, wie die direkte Demokratie in diesem Fall zu einer Verletzung von Menschenrechten führte.
- Direkte Demokratie als Staatsform und ihre Funktionsweise
- Das Menschenrecht auf Religionsfreiheit und seine Bedeutung
- Die Vorgeschichte und Hintergründe des Schweizer Minarett-Verbots
- Analyse des Abstimmungsverhaltens und möglicher Ursachen
- Bewertung der Auswirkungen des Verbots auf die Menschenrechte
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt das Minarett-Verbot in der Schweiz vor und beleuchtet die kontroversen Reaktionen im In- und Ausland.
- Die direkte Demokratie – eine Begriffsdefinition: Dieses Kapitel definiert die direkte Demokratie im weiteren und engeren Sinne und beleuchtet ihre historische Entwicklung sowie potentielle Probleme.
- Die Menschenrechte – eine mögliche Definition: Der Fokus liegt auf dem Menschenrecht der Religionsfreiheit und seiner Bedeutung in demokratischen Gesellschaften.
- Die Vorgeschichte zum Schweizer Minarett-Verbot: Dieser Abschnitt beschreibt die Initiative "Gegen den Bau von Minaretten" und erläutert die politischen und gesellschaftlichen Hintergründe.
- Mögliche Erklärungen für das Abstimmungsverhalten: Dieses Kapitel untersucht mögliche Ursachen für das Abstimmungsergebnis und analysiert die Rolle von Meinungsbildung und Propaganda.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die direkte Demokratie, Menschenrechte, Religionsfreiheit, das Schweizer Minarett-Verbot, Abstimmungsverhalten, politische Kultur und Rechtspopulismus.
Häufig gestellte Fragen
Wann fand die Abstimmung über das Minarett-Verbot in der Schweiz statt?
Die Eidgenossen stimmten am 29. November 2009 über die Initiative „Gegen den Bau von Minaretten“ ab.
Wie war das Ergebnis der Volksabstimmung?
Die Initiative wurde mit einer deutlichen Mehrheit von 57,5 Prozent der Stimmen angenommen.
Warum wurde das Minarett-Verbot international kritisiert?
Kritiker, darunter die UN und viele europäische Staaten, sahen in dem Verbot eine klare Diskriminierung und eine Einschränkung des Menschenrechts auf Religionsfreiheit.
Welche Parteien unterstützten die Initiative in der Schweiz?
Die Initiative wurde maßgeblich von der Schweizerischen Volkspartei (SVP) und der Eidgenössischen Demokratischen Union (EDU) lanciert.
Kann direkte Demokratie Menschenrechte verletzen?
Der Fall zeigt das Spannungsfeld auf, in dem Mehrheitsentscheidungen der Bevölkerung im Widerspruch zu völkerrechtlich geschützten Grundrechten von Minderheiten stehen können.
- Quote paper
- Mathias Kunz (Author), 2012, Das Schweizer Minarett-Verbot – wie die direkte Demokratie Menschenrechte verletzt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/263122