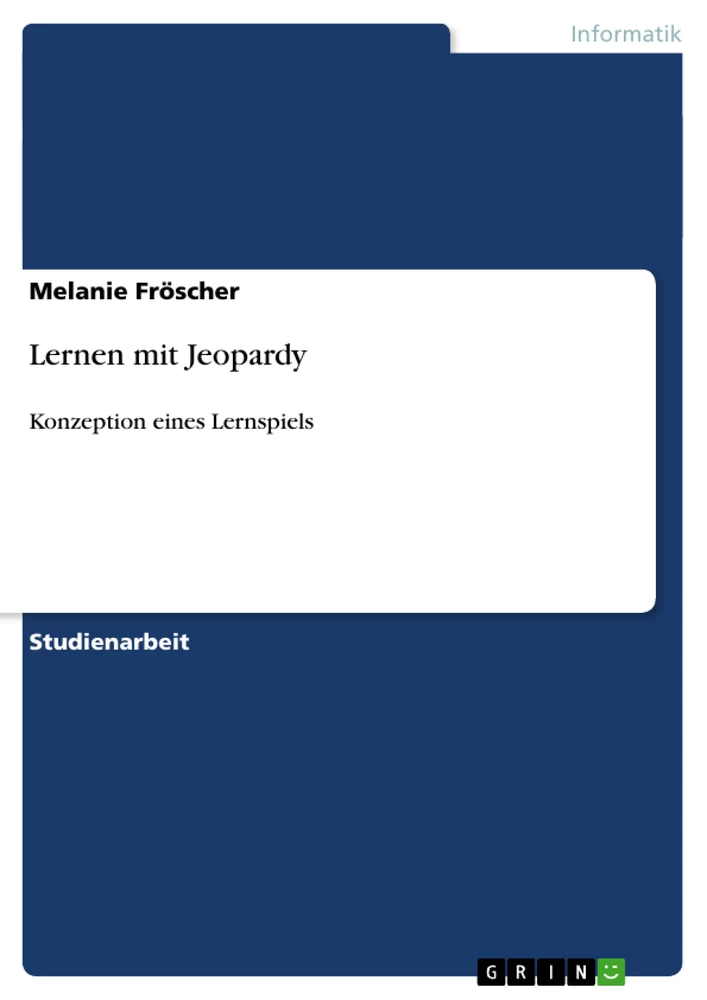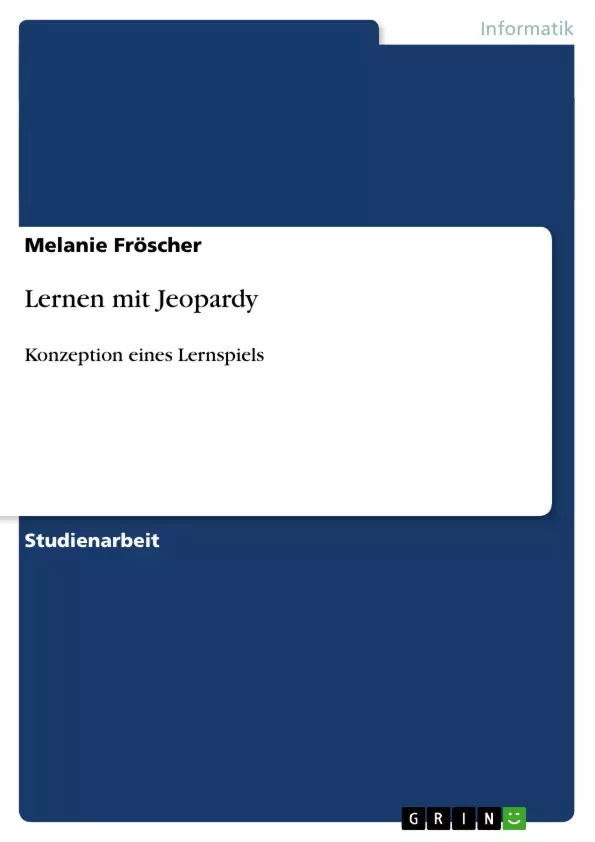In dieser Arbeit soll ein Lernspiel für die DHBW Mannheim auf Basis der bekannten TV-Serie „Jeopardy!“ entwickelt werden. Dabei handelt es sich um eine wissenschaftliche Arbeit mit Forschungscharakter.
Die Arbeit ist in 3 Teile gegliedert: Teil A beschreibt den wissenschaftlichen Hintergrund und erläutert Forschungsergebnisse, die im Zuge der Entwicklung beachtet werden sollen. Teil B beinhaltet die Konzeption der Anwendung unter Berücksichtigung der in Teil A gewonnenen Erkenntnisse. Teil C erläutert die technische Realisierung und geht näher auf die tatsächliche Umsetzung ein.
Inhaltsverzeichnis
- Motivation
- Teil A: Wissenschaftlicher Hintergrund
- Menschliche Informationsverarbeitung
- Aufnahme von Informationen
- Verarbeitung von Informationen (Duale Codierungstheorie)
- Speicherung von Informationen (3-Speicher-Modell)
- Ultrakurzzeitgedächtnis
- Kurzzeitgedächtnis
- Langzeitgedächtnis
- Organisation von Informationen (Schematisierung)
- Cognitive-Load-Theorie (Chandler und Sweller 1991)
- Quellen der kognitiven Belastung
- Ziele
- SOI-Modell (Selektion, Organisation, Integration)
- Zusammenfassung
- Lernen
- Problemstellungen
- Richtlinien zur Konzeption von Lernumgebungen
- Die Bedeutung der Konzentration
- Die Bedeutung der Motivation
- Lernstrategien
- Der Lernort
- Die Lernziele
- Zusammenfassung
- Lernen und Spiel
- Spiel versus Realität
- Spielend lernen (Game-based Learning)
- Lernspiele (Serious Games)
- "Drill und Practise"
- "Planspiele und Simulationen"
- "Advanture Games"
- Anforderungen an ein Lernspiel
- Klassifizierung von Lernspielen
- Beispiel
- "Wer wird Millionär" (Quiz)
- "Jeopardy!" (Quiz)
- Modell für das Lernen mit Spielen
- Komponenten
- Bezug zu wissenschaftlichen Erkenntnissen
- Teil B: Konzeption
- Projektgegenstand
- Ausgangssituation
- Soll-Zustand
- Einsatzbereich und Ziele
- Anforderungsanalyse
- Produktumfang
- Einschränkungen
- Lösungseinschränkungen
- Finanzielle Einschränkungen
- Abgrenzungskriterien
- Konzeption auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse
- Anforderungen gemäß menschlicher Informationsverarbeitung
- Anforderungen gemäß Lernen allgemein
- Anforderungen gemäß Aspekte des Lernspiels
- Spielidee
- Aufbau des Spiels
- Spielkategorien
- Spiellevel
- Einstellungen (Menü)
- Spielverlauf
- Spielziele
- Klassifizierung des Spiels
- Aufbau des Spiels
- Spielfunktionen
- Menü anzeigen und schließen
- Spielparameter setzen
- Hilfe einsehen
- Spiel starten und stoppen
- Frage anzeigen, beantworten und Antwort einsehen
- Ergebnis anzeigen
- Spiellogik
- Anforderungen
- Fragestruktur
- Antwort in Freitextform (Freestyle)
- Antwort in Auswahlform (Multiple Choice)
- Antwort in Zahlform (Numeric)
- Antwort in Frageform (QuestionIsAnswer)
- Auswertung der Antworten
- Auswertung Antworten in Freitextform (Freestyle)
- Auswertung Antworten in Auswahlform (Multiple Choice)
- Auswertung Antworten in Zahlform (Numeric)
- Auswertung von Antworten in Frageform (QuestionIsAnswer)
- Auswertung von Antworten in Ja-Nein-Form (YesNo)
- Themenauswahl
- Themenauswahl durch Benutzer
- Automatische Themenauswahl
- Spielmodi
- Lernmodus
- Prüfungsmodus
- Datenmanagement
- Anforderungen
- Art der Daten
- Datenmodell
- Datenspeicherung
- Struktur der Daten
- Fragenkataloge
- Konfigurationsdaten
- Spieldatei
- Benutzeroberfläche
- Anforderungen
- Layout
- GUI-Komponenten
- HeaderView
- ShortMenu View
- GameInfoView
- MenuView
- QuestionFieldView
- QuestionCardViews
- ResultWindowView
- Teil C: Technische Realisierung
- Architektur
- Anforderungen
- Art der Anwendung
- Komponenten
- Menü (Menu)
- Spielfeld (Question Field)
- Datenmodell (Model)
- Allgemeine Daten (Common)
- Dienste (Services)
- Technologie
- Möglichkeiten
- Adobe Flash
- Sun JavaFX
- Microsoft Silverlight
- Gegenüberstellung
- Allgemeiner Überblick
- Vor- und Nachteile
- Erfüllung der Anforderungen
- Entscheidung
- Möglichkeiten
- Microsoft Silverlight
- MVVM
- Komponenten
- MVVM
- Architektur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Studienarbeit befasst sich mit der Konzeption eines Lernspiels auf Basis des bekannten Quizformats "Jeopardy!". Das Ziel ist es, die Möglichkeiten des Game-based Learning für den Einsatz im Bildungsbereich zu untersuchen und ein spielerisches Konzept zu entwickeln, welches die Motivation und den Lernerfolg von Nutzern steigern kann.
- Menschliche Informationsverarbeitung und deren Bedeutung für das Lernen
- Die Rolle der Spielmechanik und -gestaltung im Kontext von Lernspielen
- Entwicklung eines geeigneten Datenmodells und einer effizienten Spiellogik
- Auswahl und Implementierung der optimalen technischen Plattform
- Konzeption einer intuitiven und benutzerfreundlichen Oberfläche
Zusammenfassung der Kapitel
- Motivation: Dieses Kapitel beleuchtet die Ausgangssituation und den Hintergrund der Arbeit, indem es die Bedeutung von effizienten Lernmethoden und den potenziellen Beitrag von Lernspielen hervorhebt.
- Teil A: Wissenschaftlicher Hintergrund: Dieser Teil der Arbeit beschäftigt sich mit den relevanten theoretischen Grundlagen der menschlichen Informationsverarbeitung und des Lernens. Er betrachtet Themen wie die Aufnahme, Verarbeitung und Speicherung von Informationen, die Cognitive-Load-Theorie und das SOI-Modell, um einen fundierten Rahmen für die Spielentwicklung zu schaffen.
- Lernen: In diesem Kapitel werden die spezifischen Herausforderungen des Lernens und die Anforderungen an effektive Lernumgebungen betrachtet. Themen wie Konzentration, Motivation und Lernstrategien spielen dabei eine wichtige Rolle.
- Lernen und Spiel: Dieser Abschnitt analysiert die Beziehung zwischen Lernen und Spiel, untersucht die verschiedenen Arten von Lernspielen und deren Eignung für den Bildungsbereich. Das Konzept des "Game-based Learning" wird im Detail vorgestellt.
- Teil B: Konzeption: Der Fokus dieses Teils liegt auf der detaillierten Konzeption des Lernspiels "Lernen mit Jeopardy!". Hier werden die spezifischen Ziele, Anforderungen und Einschränkungen des Projekts definiert.
- Projektgegenstand: Dieser Abschnitt präsentiert die Ausgangssituation, den angestrebten Soll-Zustand und den Einsatzbereich des Lernspiels. Die Ziele werden präzise definiert.
- Anforderungsanalyse: Hier werden die Anforderungen an das Lernspiel aus verschiedenen Perspektiven betrachtet, z. B. hinsichtlich Produktumfang, Einschränkungen und der Einbeziehung wissenschaftlicher Erkenntnisse.
- Spielidee: Das Kapitel beschreibt die konkrete Spielidee und den Aufbau des Spiels, einschließlich der Spielkategorien, Level und Einstellungen.
- Spielfunktionen: Dieser Abschnitt beschreibt die einzelnen Funktionen des Lernspiels, z. B. die Menüfunktionen, die Spielsteuerung und die Anzeige von Fragen und Ergebnissen.
- Spiellogik: Hier wird die Funktionsweise der Spiellogik detailliert erklärt, einschließlich der verschiedenen Antwortformate, der Auswertung der Antworten und der Auswahl von Themen.
- Datenmanagement: Dieses Kapitel befasst sich mit der Organisation und Verwaltung der Daten, die für das Lernspiel benötigt werden, z. B. die Fragenkataloge, Konfigurationsdaten und Spieldateien.
- Benutzeroberfläche: Hier werden die Anforderungen an die Benutzeroberfläche des Lernspiels erläutert, das Layout der Oberfläche und die verschiedenen GUI-Komponenten werden beschrieben.
- Teil C: Technische Realisierung: Dieser Teil der Arbeit konzentriert sich auf die technische Umsetzung des Lernspiels. Die Architektur des Systems, die Auswahl der Technologie und die Verwendung von Programmierparadigmen werden erläutert.
- Architektur: Das Kapitel beschreibt die Architektur des Lernspiels, einschließlich der verschiedenen Komponenten und Dienste.
- Technologie: Die verschiedenen verfügbaren Technologien für die Entwicklung des Lernspiels werden vorgestellt und verglichen. Die Auswahl der optimalen Technologie wird begründet.
- Microsoft Silverlight: Dieser Abschnitt befasst sich mit der konkreten Implementierung des Lernspiels mit Microsoft Silverlight und dem Einsatz des MVVM-Paradigmas.
Schlüsselwörter
Lernspiel, Jeopardy!, Game-based Learning, menschliche Informationsverarbeitung, Cognitive-Load-Theorie, SOI-Modell, Lernstrategien, Spielmechanik, Spiellogik, Datenmanagement, Benutzeroberfläche, Architektur, Technologie, Microsoft Silverlight.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel des Lernspiels 'Jeopardy!' für die DHBW?
Ziel ist die Entwicklung einer interaktiven Anwendung zur Wissensvermittlung, die Motivation und Lernerfolg durch Spielmechaniken (Game-based Learning) steigert.
Welche Rolle spielt die Cognitive-Load-Theorie bei der Entwicklung?
Die Theorie hilft dabei, die kognitive Belastung der Lernenden zu steuern, damit Informationen optimal aufgenommen und im Langzeitgedächtnis gespeichert werden können.
Welche Antwortformate unterstützt das Jeopardy-Lernspiel?
Das Spiel bietet verschiedene Formate wie Freitext (Freestyle), Multiple Choice, numerische Antworten und die klassische "Frage-als-Antwort"-Form.
Was unterscheidet den Lernmodus vom Prüfungsmodus?
Der Lernmodus dient der spielerischen Aneignung von Wissen, während der Prüfungsmodus den Wissensstand unter Zeit- oder Erfolgsdruck evaluiert.
Welche Technologie wurde für die Umsetzung gewählt?
Die Arbeit vergleicht Technologien wie Adobe Flash und JavaFX, entschied sich jedoch für Microsoft Silverlight unter Verwendung des MVVM-Paradigmas.
- Projektgegenstand
- Menschliche Informationsverarbeitung
- Quote paper
- Melanie Fröscher (Author), 2011, Lernen mit Jeopardy, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/263218