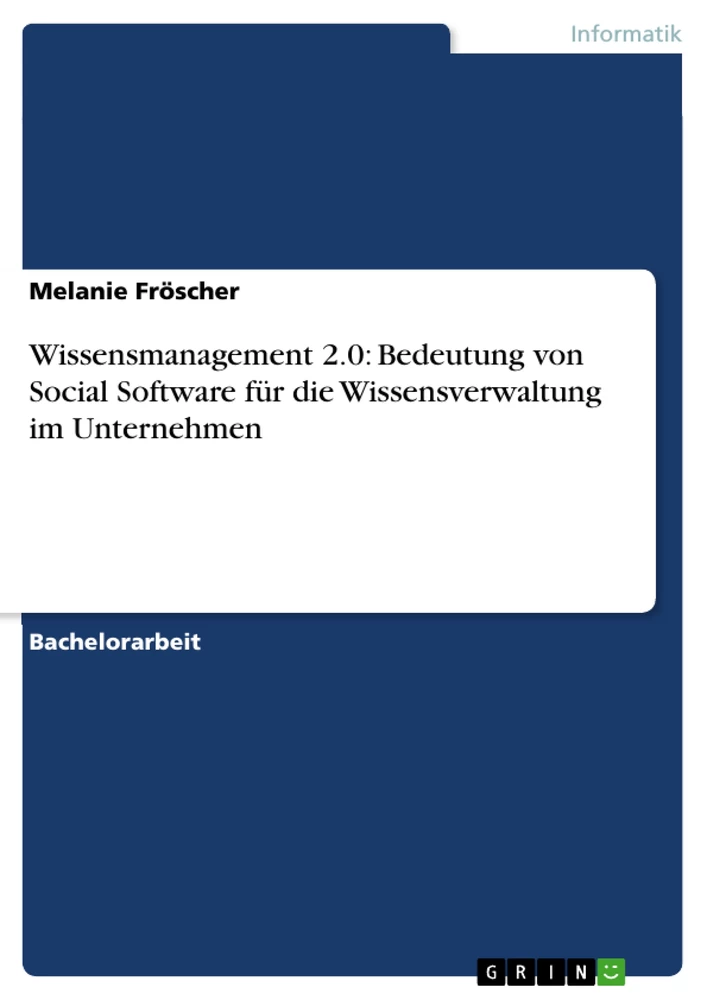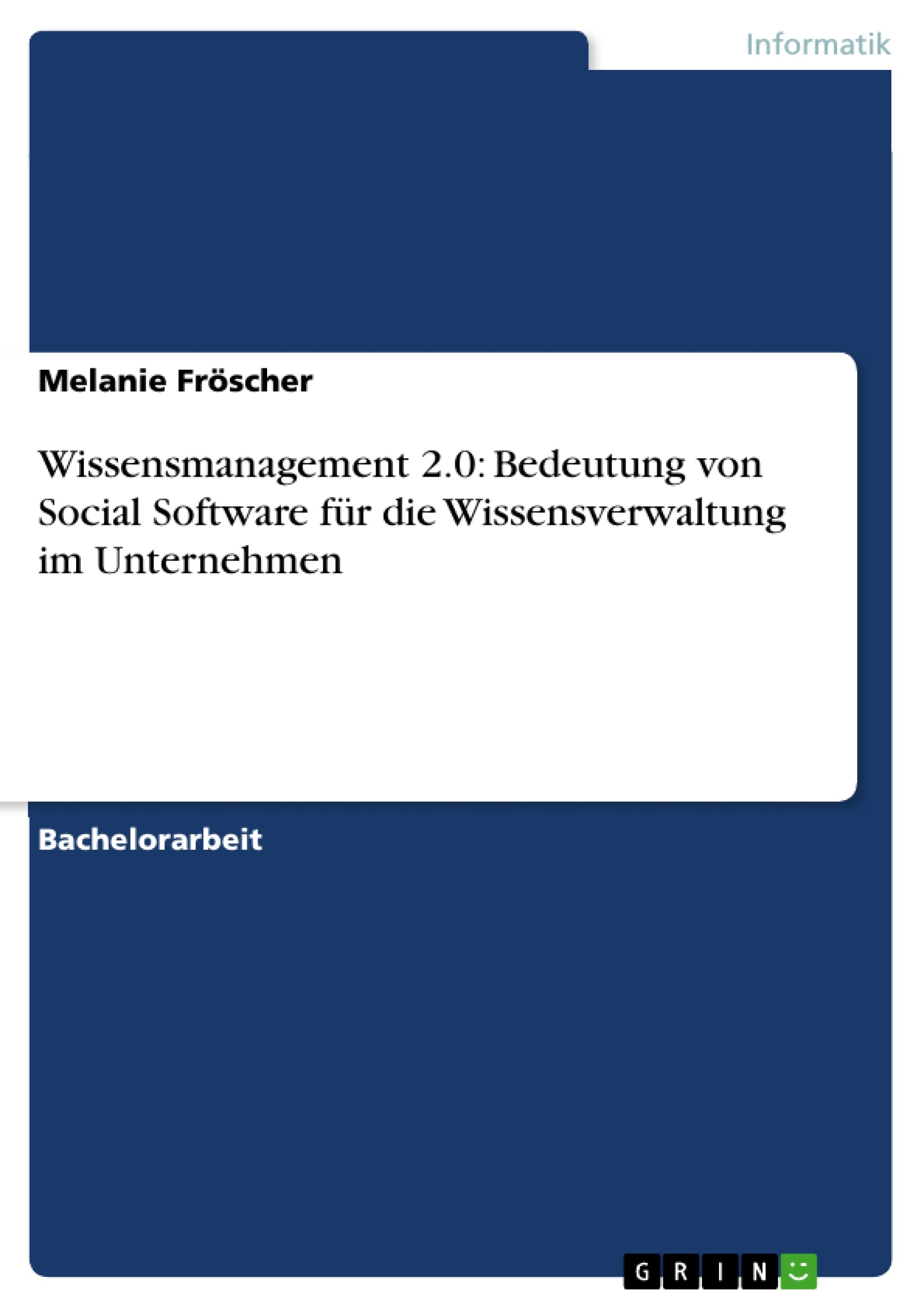Diese Arbeit behandelt das Thema des Wissensmanagement, das als interdisziplinäres Aufgabengebiet die Wissenschaften der Soziologie, Kulturforschung, Organisationslehre, Managementlehre sowie der (Wirtschafts-)Informatik umfasst. Dabei soll eine
Konvergenz zwischen den Themenbereichen der Wissenstheorie, dem traditionellen
Wissensmanagement sowie dem Enterprise 2.0 hergestellt werden, um ein effizientes Wissensmanagement auf Basis des Enterprise 2.0 zu begründen. Hierzu werden organisationale, soziokulturelle als auch informationstechnische Aspekte betrachtet und
entlang der Arbeit im jeweiligen Kontext diskutiert.
Schlüsselwörter
Wissenstheorie, Wissensdimensionen, Wissenstransformation, Wissensrepräsentation,
Wissensmanagement, Web 2.0, Wiki, Blog, Social Networking, Social Tagging, Social Bookmarking, RSS, Enterprise 2.0, Microsoft SharePoint
AUFGABENSTELLUNG
Zur Begründung des hohen Stellenwerts von Wissen und der Notwendigkeit eines
Wissensmanagement im Unternehmen sollen zunächst gesellschaftliche Anforderungen erarbeitet werden, um im weiteren Verlauf aus der Analyse der Wissenstheorie Erkenntnisse zu gewinnen, welche Voraussetzungen bzw. Anforderungen erfüllt sein müssen, um die theoretischen Grundlagen im Konzept des Wissensmanagement effizient umsetzen zu können.
Weiter sollen anhand existierender Konzepte bzw. Modelle zum Wissensmanagement
erforscht werden, welche Auswirkungen bzw. Eingriffe ein solches Konzept auf das Unternehmen hat bzw. haben kann. Dazu sollen zum einen
wissensmanagementtheoretische Aspekte aufgearbeitet als auch eine Auswahl an
Wissensmanagement-Modellen beschrieben werden, um die Anwendung bzw.
Tragweite von Wissensmanagement im Unternehmen zu verdeutlichen.
Diese Erkenntnisse sollen im Anschluss mit den Leitideen des Enterprise 2.0 in Bezug gesetzt werden, da vermehrt Kritik an den bisherigen Maßnahmen ausgeübt wird und gleichzeitig das Web 2.0 bzw. Social Software als wissensmanagementförderndes Konzept propagiert, aber nur ansatzweise aufgeführt wird. Im Anschluss sollen die Forschungsergebnisse dazu eingesetzt werden, die Tauglichkeit des Enterprise 2.0-Konzeptes zum Wissensmanagement zu beweisen. Hierzu soll eine Analyse des Zielunternehmens und deren wissensmanagementrelevanten Aspekten durchgeführt und prototypisch der Einsatz von Social Software zum Wissensmanagement aufgezeigt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Aufgabenstellung
- Zielsetzung
- Aufbau der Arbeit
- Gliederung
- Zusammenhang
- Bedeutung von Wissen in der Gesellschaft
- Gesellschaftlicher Wandel
- Informations‐ und Wissensgesellschaft
- Ursachen
- Merkmale
- Probleme und Risiken
- Wissenstheorien
- Problemstellung
- Begriffsdefinitionen
- Einflussfaktoren
- Epistemologien
- Wissensträger
- Wissensdimensionen
- Transformation von Wissen
- Betriebswirtschaftlicher Ansatz
- Pädagogisch‐psychologischer Ansatz
- Wissensrepräsentation
- Repräsentation, Organisation, Ordnung
- Methoden der Wissensrepräsentation
- Klassifikation der Wissensrepräsentation
- Anforderungen an das Wissensmanagement
- Wissensmanagement
- Handlungsfelder
- Wissensressourcen
- Klassifikation von Wissensmanagementmodellen
- Technokratisches Wissensmanagement / Wissensökologie
- Ganzheitliches Wissensmanagement/ Einseitiges Wissensmanagement
- Dimensionen des Wissensmanagement
- Modelle des Wissensmanagement
- Wissensmarktmodell nach North
- Münchener Modell nach Reinmann‐Rothmeier
- Baustein‐Modell nach Probst/Raub/Romhardt
- Instrumente des Wissensmanagement
- Repräsentation von Wissen (Identifizierung, Darstellung)
- Kommunikation und Kollaboration (Austausch, Zusammenarbeit)
- Wissensgenerierung (Erwerb, Entwicklung)
- Organisatorische Aspekte
- Problemstellungen des Wissensmanagement
- Zwischenfazit
- Web 2.0 und Enterprise 2.0
- Web 2.0
- Grundlage des Web 2.0
- Konzepte und Leitideen des Web 2.0
- Anwendungen im Web 2.0
- Technologien des Web 2.0
- Klassifizierung der Web 2.0‐Anwendungen
- Klassifizierung mit dem „Social Software Dreieck“
- Klassifizierung mit „SLATES“
- Klassifizierung mit „FLATNESSES“
- Enterprise 2.0
- Enterprise 1.0 vs. Enterprise 2.0
- Merkmale des Enterprise 2.0
- Vorteile des Enterprise 2.0
- Probleme und Risiken des Enterprise 2.0
- Wirkungsbereiche des Enterprise 2.0
- Wissensmanagement im Enterprise 2.0
- Enterprise 2.0 –Eignung zum Wissensmanagement
- Der Faktor Mensch und dessen Stellung im Unternehmen
- Der Faktor Organisation und dessen interne Struktur und Kultur
- Der Faktor Technik und dessen Tauglichkeit
- Wissenstheoretische Parallelen
- Anwendungsbereiche von Social Software
- Herausforderungen des Wissensmanagement 2.0
- Praxis – Prototyp des cWiki
- Vorgehensweise
- Bestandsaufnahme
- Organisationsstruktur
- Organisationskultur
- Arbeitsweise
- Medien
- Zu verwaltendes Wissen
- Handlungsbedarf und Anforderungen
- Konzeptentwicklung
- Strategisches Konzept
- Technisches Konzept
- Vorteile
- Technische Basis (Microsoft SharePoint)
- Architektur von Microsoft SharePoint
- Komponenten von Microsoft SharePoint
- SharePoint Enterprise Wiki
- Realisierung
- Ziele und Nutzen
- Erstellung und Vorbereitung des Wiki
- Exemplarische Inhaltserstellung
- Theoretische Eignung
- Überprüfung mit FLATNESSES
- Überprüfung der Anforderungen des Zielunternehmens
- Fazit
- Fazit und Ausblick
- Zusammenfassung der Arbeit
- Resumé der Fragestellungen
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit setzt sich mit der Frage auseinander, inwiefern das Enterprise 2.0 Konzept ein Wissensmanagement im Unternehmen unterstützt und welche Rolle dabei Social Software Anwendungen spielen. Die Arbeit fokussiert dabei auf die Implementierung und Nutzung von Social Software im Kontext der Wissensverwaltung innerhalb eines Unternehmens.
- Bedeutung von Wissen in der modernen Gesellschaft
- Wissenstheorie und deren Relevanz für das Wissensmanagement
- Modelle und Instrumente des Wissensmanagements
- Das Konzept des Enterprise 2.0 und dessen Bedeutung für die Wissensverwaltung
- Einsatz von Social Software im Unternehmen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die Aufgabenstellung, die Zielsetzung und den Aufbau der Arbeit vor.
- Bedeutung von Wissen in der Gesellschaft: Dieses Kapitel erörtert die Bedeutung von Wissen in der modernen Gesellschaft und analysiert den Wandel von der Industriegesellschaft hin zur Wissensgesellschaft.
- Wissenstheorien: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Definition von Wissen und den verschiedenen Wissenstheorien. Es werden implizites und explizites Wissen, Wissensträger und die Transformation von Wissen untersucht.
- Wissensmanagement: Dieses Kapitel stellt die Handlungsfelder des Wissensmanagements vor, darunter das normative, strategische und operative Wissensmanagement. Es werden verschiedene Wissensmanagementmodelle vorgestellt und analysiert.
- Web 2.0 und Enterprise 2.0: Dieses Kapitel definiert das Web 2.0 und das Enterprise 2.0 Konzept. Es werden die verschiedenen Konzepte, Leitideen, Anwendungen und Technologien des Web 2.0 sowie die Vorteile und Risiken des Enterprise 2.0 erläutert.
- Wissensmanagement im Enterprise 2.0: Dieses Kapitel untersucht die Eignung des Enterprise 2.0 Konzeptes für ein Wissensmanagement im Unternehmen und betrachtet die Beziehung zwischen der Wissenstheorie und den Prinzipien des Enterprise 2.0. Es werden die Anwendungsbereiche von Social Software im Wissensmanagement analysiert.
- Praxis – Prototyp des cWiki: Dieses Kapitel beschreibt die Implementierung eines Wissensmanagements auf Basis des Enterprise 2.0 in einem IT‐Unternehmensberatung. Es wird ein Prototyp eines Wiki‐Systems (cWiki) entwickelt, das auf Microsoft SharePoint basiert, um die Herausforderungen des Wissensmanagements im Zielunternehmen zu lösen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Schlüsselbegriffe Wissensmanagement, Enterprise 2.0, Social Software, Web 2.0, Wissenstheorie, Wissensdimensionen, Wissensrepräsentation und die Implementierung von Wikis im Unternehmen.
- Arbeit zitieren
- Melanie Fröscher (Autor:in), 2011, Wissensmanagement 2.0: Bedeutung von Social Software für die Wissensverwaltung im Unternehmen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/263223