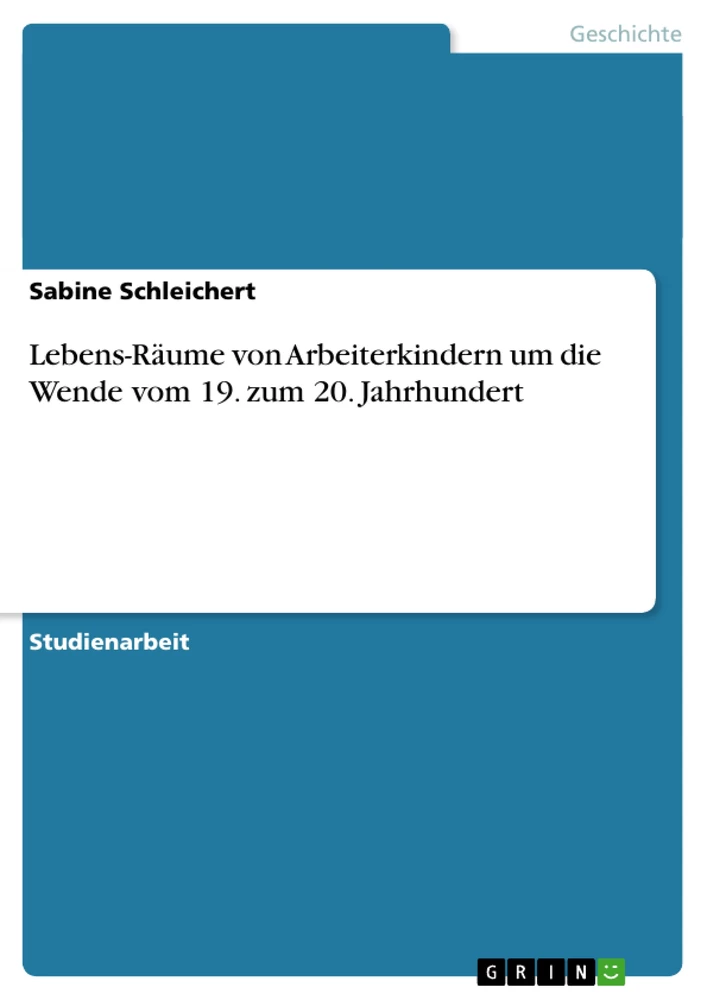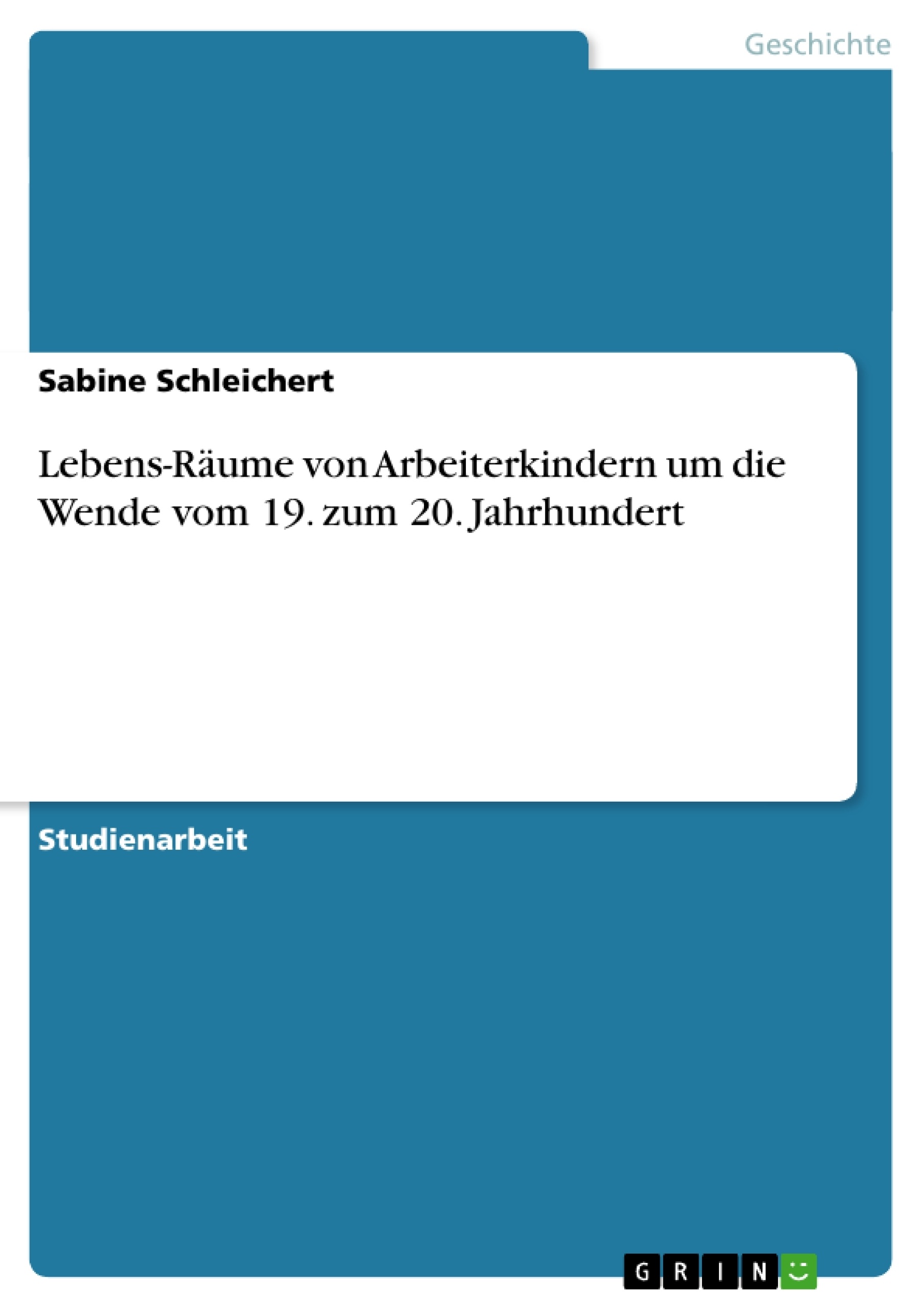Seit einigen Jahren begreift die historische und pädagogische Forschung die Lebensphase Kindheit immer mehr als in ihrem Charakter historisch bedingt und nicht als Jahrhunderte hindurch unveränderlich, wie dies früher stillschweigend vorausgesetzt worden war. Vorreiter auf diesem Gebiet war Philippe Ariès, gefolgt beispielsweise von Lloyd de Mause, Elisabeth Badinter, Ingeborg Weber-Kellermann; inzwischen ist die Zahl der Titel kaum noch übersehbar.
Zu nennen wären hier Stichworte wie die Pädagogisierung der Kindheit, ihre Wahrnehmung als eigenständige Lebensphase, die Entstehung der "Mutterliebe", das Verschwinden der Kindheit -Aspekte, die in ihrer genauen Bedeutung und Relevanz durchaus umstritten sind. Viele dieser Überlegungen und Aussagen stehen vor dem Hintergrund von Norbert Elias' Theorie vom "Prozeß der Zivilisation". Kindheit war danach wie alle anderen Bereiche und Phasen menschlicher Existenz im Laufe der Zeit einem allmählichen Prozeß der Ausdifferenzierung und Spezialisierung unterworfen. Funktionen und Lebensbereiche wie Spiel, Lernen und Arbeit, Privatsphäre und Öffentlichkeit wurden zeitlich wie räumlich immer deutlicher voneinander getrennt.
Unterschiedliche Bedingungen für Kindheit galten aber nicht nur in Abhängigkeit von der Zeit, sondern auch von den verschiedenen Bevölkerungsschichten. Kinder von Bauern lebten zwangsläufig unter völlig anderen Voraussetzungen als Bürgerkinder, Arbeiterkinder waren in eineranderen Situation als Nachkommen von Adligen.
Die folgende Untersuchung behandelt als ein Beispiel der sehr vielfältigen Beschäftigung mit der Geschichte der Kindheit die Arbeiterkindheit Ende des 19. und in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts. Es sollen die Lebens-Räume der Arbeiterkinder betrachtet werden, die Orteund Stationen also, die in ihrem Leben eine Rolle spielten, an und zwischen denen sie sich bewegtenund um die sich eine Art "subjektive Geographie" des jeweiligen Kindes entwickelte. Behnken u.a.definieren den vergleichbaren Begriff des "primären Raumes" als die "lebensgeschichtlich erste und zugleich prägende Erfahrung gesellschaftlichen Handlungsraumes".
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Charakterisierung: Wiesbadener und Leidener Arbeiterquartiere
- Die verschiedenen Orte der Kindheit
- Elternhaus und Familie
- Schule
- Arbeit und Broterwerb
- Straße
- Vereine und vergleichbare Institutionen
- Schluß
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Untersuchung befasst sich mit der Arbeiterkindheit Ende des 19. und in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts. Sie untersucht die Lebensräume der Arbeiterkinder, die Orte und Stationen ihres Lebens, und die Entstehung einer "subjektiven Geographie" in ihrer Kindheit. Die Arbeit stützt sich auf Quellen wie Arbeiterautobiographien und Ergebnisse von Studien über Arbeiterquartiere in Wiesbaden und Leiden.
- Analyse der Lebensräume von Arbeiterkindern in zwei verschiedenen Städten und Zeitepochen
- Untersuchung der Bedeutung von Orten wie Elternhaus, Schule, Arbeitsplatz und Straße für die Arbeiterkindheit
- Erforschung der "subjektiven Geographie" der Arbeiterkinder und ihrer individuellen Wahrnehmung von Räumen und sozialen Unterschieden
- Vergleich der Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Entwicklung von Kindheit in verschiedenen sozialen Schichten
- Einordnung der Ergebnisse in den Kontext von Theorien zur "Pädagogisierung" der Kindheit und dem "Prozess der Zivilisation"
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den historischen Kontext der Untersuchung dar und erläutert die Bedeutung der Kindheit als historisch bedingte Lebensphase. Sie beleuchtet die Entstehung der "Pädagogisierung" der Kindheit und die unterschiedlichen Bedingungen für Kinder aus verschiedenen Bevölkerungsschichten.
- Charakterisierung: Wiesbadener und Leidener Arbeiterquartiere: Dieses Kapitel beschreibt die spezifischen Eigenschaften der untersuchten Arbeiterquartiere in Wiesbaden und Leiden. Es analysiert die soziale Struktur, die Bebauung und die Lebensbedingungen der Arbeiterfamilien in beiden Städten.
- Die verschiedenen Orte der Kindheit: Dieses Kapitel untersucht die unterschiedlichen Lebensräume der Arbeiterkinder, wie das Elternhaus, die Schule, den Arbeitsplatz und die Straße. Es zeigt auf, wie diese Orte die Kindheit prägten und welche Bedeutung sie für die Entwicklung der "subjektiven Geographie" hatten.
Schlüsselwörter
Die Untersuchung befasst sich mit den Themen Arbeiterkindheit, Lebensräume, "subjektive Geographie", Stadtgeschichte, Sozialgeschichte, Sozialstruktur, Kindheit, Pädagogisierung, Zivilisationsprozess, Arbeit, Schule, Straße, Familie, Wiesbaden, Leiden, Autobiographien, Quellenforschung.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter der "Pädagogisierung der Kindheit"?
Es beschreibt den historischen Prozess, in dem Kindheit als eigenständige, schutzbedürftige Lebensphase wahrgenommen wurde, die gezielter Erziehung und Bildung bedarf.
Wie unterschied sich die Kindheit von Arbeiterkindern um 1900?
Im Gegensatz zu Bürgerkindern war das Leben von Arbeiterkindern stark durch Enge im Elternhaus, frühe Mitarbeit zum Broterwerb und das Leben auf der Straße geprägt.
Welche Rolle spielte die "Straße" als Lebensraum?
Die Straße war für Arbeiterkinder ein zentraler Sozialisationsraum, da die Wohnungen oft zu klein und überfüllt waren.
Welche Städte dienen als Fallbeispiele in der Untersuchung?
Die Arbeit analysiert Arbeiterquartiere in Wiesbaden (Deutschland) und Leiden (Niederlande).
Was ist eine "subjektive Geographie" des Kindes?
Es bezeichnet die individuelle Wahrnehmung und Bedeutung der verschiedenen Orte (Heim, Schule, Arbeit), zwischen denen sich ein Kind bewegt.
- Quote paper
- Sabine Schleichert (Author), 1992, Lebens-Räume von Arbeiterkindern um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/26324