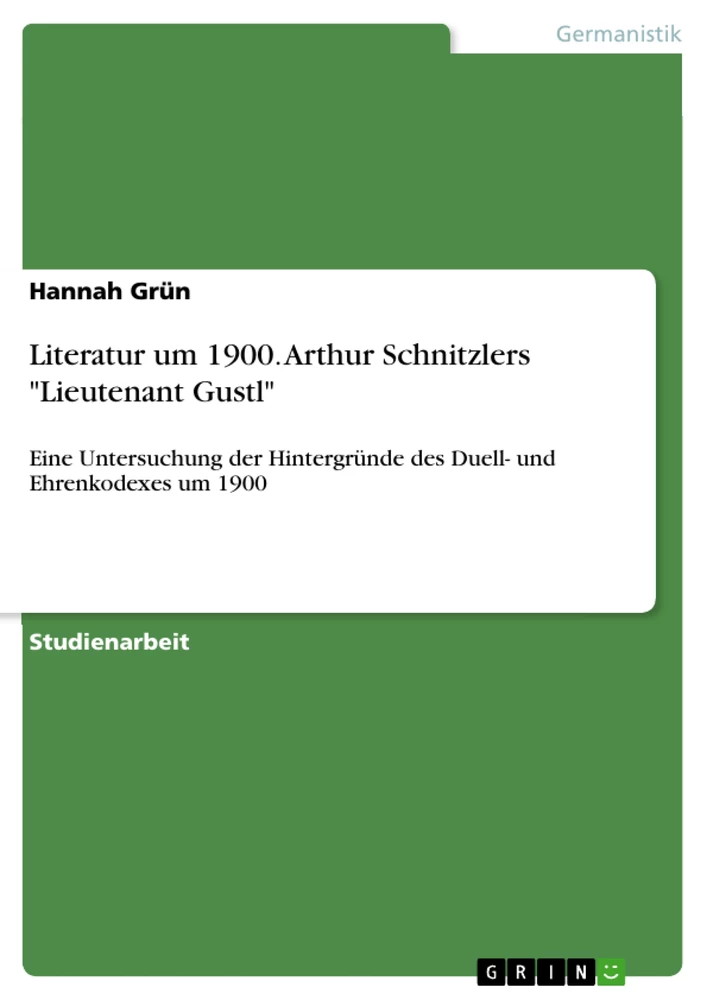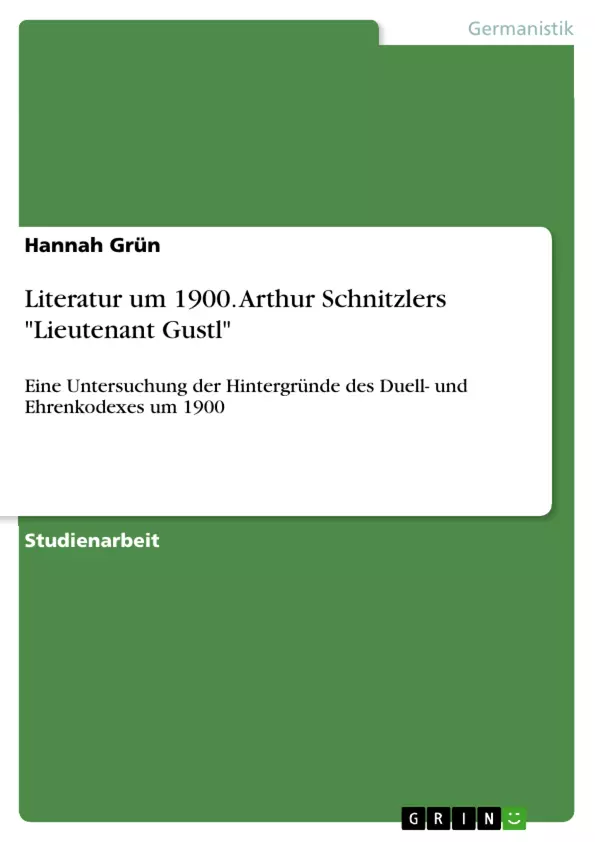Ziel dieser Arbeit ist es, anhand des Beispiels von „Lieutenant Gustl“ Hintergründe des Duellwesens zu beschreiben. Zunächst soll mit Begrifflichkeiten, sowie konkreten Interpretationsansätzen versucht werden die Basis für im Folgenden geäußerte Vermutungen zu schaffen. Aufgezeigt werden sollen danach Schnitzlers Vorbilder literarischer und thematischer Art, d.h. neben den rein formalen auch die stofflichen Vorlagen für sein Interesse an der Krise Gustls geschlossen werden, wobei zum einen die geschichtlichen, sozialen und gesellschaftlichen Umstände seiner Zeit, zum anderen die persönlichen Charakterzüge, die der Verfasser ihm verlieh, betrachtet werden sollen. Eine kurze Zusammenfassung zu Schnitzers Wirken schließt die Arbeit ab.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kurze Textarbeit mit „Lieutenant Gustl“
- Thematische Vorbilder für Gustls…
- Biografisches zu Arthur Schnitzler
- Zur Rezeptionsgeschichte von Schnitzlers Werk
- Formale Vorlagen
- Die Faszination des Duells
- Ehre, wem Ehre gebührt?
- Geschichtliche Einbettung des Duellwesens
- Individuum und Gesellschaft
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht anhand des Beispiels von „Lieutenant Gustl“ die Hintergründe des Duellwesens um 1900. Sie analysiert die Bedeutung des Ehrenkodexes, die gesellschaftlichen Normen, die Gustls Konflikt auslösen, sowie Schnitzlers literarische und thematische Vorbilder.
- Der Ehrenkodex und seine Auswirkungen auf Gustls Leben
- Die gesellschaftlichen Normen und Konventionen der Zeit
- Die Rolle der Sprache und des inneren Monologs in der Novelle
- Arthur Schnitzlers Biografie und seine literarischen Vorbilder
- Der Einfluss der politischen und sozialen Umstände auf Gustls Handlungsweise
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt Arthur Schnitzler als Autor vor und beleuchtet seine Werke im Kontext der Zeit um 1900. Sie beschreibt die Entstehung von „Lieutenant Gustl“ und die Bedeutung des inneren Monologs in der Novelle.
- Kurze Textarbeit mit Lieutenant Gustl: Dieses Kapitel analysiert die Handlung der Novelle, indem es Gustls Fauxpas und seine Reaktion darauf untersucht. Der Fokus liegt auf dem Konflikt zwischen gesellschaftlichen Normen und dem Wunsch nach persönlicher Freiheit.
- Thematische Vorbilder für Gustls…: Dieses Kapitel befasst sich mit den Vorbildern, die Schnitzler für seine Arbeit verwendete. Es werden biografische Informationen zu Schnitzler selbst, die Rezeptionsgeschichte seines Werks und formale Vorlagen beleuchtet.
- Die Faszination des Duells: Dieses Kapitel geht tiefer auf den Ehrenkodex und das Duellwesen um 1900 ein. Es analysiert die Bedeutung von Ehre, die geschichtlichen Wurzeln des Duellwesens und den Einfluss des gesellschaftlichen Umfelds auf das Individuum.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit folgenden Schlüsselbegriffen: Arthur Schnitzler, „Lieutenant Gustl“, Duellwesen, Ehrenkodex, österreich-ungarische Gesellschaft, innere Monologe, Standesunterschiede, Sprachgebrauch, Satisfaktion, Jahrhundertwende.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Arthur Schnitzlers "Lieutenant Gustl"?
Die Novelle beschreibt die innere Krise eines jungen Offiziers, der nach einer vermeintlichen Ehrverletzung durch einen Bäcker über Selbstmord nachdenkt.
Was war das Besondere an der Erzählform von "Lieutenant Gustl"?
Schnitzler nutzte konsequent den inneren Monolog, um die ungefilterten Gedanken und die psychische Verfassung des Protagonisten darzustellen.
Welche Rolle spielte das Duellwesen um 1900?
Das Duell war ein zentraler Bestandteil des militärischen Ehrenkodex. Eine Verweigerung oder die Unfähigkeit zur "Satisfaktion" führte zum gesellschaftlichen Ausschluss.
Warum konnte Gustl den Bäcker nicht zum Duell fordern?
Da der Bäcker als nicht "satisfaktionsfähig" (gesellschaftlich tieferstehend) galt, empfand Gustl die Situation als ausweglose Schande für seine Offiziersehre.
Wie kritisierte Schnitzler die Gesellschaft seiner Zeit?
Durch die Darstellung von Gustls absurden Gedankenwegen entlarvte Schnitzler die hohlen Phrasen und den starren Kodex des österreich-ungarischen Militärs.
- Quote paper
- Hannah Grün (Author), 2012, Literatur um 1900. Arthur Schnitzlers "Lieutenant Gustl", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/263530