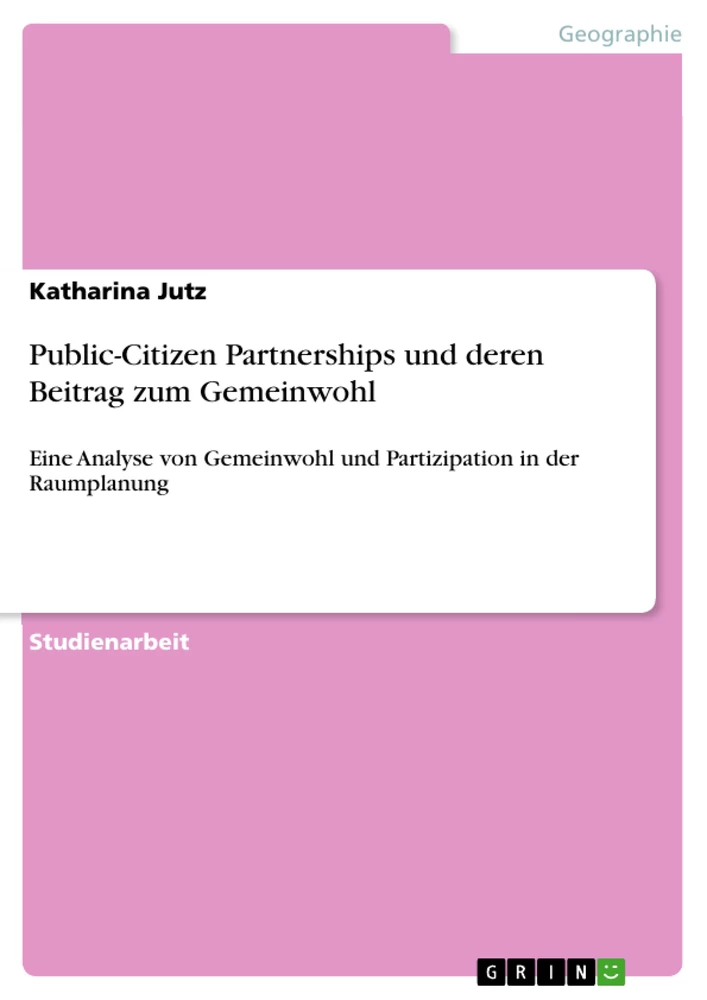Die Arbeit soll aufzeigen, welchen Beitrag sogenannte Partizipations- und Beteiligungsprozesse zu "gemeinwohlorientiertem Handeln" in der heutigen Zeit leisten können. Konkret soll dabei auf das Modell der Public-Citizen-Partnership eingegangen werden und dessen Möglichkeiten, aber auch Grenzen und Herausforderungen genauer erläutern.
Wichtig ist es dabei die Problematik des Begriffes "Gemeinwohl" aufzuzeigen, da sich das Erstellen einer allgemein gültige Begriffsbestimmung und Abgrenzung als schwer herausstellt. Der Begriff kann sehr breit gefasst werden und wird oft sehr subjektiv verwendet. Je nach persönlichen Interessen, Position und Einstellung ändert sich die Anschauung von Gemeinwohl und somit der Anspruch der zur Erreichung dessen verfolgt wird (vgl. Sonderegger 2012: 6).
Inhaltsverzeichnis
Einleitung.
1. Problemaufriss.
2. Fragestellung und Herangehensweise.
3. Das Problem mit dem Gemeinwohl
4. Public-Citizen Partnership.
4.1. Rechtsform Genossenschaft.
4.3. Voraussetzungen.
4.3. Positive Effekte.
4.4. Grenzen.
4.5. Beispiele.
4.6. Fazit.
5. Quellen- und Abbildungsverzeichnis. 16
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine Public-Citizen-Partnership?
Es handelt sich um ein Kooperationsmodell zwischen der öffentlichen Hand und Bürgern, um gemeinsam gemeinwohlorientierte Projekte umzusetzen.
Warum ist der Begriff "Gemeinwohl" problematisch?
Gemeinwohl ist schwer allgemeingültig zu definieren, da die Wahrnehmung stark von subjektiven Interessen, Positionen und persönlichen Einstellungen abhängt.
Welche Rechtsform eignet sich für Public-Citizen-Partnerships?
Die Arbeit hebt insbesondere die Rechtsform der Genossenschaft hervor, da sie Partizipation und wirtschaftliches Handeln verbindet.
Welche positiven Effekte haben diese Partnerschaften?
Sie fördern die Bürgerbeteiligung, stärken die Identifikation mit lokalen Projekten und können zur effizienteren Erreichung von Gemeinwohlzielen beitragen.
Wo liegen die Grenzen dieses Modells?
Herausforderungen liegen in rechtlichen Hürden, der Sicherstellung dauerhafter Beteiligung und möglichen Interessenkonflikten zwischen öffentlichen Akteuren und Bürgern.
- Quote paper
- BA Katharina Jutz (Author), 2013, Public-Citizen Partnerships und deren Beitrag zum Gemeinwohl, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/264226