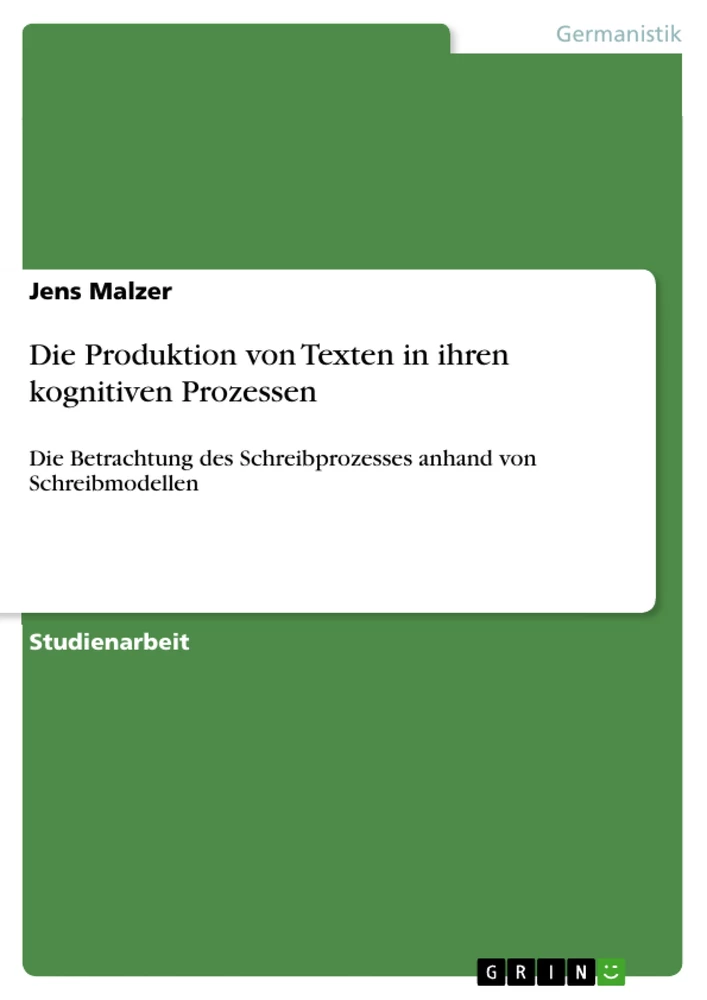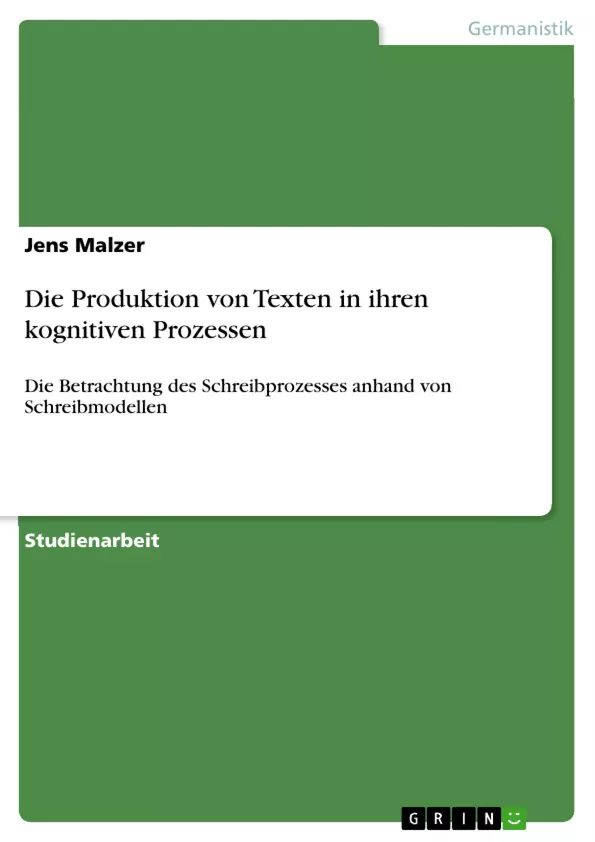Ein Schreibprozess benötigt viel Zeit, da das Schreiben normalerweise länger als das Sprechen dauert. Außerdem werden an das Arbeitsgedächtnis hohe Anforderungen gestellt. In der Schreibforschung wurden seit den 80er – Jahren mehrere Modelle entwickelt, die isoliert die einzelnen Arbeitsschritte während des Schreibprozesses darstellen. Diese Modelle fußen häufig auf kognitionspsychologische Erkenntnisse.
Diese Arbeit soll die kognitiven Prozesse, die während des Schreibens ablaufen, beschreiben. Um dies anschaulich und fundiert darzustellen, werden drei Schreibmodelle herangezogen. Es gibt eine Fülle von Schreibmodellen. Aufgrund des Rahmens dieser Arbeit muss allerdings eine Selektion stattfinden, um die wesentlichen Bestandteile herauszufiltern. Wichtig dabei ist die Frage, ob es möglich ist, das individuelle Schreiben in einem allgemeinen Schema darzustellen.
Bevor die Modelle vorgestellt und diskutiert werden, ist es aber relevant, dass Schreibdidaktische Konzepte und die Entstehung von Schreibmodellen erarbeitet werden.
Resultierend aus der Arbeit sollen didaktische Ableitungen hervorgehen, um an Erkenntnisse für die Schreibförderung zu gelangen.
Aufgrund der Thematik bietet sich eine literatursoziologische Vorgehensweise an.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Schreibdidaktische Konzepte
- Entstehung von Schreibmodellen
- Schreibmodelle
- Das kognitive Modell des Schreibens nach Hayes & Flower
- Die Struktur des Schreibprozesses nach Ludwig
- Das entwicklungspsychologische Schreibmodell nach Bereiter und Scardamalia
- Didaktische Ableitungen
- Resümee
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den kognitiven Prozessen, die während des Schreibens ablaufen. Sie analysiert drei Schreibmodelle, um die verschiedenen Phasen und Aspekte des Schreibprozesses zu beleuchten und didaktische Ableitungen für die Schreibförderung zu gewinnen.
- Die Entwicklung von Schreibmodellen im Kontext der kognitiven Wende
- Die Beschreibung und Analyse verschiedener Schreibmodelle (Hayes & Flower, Ludwig, Bereiter & Scardamalia)
- Die Identifizierung von Schlüsselmomenten und -faktoren im Schreibprozess
- Die Ableitung didaktischer Erkenntnisse für die Förderung der Schreibfähigkeiten
- Die kritische Auseinandersetzung mit den Grenzen und Möglichkeiten der Schreibmodelle
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt die Thematik der Arbeit vor und erläutert den Fokus auf die kognitiven Prozesse im Schreibprozess. Sie führt die drei Schreibmodelle ein, die im weiteren Verlauf der Arbeit analysiert werden, und verdeutlicht die Relevanz von Schreibdidaktik und der Entstehung von Schreibmodellen.
- Schreibdidaktische Konzepte: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene schreibdidaktische Konzepte, die in den 70er Jahren eingeführt wurden und für die Entstehung von Lehrplänen bedeutsam sind. Es werden Konzepte wie „expressives Schreiben", „kreatives Schreiben", „kommunikativer Ansatz" und „prozessorientierter Ansatz" vorgestellt und ihre jeweiligen Schwerpunkte und Zielsetzungen erläutert.
- Entstehung von Schreibmodellen: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung von Schreibmodellen im Kontext der kognitiven Wende. Es wird die Abwendung vom Behaviorismus und die Hinwendung zum Kognitivismus als wichtige Einflussfaktoren auf die Prozessorientierung der Schreibdidaktik dargestellt. Die Entwicklung von Schreibmodellen als Mittel zur Darstellung des Schreibens als Prozess wird erläutert und die Bedeutung des Prozedurenbegriffs für die Schreibforschung hervorgehoben.
- Schreibmodelle: Dieses Kapitel analysiert drei wichtige Schreibmodelle: das kognitive Modell des Schreibens nach Hayes & Flower, die Struktur des Schreibprozesses nach Ludwig und das entwicklungspsychologische Schreibmodell nach Bereiter und Scardamalia. Es werden die jeweiligen Modellstrukturen, Kernannahmen und Kritikpunkte ausführlich diskutiert. Das kognitive Modell von Hayes & Flower stellt den Schreibprozess als eine rekursive Abfolge von Planungs-, Formulierungs- und Revisionsphasen dar. Das Modell von Ludwig betont die Bedeutung motivationaler Bedingungen, motorischer Handlungen und situativer Faktoren im Schreibprozess. Das entwicklungspsychologische Modell von Bereiter und Scardamalia beschreibt die Entwicklung der Schreibfähigkeiten von Schreibanfängern zu Experten, indem es zwei Strategien - "Knowledge-Telling" und "Knowledge-Transforming" - unterscheidet.
- Didaktische Ableitungen: Dieses Kapitel leitet aus den analysierten Schreibmodellen didaktische Erkenntnisse für die Förderung der Schreibfähigkeiten ab. Es wird die Bedeutung von Schreibprozessen, Überarbeitungsprozessen und Beurteilungsprozessen für den Schreibunterricht hervorgehoben. Es werden konkrete Handlungsempfehlungen für die Gestaltung von Schreibaufgaben und die Unterstützung von Schreiblernenden gegeben, um die Schreibkompetenz zu fördern.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Schreibprozess, Schreibmodelle, kognitive Prozesse, Schreibdidaktik, Schreibförderung, Schreibkompetenz, Hayes & Flower, Ludwig, Bereiter & Scardamalia, Prozessorientierung, Planen, Formulieren, Revidieren, Motivation, Schreibentwicklung, Schreibstrategien, Didaktische Ableitungen.
Häufig gestellte Fragen
Welche kognitiven Prozesse laufen beim Schreiben ab?
Schreiben umfasst komplexe Prozesse wie Planen, Formulieren und Revidieren (Überarbeiten), die hohe Anforderungen an das Arbeitsgedächtnis stellen.
Was ist das Schreibmodell nach Hayes & Flower?
Es ist ein kognitives Modell, das den Schreibprozess als rekursive Abfolge von Phasen darstellt, gesteuert durch die Schreibumgebung und das Langzeitgedächtnis.
Wie unterscheiden sich Schreibanfänger von Experten?
Bereiter und Scardamalia unterscheiden zwischen „Knowledge-Telling“ (einfaches Aufschreiben von Wissen) und „Knowledge-Transforming“ (aktives Umgestalten von Wissen beim Schreiben).
Welche Rolle spielt die Motivation beim Schreiben?
Das Modell nach Ludwig betont, dass motivationale Bedingungen und situative Faktoren wesentliche Bestandteile der Struktur des Schreibprozesses sind.
Wie kann die Schreibkompetenz gefördert werden?
Durch didaktische Ansätze, die den Schreibprozess selbst in den Fokus rücken, Schreibstrategien vermitteln und Raum für Überarbeitungsprozesse geben.
- Citar trabajo
- Jens Malzer (Autor), 2012, Die Produktion von Texten in ihren kognitiven Prozessen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/265794