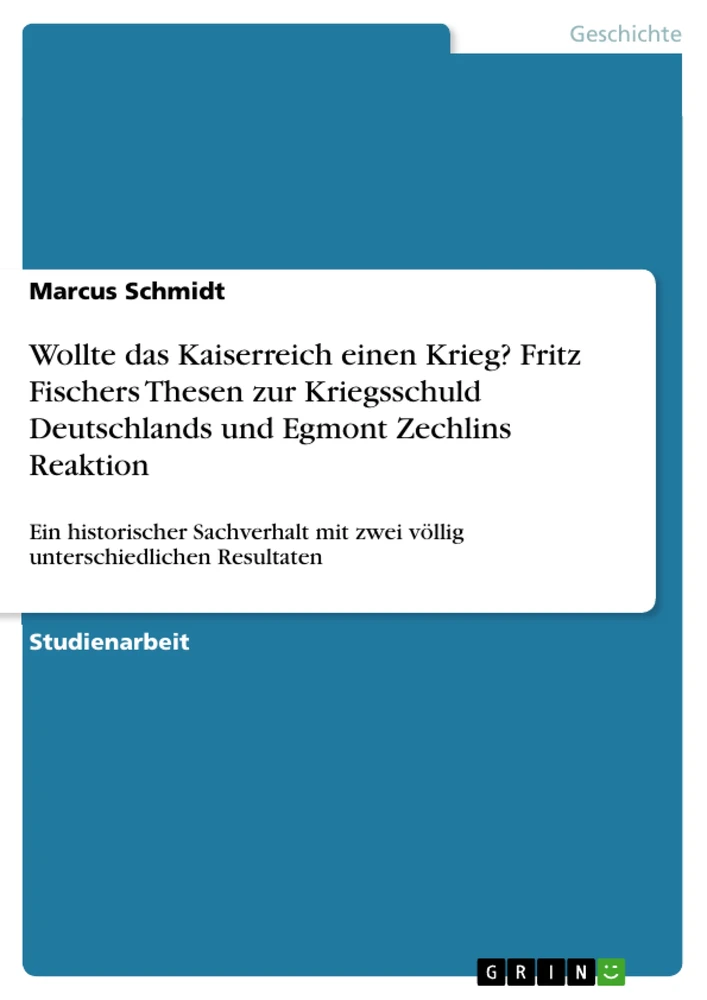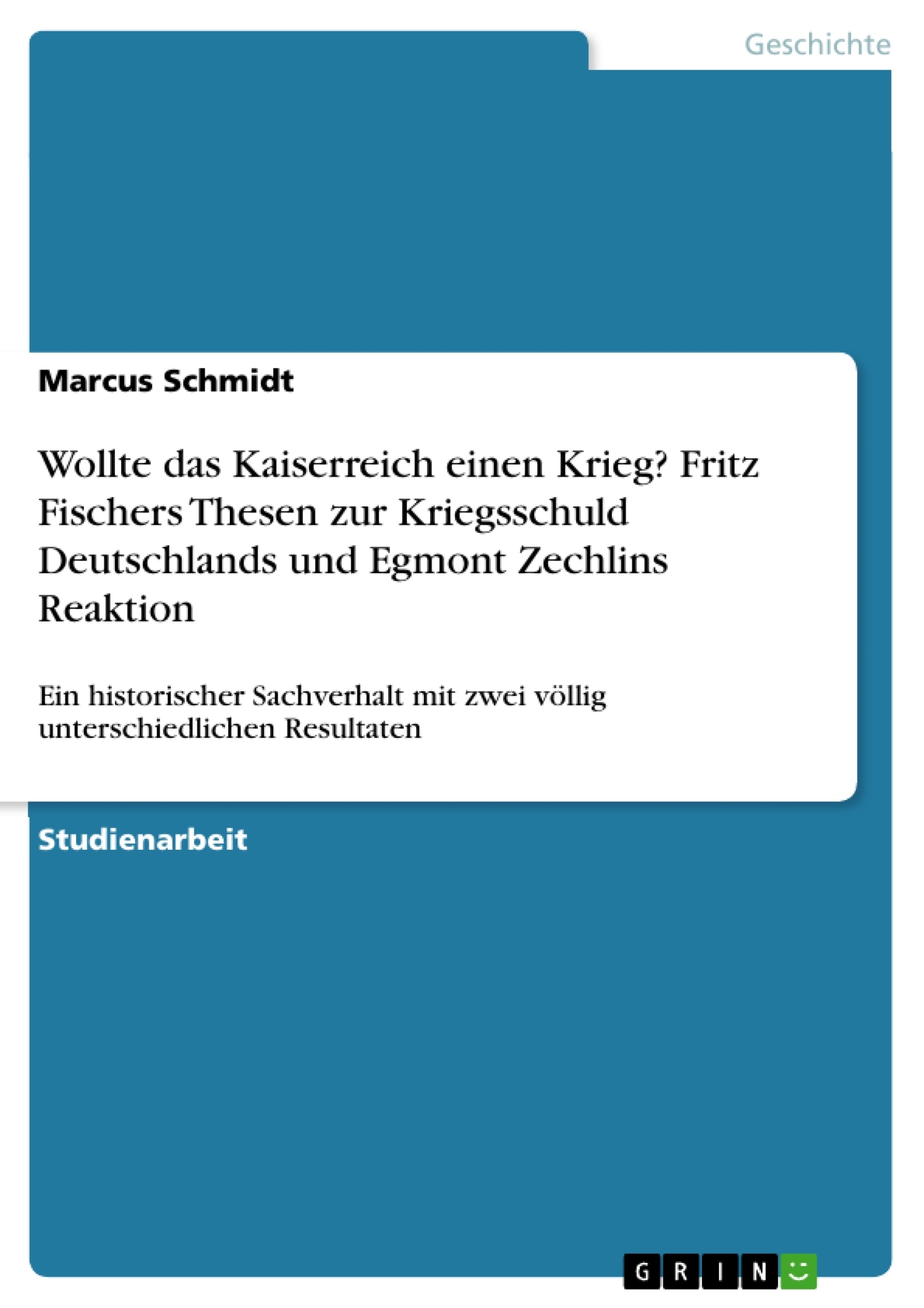In dieser Ausarbeitung sollen die im Rahmen der “Fischerkontroverse“ zur Geltung kommenden unterschiedlichen Positionen zweier wichtiger Protagonisten, nämlich die des Fritz Fischer und des Egmont Zechlin, genauer durch folgendes Thema betrachtet werden: „Wollte das Kaiserreich einen Krieg? Ein historischer Sachverhalt aber zwei völlig unterschiedliche Resultate: Fritz Fischers Thesen zur Kriegsschuld Deutschlands und Egmont Zechlins Reaktion". Dabei sollen insbesondere die unterschiedlichen Positionen in den Hauptstreitpunkten “Julikrise“ und “Septemberdenkschrift“ des Bethmann-Hollwegs hervorgehoben werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Deutsche Historiographie über den Ersten Weltkrieg
- 3. Fritz Fischers Thesen zur Kriegsschuld und die Kriegsziele des Deutschen Reiches
- 3.1. Fritz Fischer und die "Julikrise"
- 3.2. Fischers Interpretation des "Septemberprogramms" des Bethmann-Hollwegs
- 4. Egmont Zechlins Reaktion auf Fritz Fischers Thesen
- 4.1. Egmont Zechlin und die "Julikrise"
- 4.2. Egmont Zechlin und die "Septemberdenkschrift"
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die gegensätzlichen Interpretationen des Ersten Weltkriegs von Fritz Fischer und Egmont Zechlin, insbesondere hinsichtlich der Kriegsschuld Deutschlands und der Kriegsziele des Kaiserreichs. Der Fokus liegt auf dem Vergleich ihrer Ansichten zur "Julikrise" und zur "Septemberdenkschrift" von Bethmann-Hollweg.
- Die deutsche Historiographie zum Ersten Weltkrieg und ihre Entwicklung
- Fischers These der deutschen Kriegsverantwortung
- Zechlins Gegenposition und Kritik an Fischers Interpretation
- Die Rolle der "Julikrise" in den unterschiedlichen Perspektiven
- Die Bedeutung des "Septemberprogramms" für die Beurteilung der Kriegsziele
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt mit einem Zitat aus Erich Maria Remarques "Im Westen nichts Neues" die Grausamkeit des Ersten Weltkriegs ein und stellt die Frage nach Deutschlands Kriegsschuld in den Kontext des Versailler Vertrags und der nachfolgenden historischen Debatte. Sie kündigt die Analyse der gegensätzlichen Positionen von Fritz Fischer und Egmont Zechlin an, die im Mittelpunkt dieser Arbeit stehen. Die Einleitung betont die Bedeutung der "Julikrise" und der "Septemberdenkschrift" als zentrale Streitpunkte.
2. Deutsche Historiographie über den Ersten Weltkrieg: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung der deutschen Geschichtsschreibung zum Ersten Weltkrieg. Es zeigt, wie die Weimarer Republik versuchte, die deutsche Kriegsschuld zu leugnen, und wie diese Sichtweise in der deutschen Historiographie bis in die 1960er Jahre vorherrschte. Das Kapitel hebt die Bedeutung von Fritz Fischers Werk "Griff nach der Weltmacht" hervor, das diese etablierte Sichtweise in Frage stellte und eine langjährige Kontroverse auslöste. Es skizziert die anschließende Entwicklung der deutschen Weltkriegsforschung, mit einem verstärkten Fokus auf sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Aspekte sowie die zunehmende Bedeutung der Alltags- und Mentalitätsgeschichte.
3. Fritz Fischers Thesen zur Kriegsschuld und die Kriegsziele des Deutschen Reiches: Dieses Kapitel stellt Fritz Fischers zentrale These vor: Das Kaiserreich habe den Krieg bewusst herbeigeführt und positive Kriegsziele verfolgt. Fischers Interpretation der "Julikrise" und des "Septemberprogramms" werden hier beleuchtet. Seine Argumentation, die Deutschland nicht in einem Verteidigungskrieg, sondern in einer offensiven Politik sah, die den Krieg als Mittel zur Erreichung von Machtpositionen einsetzte, wird detailliert dargestellt. Der Fokus liegt auf der Analyse von Fischers Argumentation und ihren Implikationen.
Schlüsselwörter
Erster Weltkrieg, Kriegsschuld, Fritz Fischer, Egmont Zechlin, Julikrise, Septemberprogramm, Bethmann-Hollweg, Deutsche Historiographie, Kriegsziele, Kaiserreich, Historikerkontroverse, Verteidigungskrieg, Weltmachtpolitik.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zu: Analyse der gegensätzlichen Interpretationen des Ersten Weltkriegs von Fritz Fischer und Egmont Zechlin
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die divergierenden Interpretationen des Ersten Weltkriegs von Fritz Fischer und Egmont Zechlin. Im Mittelpunkt stehen die gegensätzlichen Ansichten beider Historiker zur deutschen Kriegsschuld und den Kriegszielen des Kaiserreichs, insbesondere im Hinblick auf die "Julikrise" und das "Septemberprogramm" von Bethmann-Hollweg.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung der deutschen Historiographie zum Ersten Weltkrieg, Fischers These der deutschen Kriegsverantwortung, Zechlins Kritik an Fischers Interpretation, die Rolle der "Julikrise" in den unterschiedlichen Perspektiven und die Bedeutung des "Septemberprogramms" für die Beurteilung der Kriegsziele. Es wird ein Vergleich der Ansichten beider Historiker zu diesen zentralen Punkten vorgenommen.
Wer sind Fritz Fischer und Egmont Zechlin?
Fritz Fischer und Egmont Zechlin sind zwei bedeutende deutsche Historiker, die sich kontrovers über die Interpretation des Ersten Weltkriegs auseinandergesetzt haben. Fischer vertrat die These der deutschen Kriegsverantwortung, während Zechlin diese These kritisch hinterfragte und eine gegensätzliche Interpretation anbot.
Welche Rolle spielen die "Julikrise" und das "Septemberprogramm"?
Die "Julikrise" und das "Septemberprogramm" (auch bekannt als "Septemberdenkschrift") bilden zentrale Streitpunkte in der Auseinandersetzung zwischen Fischer und Zechlin. Beide Historiker interpretierten diese Ereignisse unterschiedlich und nutzten ihre Interpretationen, um ihre jeweiligen Thesen zur Kriegsschuld und den Kriegszielen zu stützen.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur deutschen Historiographie zum Ersten Weltkrieg, Kapitel zu Fischers und Zechlins Interpretationen, ein Fazit und ein Literaturverzeichnis (implizit). Die Kapitel zu Fischer und Zechlin analysieren deren Ansichten zur "Julikrise" und dem "Septemberprogramm" im Detail.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die gegensätzlichen Interpretationen des Ersten Weltkriegs von Fischer und Zechlin zu untersuchen und zu vergleichen. Der Fokus liegt auf der Analyse ihrer unterschiedlichen Perspektiven bezüglich der Kriegsschuld und der Kriegsziele des Deutschen Reiches, unter besonderer Berücksichtigung der "Julikrise" und des "Septemberprogramms".
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Erster Weltkrieg, Kriegsschuld, Fritz Fischer, Egmont Zechlin, Julikrise, Septemberprogramm, Bethmann-Hollweg, Deutsche Historiographie, Kriegsziele, Kaiserreich, Historikerkontroverse, Verteidigungskrieg, Weltmachtpolitik.
Welche Zusammenfassung der Kapitel wird gegeben?
Es werden Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel gegeben, die die zentralen Argumente und den Fokus jedes Kapitels hervorheben. Die Einleitung stellt den Kontext dar, das zweite Kapitel die Entwicklung der deutschen Geschichtsschreibung zum Ersten Weltkrieg, das dritte Kapitel Fischers Thesen und das vierte Kapitel Zechlins Gegenposition.
- Quote paper
- Marcus Schmidt (Author), 2013, Wollte das Kaiserreich einen Krieg? Fritz Fischers Thesen zur Kriegsschuld Deutschlands und Egmont Zechlins Reaktion, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/265903