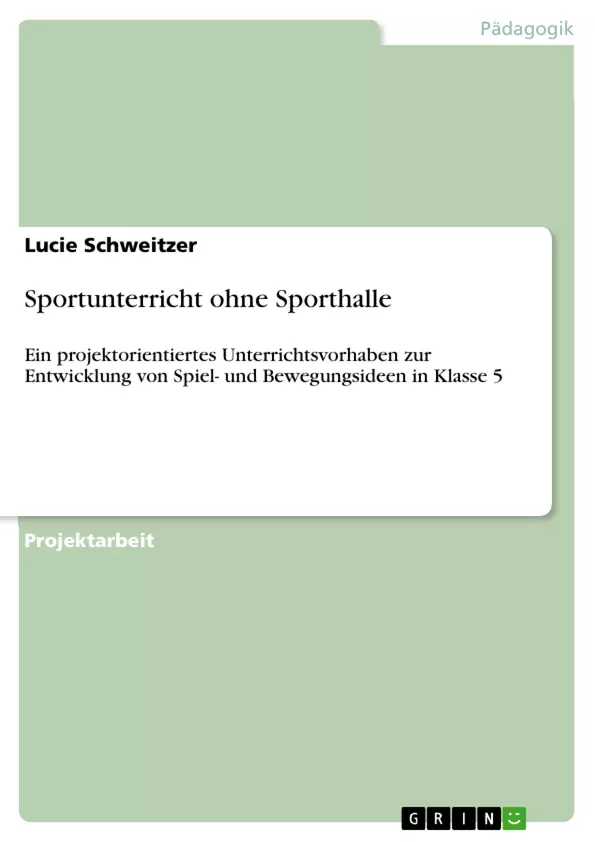„Bessere Noten durch Bewegung“ titelt die Süddeutsche Zeitung am 3.1.2012, im nachstehenden Artikel wird die Relation von geistiger Leistungsfähigkeit und sportlicher Betätigung erörtert. Die These, dass Jugendliche, die Sport treiben, damit ihre Leistungen in der Schule fördern, wird anhand der wissenschaftlichen Erkenntnisse bestätigt: „Es besteht ein deutlicher Zusammenhang zwischen mehr körperlicher Betätigung und besseren schulischen Leistungen.“
Eigentlich eine gute Nachricht – wenn da nicht die alarmierenden Ergebnisse von Studien zum Fitnesszustand von Kindern und Jugendlichen wären: In der Tageszeitung Die Welt war am 31.1.2011 zu lesen: „PC schlägt Sport: Immer mehr Kinder haben motorische Defizite“ oder in selbiger Zeitung einige Monate später: „Negativer Trend: Bewegungsmangel setzt deutschen Kindern zu.“ Regelmäßig wird die Gesellschaft mit Schlagzeilen dieser Art konfrontiert, deren einhelliger Tenor besagt, dass sich Kinder und Jugendliche in der heutigen Zeit nicht ausreichend bewegen. Nicht zuletzt spricht auch der Bildungsplan 2010 von „(…) einer Umwelt, die den Schülerinnen und Schülern immer weniger natürliche Bewegungsanlässe bietet (…).“ Welche Folgen die unzureichende Bewegung mit sich bringt ist längst kein Geheimnis mehr: Haltungsschwächen, Konzentrationsschwierigkeiten oder Übergewicht – um nur einige wenige zu nennen.
Andererseits sind Tendenzen auszumachen, die in die gänzlich andere Richtung zu gehen scheinen: Auffällig viele Kinder und Jugendliche zelebrieren auf der Straße neuste Trendsportarten oder sind bereits in jungen Jahren Mitglied eines Sportvereins. Es fragt sich, welchen Familien die Finanzierung der Beiträge ohne weiteres möglich ist oder welche Familien tatsächlich Leistungen des Bildungspaketes in Anspruch nehmen? Die Welt diskutiert in ihrem Artikel vom April 2011 „Wenn der Staat den Sportverein bezahlt“ die Möglichkeiten von Zuschüssen sozial bedürftiger Familien.
Lehrkräften kommt innerhalb des Spannungsfeldes dieses teils kontroversen Diskurses die bedeutsame Aufgabe zu, allen Schülern und Schülerinnen eine adäquate Förderung ihrer Entwicklung sowie ihres Bewegungsverhaltens zu ermöglichen. „Beim Übergang zwischen Kindheit und Erwachsenenalter haben praktische Lebenserfahrungen enorme Rückwirkungen auf Einstellungen und Gewohnheiten aus, die oftmals ein Leben lang beibehalten werden.“ Diese Chance muss genutzt werden!
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Themenfindung
- Voraussetzungen für das Unterrichtsvorhaben
- Rahmenbedingungen
- Zusammensetzung und Beschreibung der Klasse
- Uberlegungen zum Inhalt und zur Sache
- Entwicklung einer Zielperspektive
- Nennung der zu fördernden Kompetenzen
- Ziele zur Erreichung der Kompetenzen
- Plausibilisierung - Bezug zum Bildungsplan
- Legitimation — Relevanz für die Schülerinnen
- Uberlegungen zur Lernmethodik
- Projektorientierter Unterricht
- Inhaltliche Darstellung
- Skizzierter Gesamtüberblick
- Darstellung der Vorgehensweise
- Reflexion
- Fazit
- Literaturangaben
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das vorliegende Dokument stellt die Dokumentation eines projektorientierten Unterrichtsvorhabens im Fach Sport dar, das im Rahmen der 2. Staatsprüfung für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen entstanden ist. Die Lehreranwärterin Lucienne Schweitzer setzt sich in ihrem Projekt mit der Frage auseinander, wie Sportunterricht ohne Sporthalle in der 5. Klasse gestaltet werden kann. Das Vorhaben zielt darauf ab, Spiel- und Bewegungsideen zu entwickeln und den Schülerinnen die Möglichkeit zu geben, den Prozess der Spielentwicklung und Ideenfindung intensiv zu erleben.
- Sport ohne Sporthalle: Möglichkeiten, Chancen und Risiken
- Entwicklung eigener Spiel- und Bewegungsideen
- Motivation zum lebenslangen Sporttreiben
- Kooperatives Lernen und Teamarbeit
- Kreativität und Eigeninitiative
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die Problematik des Bewegungsmangels bei Kindern und Jugendlichen und setzt dies in Bezug zum Bildungsplan 2010, der die Bedeutung von Sport als Lebensprinzip betont. Die Autorin erläutert die Entstehung ihres Projektes, das aus der Notlage entstand, keine Sporthalle nutzen zu können. Sie stellt die Leitfragen des Projektes vor und erklärt, warum sie den Sportunterricht in das Klassenzimmer verlagert hat.
- Voraussetzungen für das Unterrichtsvorhaben: In diesem Kapitel werden die Rahmenbedingungen des Projektes beschrieben, die sich auf die Nutzung des Klassenzimmers und die Entscheidung, auf Umziehen und Duschen zu verzichten, beziehen. Außerdem werden die Schülerinnen der Klasse 5a und 5b vorgestellt, ihre Interessen und ihre bisherigen Erfahrungen im Sportunterricht.
- Uberlegungen zum Inhalt und zur Sache: Dieses Kapitel analysiert die einzelnen Elemente des Vorhabens, die sich auf die Bedeutung von Bewegung in der Schule, den Einsatz von Alltagsmaterialien und die Trendsportart Sport Stacking beziehen. Die Autorin erläutert, wie diese Elemente zur Förderung der Schülerinnen beitragen können.
- Entwicklung einer Zielperspektive: In diesem Kapitel werden die Kompetenzen des Fächerverbundes MSG herausgearbeitet, die im Rahmen des Vorhabens gefördert werden sollen. Die Autorin definiert die fachlichen, methodischen und personal-sozialen Ziele, die mit dem Vorhaben erreicht werden sollen. Sie erläutert die Plausibilisierung des Vorhabens im Hinblick auf den Bildungsplan und die Relevanz für die Schülerinnen.
- Uberlegungen zur Lernmethodik: Dieses Kapitel befasst sich mit der Lernmethodik des projektorientierten Unterrichts. Die Autorin erläutert die Merkmale des projektorientierten Unterrichts und zeigt auf, wie diese im Rahmen des Vorhabens zum Tragen kommen.
- Inhaltliche Darstellung: In diesem Kapitel wird der Aufbau der Einheit detailliert beschrieben. Die Autorin stellt den Stundenplan vor und erläutert die Vorgehensweise in den einzelnen Unterrichtseinheiten. Sie beschreibt die Materialien, die Spiele und die Aktivitäten, die in den einzelnen Stunden durchgeführt wurden.
- Reflexion: In diesem Kapitel reflektiert die Autorin das Unterrichtsvorhaben aus ihrer eigenen Perspektive. Sie bewertet die Haltung der Schülerinnen, die Motivation und die Ergebnisse des Projektes. Sie analysiert die Chancen und Risiken des Sportunterrichts im Klassenzimmer und geht auf die unfreiwillige Planungsabweichung aufgrund der vorzeitigen Wiedereröffnung der Sporthalle ein.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Sportunterricht ohne Sporthalle, die Entwicklung von Spiel- und Bewegungsideen, den projektorientierten Unterricht, die Förderung von Kompetenzen im Fächerverbund MSG, die Motivation zum lebenslangen Sporttreiben, die Nutzung von Alltagsmaterialien und die Trendsportart Sport Stacking. Der Text beleuchtet die Möglichkeiten und Herausforderungen des Sportunterrichts in veränderten Raumsituationen und zeigt die Bedeutung von Kreativität, Eigeninitiative und Kooperation für die Schülerinnen.
Häufig gestellte Fragen
Wie kann Sportunterricht ohne Sporthalle stattfinden?
Durch die Nutzung des Klassenzimmers für bewegungsorientierte Projekte wie Sport Stacking oder die Entwicklung eigener Spielideen mit Alltagsmaterialien.
Was ist Sport Stacking?
Eine Trendsportart, bei der Becher in einer bestimmten Reihenfolge so schnell wie möglich gestapelt und wieder abgebaut werden, was Koordination und Konzentration fördert.
Welche Vorteile bietet projektorientierter Sportunterricht?
Er fördert Eigeninitiative, Kreativität und kooperatives Lernen, da Schüler aktiv an der Gestaltung der Spielinhalte beteiligt sind.
Warum ist Bewegung in der Schule so wichtig?
Studien zeigen einen deutlichen Zusammenhang zwischen körperlicher Betätigung und verbesserter geistiger Leistungsfähigkeit sowie schulischem Erfolg.
Was sind Alltagsmaterialien im Sportunterricht?
Gegenstände wie Zeitungen, Becher oder Stühle, die zweckentfremdet werden können, um auch in kleinen Räumen Bewegungsanlässe zu schaffen.
- Quote paper
- Lucie Schweitzer (Author), 2012, Sportunterricht ohne Sporthalle, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/266500