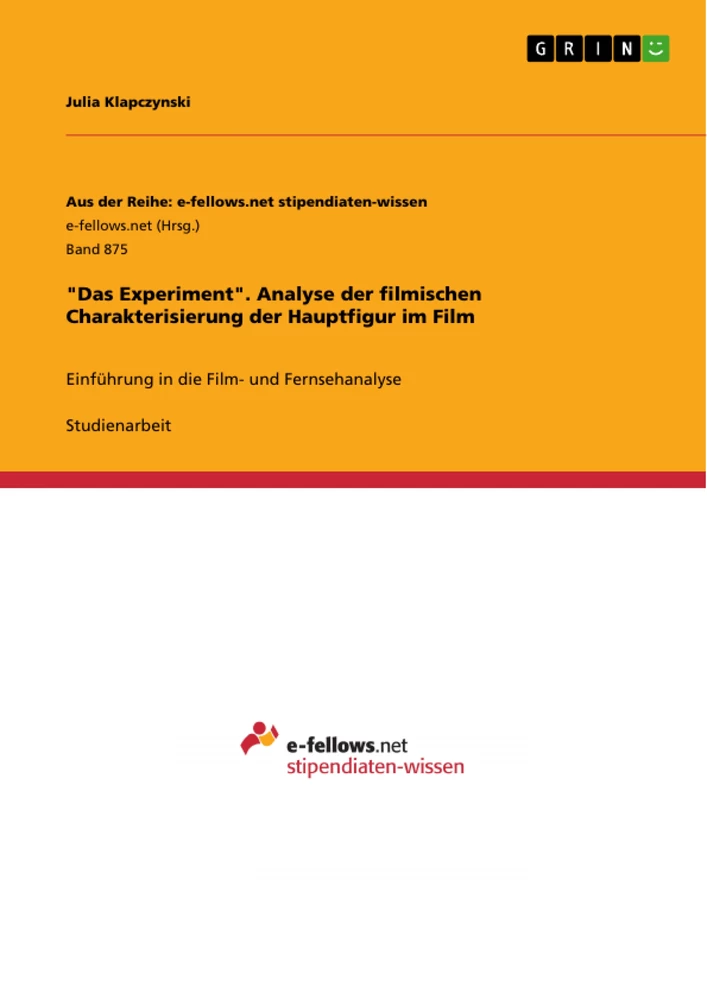In dieser Arbeit werden zunächst die theoretischen Grundlagen der Figurencharakteristik im Rahmen der Film- und Fernsehanalyse beleuchtet. Im praktischen Teil wird eine Figurencharakteristik von Tarek Fahd aus dem deutschen Film "Das Experiment" erstellt, flankiert von einem Filmsequenzprotokoll von "Das Experiment".
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung — Ziel und Struktur der Arbeit
- Theoretische Grundlagen
- Zum Begriff der Charakteristik
- Zur Relevanz des Erstellens einer Figurencharakteristik innerhalb der Filmanalyse
- Die filmische Charakterisierung — Modi der Vermittlung von figuralen Merkmalen
- Entwurf einer Methodik zur Erstellung einer Charakteristik von Filmfiguren
- Die Figurenbiographie
- Die Figurenhandlung
- Die Figurenbeziehungen
- Die Figurenpsyche
- Das Figurenerscheinungsbild
- Die Charakteristik erweiternde filmtheoretische Reflexionen
- Praktische Anwendung am Film „Das Experiment": Charakteristik von Tarek Fahd
- Zusammenfassung der wichtigsten filmischen Informationen über Tarek
- Detaillierte Analyse von Tareks filmischer Charakterisierung
- Fazit und Ausblick
- Quellen- und Literaturverzeichnis
- Filmsequenzprotokoll
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der filmischen Charakterisierung der Hauptfigur Tarek Fahd im Film „Das Experiment" von Oliver Hirschbiegel. Ziel der Arbeit ist es, eine umfassende Charakteristik der Figur zu erstellen, die in Relation zur filmischen Handlung und zur Zuschauerrezeption gesetzt wird. Die Analyse konzentriert sich dabei auf die filmischen Mittel, die zur Darstellung von Tareks Charakter eingesetzt werden.
- Freiheitsliebe
- Gerechtigkeitsempfinden
- Willensstärke und Mut
- Sensibilität und Mitgefühl
- Mehrdimensionalität und Lebendigkeit der Figur
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung — Ziel und Struktur der Arbeit: Die Arbeit stellt das Stanford Prison Experiment als Ausgangspunkt für die Analyse der filmischen Charakterisierung in „Das Experiment" vor. Die Verfasserin erläutert die Zielsetzung der Arbeit und skizziert die Struktur der Abhandlung.
- Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Begriff der Charakteristik und der Relevanz der Figurencharakterisierung innerhalb der Filmanalyse. Die Verfasserin erläutert verschiedene Modi der Vermittlung von figuralen Merkmalen im Film und entwickelt eine Methodik zur Erstellung einer Charakteristik von Filmfiguren, die sich auf die Figurenbiographie, Figurenhandlung, Figurenbeziehungen, Figurenpsyche und das Figurenerscheinungsbild konzentriert.
- Praktische Anwendung am Film „Das Experiment": Charakteristik von Tarek Fahd: Dieser Abschnitt widmet sich der detaillierten Analyse der filmischen Charakterisierung von Tarek Fahd. Zunächst werden die wichtigsten filmischen Informationen über die Figur zusammengefasst. Anschließend erfolgt eine tiefergehende Analyse von Tareks Charaktereigenschaften, die sich auf seine Freiheitsliebe, sein Gerechtigkeitsempfinden, seine Willensstärke, seine Sensibilität und seine Mehrdimensionalität konzentriert. Die Verfasserin beleuchtet dabei, wie Tareks Charakter die Handlung des Films beeinflusst und welche Beziehungsangebote er an das Publikum richtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die filmische Charakterisierung, die Hauptfigur Tarek Fahd, den Film „Das Experiment", die Freiheitsliebe, das Gerechtigkeitsempfinden, die Willensstärke, die Sensibilität, die Mehrdimensionalität und die Lebendigkeit der Figur. Die Arbeit untersucht, wie Tareks Charakter die Handlung des Films beeinflusst und welche Beziehungsangebote er an das Publikum richtet. Die Analyse bezieht sich dabei auf verschiedene filmische Mittel, die zur Darstellung von Tareks Charakter eingesetzt werden.
- Quote paper
- Julia Klapczynski (Author), 2009, "Das Experiment". Analyse der filmischen Charakterisierung der Hauptfigur im Film, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/266606