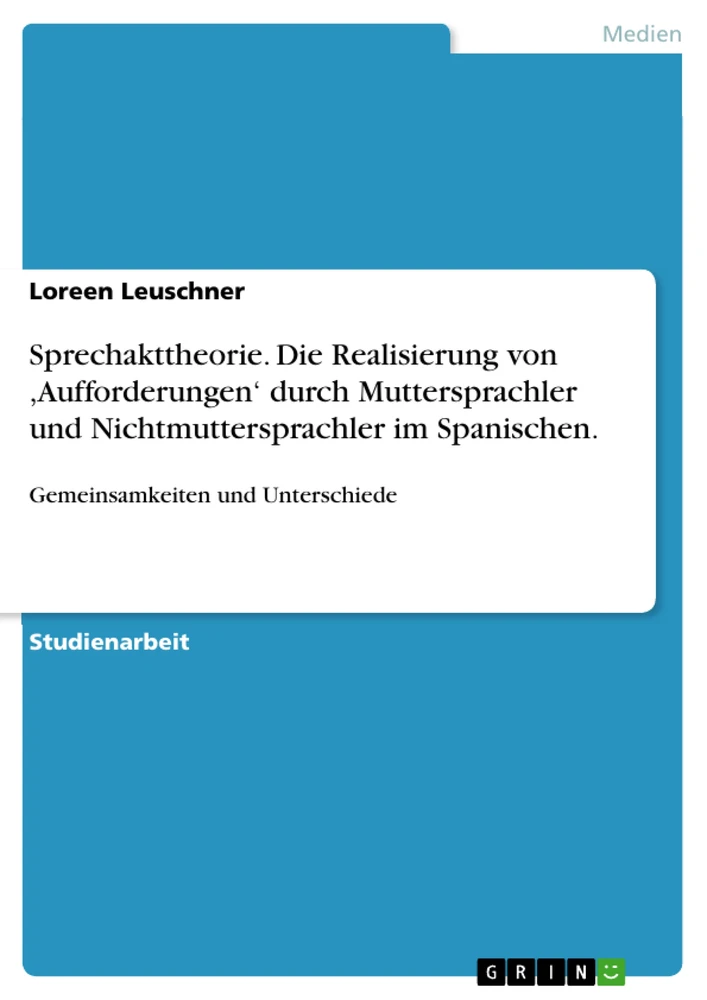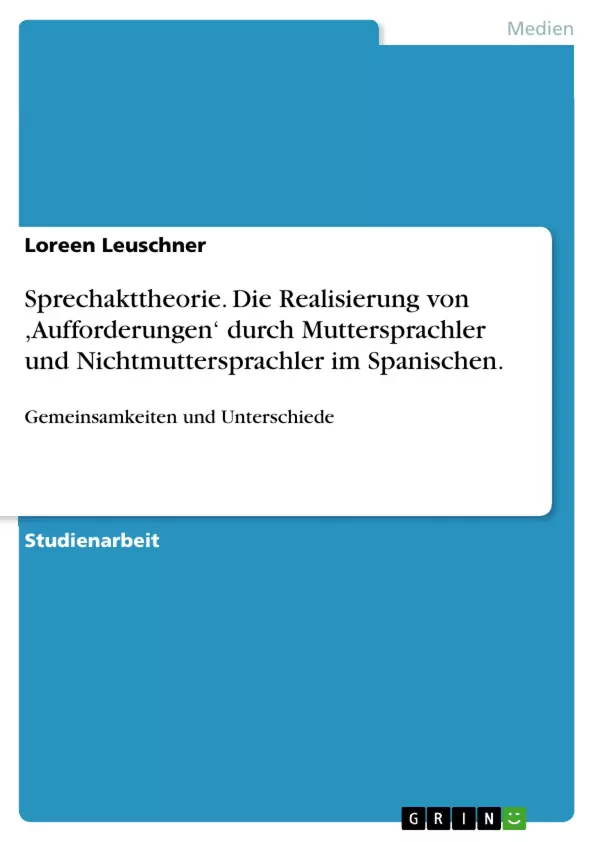Empirische Studien belegen, dass die Realisierungsmuster für Sprechakte kulturell gefärbt sind, was zugleich bedeutet, dass sich auch die Interpretationsstrategien und Erwartungen an eine Sprechhandlung von Kultur zu Kultur unterscheiden können.
Besonders die Verwendung indirekter Sprechakte kann in der interkulturellen Kommunikation zu Verständigungsproblemen führen. Aus diesem Grund werden diese Sprechakte, genauer der direktive Sprechakttyp ,Aufforderung‘, in dieser Arbeit eingehend betrachtet.(...)
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sprechakttheorie
- Sprechakttheorie (Searle)
- Searles Klassifikation illokutionärer Akte
- Direkte und Indirekte Sprechakte (am Beispiel von Direktiva)
- Aufforderungen: Interkulturelle Unterschiede im Grad der Direktheit
- Studien zu Aufforderungsstrategien im Spanischen (NS, NNS)
- Forschungsinteresse und Datenerhebung
- Datenanalyse
- Ergebnisse
- Ergebnisdarstellung: Studie von Rob le Pair
- Ergebnisdarstellung: Studie von J. César Félix-Brasdefer
- Zusammenfassung der beiden Studien
- Schluss
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Realisierung von Aufforderungen im Spanischen, insbesondere die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Muttersprachlern und Nichtmuttersprachlern. Der Fokus liegt auf dem Direktheitsgrad von Aufforderungen und den möglichen Ursachen für Verständigungsprobleme in interkultureller Kommunikation. Die Arbeit beleuchtet die Sprechakttheorie als theoretischen Hintergrund und analysiert empirische Studien zu diesem Thema.
- Sprechakttheorie und ihre Anwendung auf interkulturelle Kommunikation
- Direkte und indirekte Sprechakte, speziell Aufforderungen
- Interkulturelle Unterschiede im Gebrauch von Aufforderungen
- Einfluss der Muttersprache auf die Wahl von Aufforderungsstrategien
- Mögliche Ursachen für Missverständnisse in der interkulturellen Kommunikation im Kontext von Aufforderungen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Sprechakte und deren Bedeutung in der Pragmalinguistik ein. Sie kritisiert die verallgemeinernde Annahme universeller pragmatischer Prinzipien und betont die kulturelle Färbung der Realisierung von Sprechakten. Der Fokus liegt auf indirekten Sprechakten, insbesondere Aufforderungen, und deren potenziellen Problemen in der interkulturellen Kommunikation. Die Arbeit kündigt die Betrachtung zweier Studien an, die den Direktheitsgrad von Aufforderungen bei Muttersprachlern und Nichtmuttersprachlern des Spanischen vergleichen.
Sprechakttheorie: Dieses Kapitel gibt einen kurzen Überblick über die Sprechakttheorie, insbesondere die Theorie von Searle. Es werden die vier Teilakte (lokutionärer, propositionaler, illokutionärer und perlokutionärer Akt) erläutert und anhand von Beispielsätzen veranschaulicht. Der Schwerpunkt liegt auf dem illokutionären Akt, der den Zweck des Sprechakts bestimmt und im Kontext der Aufforderung im nächsten Kapitel relevant wird. Die Theorie dient als theoretischer Rahmen für die Analyse der nachfolgenden Studien.
Studien zu Aufforderungsstrategien im Spanischen (NS, NNS): Dieses Kapitel präsentiert und analysiert zwei empirische Studien, die den Gebrauch von Aufforderungen bei spanischen Muttersprachlern und Nichtmuttersprachlern (Niederländisch und Amerikanisch) vergleichen. Es untersucht, ob die Wahl der Aufforderungsstrategien lernertypische Phänomene oder muttersprachliche Einflüsse widerspiegelt und welche Unterschiede zu Missverständnissen in der interkulturellen Kommunikation führen könnten. Die Ergebnisse beider Studien werden detailliert untersucht und verglichen.
Schlüsselwörter
Sprechakttheorie, Searle, Direkte und indirekte Sprechakte, Aufforderungen, Interkulturelle Kommunikation, Muttersprachler, Nichtmuttersprachler, Spanisch, Direktheit, Verständigungsprobleme, Empirische Studien.
Häufig gestellte Fragen (FAQ): Analyse von Aufforderungsstrategien im Spanischen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Realisierung von Aufforderungen im Spanischen, insbesondere die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Muttersprachlern (NS) und Nichtmuttersprachlern (NNS). Der Fokus liegt auf dem Direktheitsgrad von Aufforderungen und den Ursachen für mögliche Verständigungsprobleme in der interkulturellen Kommunikation.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf die Sprechakttheorie, insbesondere die Theorie von Searle. Die vier Teilakte (lokutionär, propositional, illokutionär, perlokutionär) werden erläutert und auf Aufforderungen angewendet. Der Schwerpunkt liegt auf dem illokutionären Akt als bestimmender Faktor des Sprechakts.
Welche Aspekte der Sprechakttheorie werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Searles Klassifikation illokutionärer Akte, den Unterschied zwischen direkten und indirekten Sprechakten (am Beispiel von Direktiva), und insbesondere interkulturelle Unterschiede im Grad der Direktheit von Aufforderungen.
Welche empirischen Studien werden analysiert?
Die Arbeit analysiert zwei empirische Studien, die den Gebrauch von Aufforderungen bei spanischen Muttersprachlern und Nichtmuttersprachlern (Niederländisch und Amerikanisch) vergleichen. Die Studien untersuchen, ob lernertypische Phänomene oder muttersprachliche Einflüsse die Wahl der Aufforderungsstrategien bestimmen und welche Unterschiede zu Missverständnissen führen können.
Welche Studien werden im Detail vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert und vergleicht detailliert die Ergebnisse der Studien von Rob le Pair und J. César Félix-Brasdefer, welche den Direktheitsgrad von Aufforderungen bei NS und NNS des Spanischen untersuchen.
Welche Ergebnisse werden in den Studien dargestellt?
Die Ergebnisse der analysierten Studien zeigen Unterschiede im Direktheitsgrad von Aufforderungen zwischen NS und NNS des Spanischen auf. Die Arbeit untersucht, ob diese Unterschiede auf lernertypische Phänomene oder muttersprachliche Einflüsse zurückzuführen sind und welche Auswirkungen sie auf die interkulturelle Kommunikation haben.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen über die Bedeutung der Sprechakttheorie für das Verständnis interkultureller Kommunikation und die Herausforderungen, die der unterschiedliche Gebrauch von Aufforderungen mit sich bringt. Sie zeigt die Bedeutung der Berücksichtigung kultureller Faktoren bei der Analyse von Sprechakten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Sprechakttheorie, Searle, Direkte und indirekte Sprechakte, Aufforderungen, Interkulturelle Kommunikation, Muttersprachler, Nichtmuttersprachler, Spanisch, Direktheit, Verständigungsprobleme, Empirische Studien.
- Quote paper
- B.A. Loreen Leuschner (Author), 2013, Sprechakttheorie. Die Realisierung von ,Aufforderungen‘ durch Muttersprachler und Nichtmuttersprachler im Spanischen., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/266729