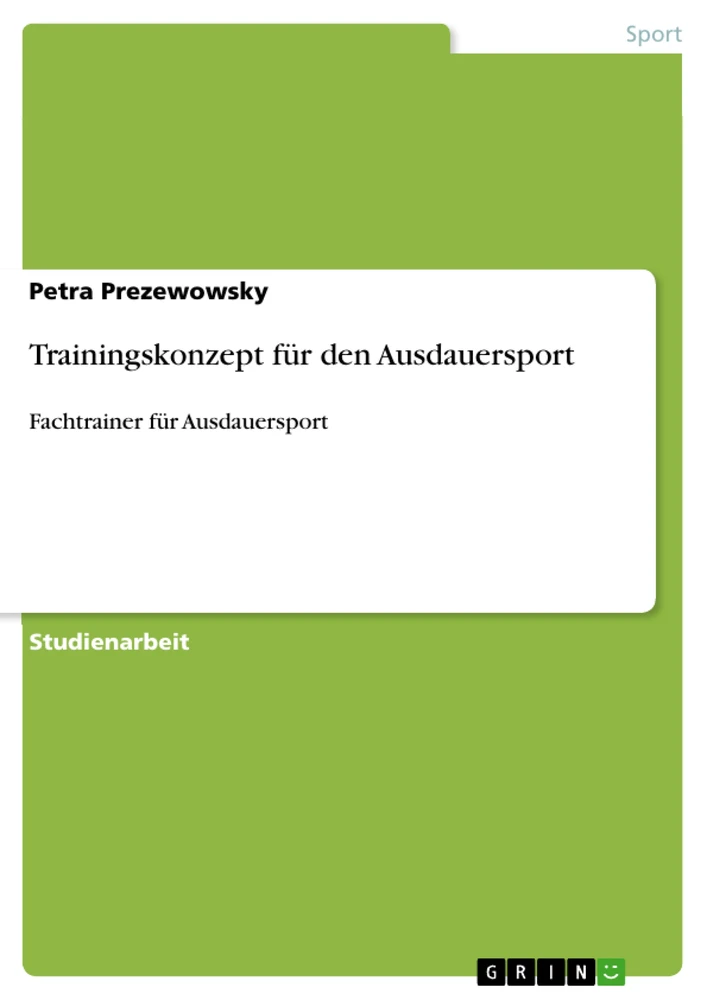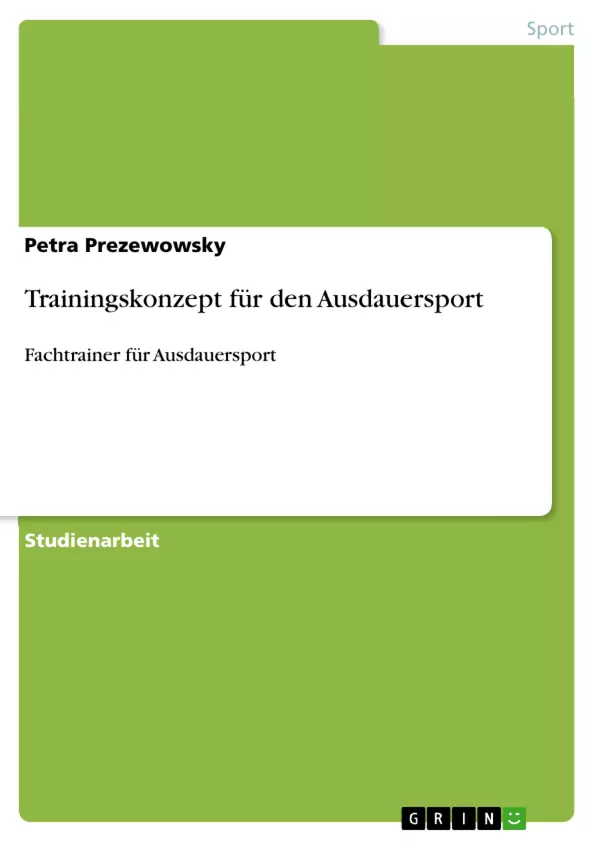Ein gesundheitsorientiertes Ausdauertraining – richtig durchgeführt – macht Freude und Spaß und verbessert so das Lebensgefühl. Der erste Schritt mag für manche vielleicht zunächst Überwindung bedeuten. Aber bereits nach kurzer Zeit wird die Freude an der Bewegung überwiegen und die verbesserte Lebensqualität den Aufwand sicher rechtfertigen.
Ines S. will sich intensiver mit dem Thema Ausdauer beschäftigen und hat für sich das Ziel gesetzt in 3 Monaten am 10 km Stadtlauf teilzunehmen.
Die Hausarbeit bezieht sich auf das 5-Stufen-Modell der optimalen Trainingssteuerung und begleitet meine Kundin bei der Planung und Steuerung eines für sie optimalen ausgelegten Ausdauertrainingsprogramms, um in 3 Monaten erfolgreich am Stadtlauf teilnehmen zu können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ausdauer
- Definition Ausdauer
- Formen der Ausdauer
- Ausdauer und Gesundheit
- Diagnose
- Eingangsfragebogen
- Zusammenfassung des Eingangsgesprächs
- Biometrische Tests
- Ausdauer-Testverfahren
- Ermittlung der Trainingsherzfrequenzen
- Nachbelastungspuls
- PWC (Physical Work Capacity)
- Test-Auswertung
- „Geschätzte Auswertung“ aus dem Protokoll
- Auswertung durch Berechnung mit Formel
- Relative und absolute Leistung
- Leistungsfähigkeit
- Mögliche Trainingsempfehlungen
- Zielsetzung
- Festlegung der Ziele
- Begründung der Ziele
- Trainingsplanung
- Makrozyklus/ Mesozyklus
- Erläuterungen und Begründung des Aufbaus
- Methodik des Aufwärmens
- Psychische/mentale Einstellung
- Allgemeines Aufwärmen
- Spezielles Aufwärmen
- Anpassungen des Organismus durch das Aufwärmen
- Ablauf des Aufwärmens
- Methodik des Abwärmens
- Ziele des Abwärmens
- Inhalte und Ablauf des Abwärmens
- Das Nachdehnen
- Trainingsdurchführung
- Didaktik und Methodik
- Fehlerkorrektur bei der Ausführung der Übungen
- Analyse
- Ziele und Inhalte der Analyse
- Durchführung und Ergebnisse der Re-Tests
- Bewertung der Re-Tests
- Literaturverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Erstellung eines individuellen Trainingsplans für Ausdauersport. Ziel ist es, die Kundin Ines S. bei der Planung und Steuerung eines optimalen Trainingsprogramms zu begleiten, um sie in drei Monaten erfolgreich am Stadtlauf teilnehmen zu lassen.
- Definition und Formen der Ausdauer
- Gesundheitsrelevante Aspekte von Ausdauertraining
- Individuelle Trainingsdiagnostik
- Trainingsplanung nach dem 5-Stufen-Modell
- Trainingssteuerung und -evaluierung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz von Ausdauertraining für Gesundheit und Leistungsfähigkeit dar und führt das 5-Stufen-Modell der optimalen Trainingssteuerung als Grundlage der Hausarbeit ein. Kapitel 2 definiert Ausdauer, erläutert verschiedene Formen und beleuchtet ihre Bedeutung für die Gesundheit. Kapitel 3 beschreibt den diagnostischen Prozess mit Eingangsfragebogen, biometrischen Tests und Ausdauer-Testverfahren. Kapitel 4 befasst sich mit der Zielsetzung des Trainingsplans und legt die individuellen Trainingsziele für Ines S. fest.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen Ausdauertraining, Trainingsplanung, 5-Stufen-Modell, Gesundheitsaspekte, Trainingssteuerung, individuelle Diagnostik, Leistungsfähigkeit und Zielsetzung.
- Quote paper
- Petra Prezewowsky (Author), 2010, Trainingskonzept für den Ausdauersport, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/267097